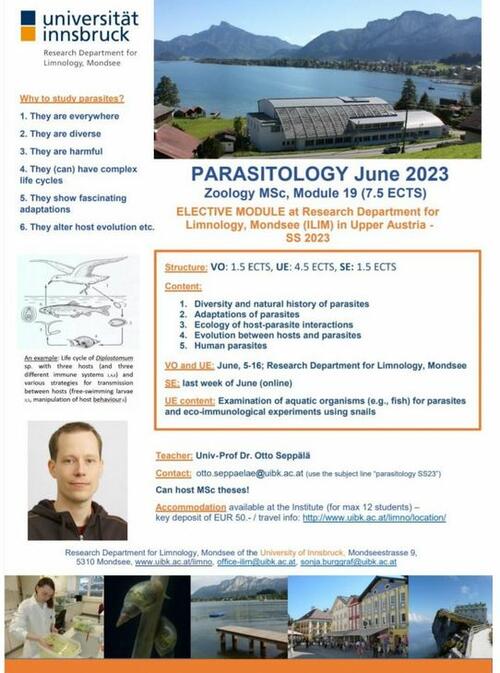News
2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 ·2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2008 · 2007 · 2006 · 2005 · 2004
2024
Minister Polaschek besuchte das Forschungsinstitut am Mondsee

HBM Polaschek beim Blick in eine Planktonprobe aus dem Mondsee mit FG Leiter M. Möst, Foto: S. Wanzenböck
„Exzellente Grundlagenforschung legt den Grundstein für Innovationen und anwendungsnahe Entwicklung und trägt somit zur Lösung von gesellschaftlichen Herausforderungen bei. Das beweist auch das Forschungsinstitut für Limnologie. Aus der Forschung, die dort betrieben wird, können wir wichtige Erkenntnisse zu Umwelteinflüssen ableiten und darauf reagieren.“ so Bundesminister Polaschek.
Das Forschungsinstitut für Limnologie der Universität Innsbruck (ILIM) ist durch seine Lage im oberösterreichischen Seengebiet ideal für die Gewässer- und Evolutionsforschung geeignet. Es bietet attraktive Studien- und Arbeitsbedingungen für ca. 50 Mitarbeiter:innen und Studierende, die hier forschen und lernen.
Im Rahmen einer Führung im Forschungsinstitut am 18. Juli 2024 informierte sich Bundesminister Martin Polaschek über die aktuellen Aktivitäten am Universitätsstandort in Mondsee. Der Dekan der Fakultät für Biologie, Paul Illmer, als Stellvertreter der Universität, berichtete über die Fakultät und die Einbindung der Forschungseinrichtung in Oberösterreich. Institutsleiter Otto Seppälä gab einen Einblick in seine aktuelle Forschung, den Interaktionen zwischen Süßwasserschnecken und ihren Parasiten im Zuge von zunehmenden Hitzeperioden in den Gewässern in einem eigens dafür adaptierten Kultur- und Laborraum im Gebäude.
Die beiden Forschungsgruppenleiter Josef Wanzenböck und Markus Möst berichteten über die Historie des Instituts, präsentierten die Forschungsinfrastruktur, die für das Arbeiten an den Gewässern unbedingt erforderlich ist und gewährten Einblicke in den Aquarienraum und das Bootshaus mit den Forschungsbooten. Bei einem Blick durch das Mikroskop in eine frische Planktonprobe aus dem Mondsee erläuterten die beiden Forschungsgruppenleiter aktuelle Forschungsbereiche am Institut wie Biodiversität, Nährstoffeintrag, invasive Arten, Reaktionen der Organismen auf den Klimawandel und Evolution. In einem der Labore konnte sich der Minister mit einigen der internationalen Studierenden über deren geplante Forschung unterhalten. Die Verantwortliche für Öffentlichkeitsarbeit, Sabine Wanzenböck, gab einen Überblick zu den Third Mission Aktivitäten, wie z.B. die kürzlich mit ca. 1000 Besucher:innen am Forschungsinstitut durchgeführte Lange Nacht der Forschung, die Junge Uni Workshops am Mondsee sowie aktuell laufende und geplante Citizen Science- und MINT-Projekte. Der Bürgermeister der Gemeinde St. Lorenz, Andreas Hammerl, nahm stellvertretend für die Mondseelandgemeinden am Besuch teil.
In seinem Eintrag ins ILIM-Gästebuch schrieb Herr Minister Polaschek: „Das ILIM ist eine wissenschaftliche Vorzeigeeinrichtung; Grundlagenforschung auf höchstem Niveau, eingebettet in ein großes internationales Netzwerk. Meine Hochachtung allen Forscherinnen und Forschern, allen Studierenden und unterstützenden Personen, die hier tätig sind – Sie alle machen eine sehr wichtige Arbeit für unsere Gesellschaft!“
online seit, 22.07.2024
Neue Publikation am ILIM (Mitarbeiter hervorgehoben)/new publication at ILIM (staff member in bold):
Shah M., Bornemann T.L.V., Nuy J.K., Hahn M.W., Probst A.J., Beisser D., Boenigk J. (2024). Genome-resolved metagenomics reveals the effect of nutrient availability on bacterial genomic properties across 44 European freshwater lakes. Environ Microbiol. 26(6):e16634. doi: 10.1111/1462-2920.16634
Es wird angenommen, dass die Verfügbarkeit der Nährstoffe Phosphor, Stickstoff und organischem Kohlenstoff die Dynamik von Bakterienpopulationen im Süßwasser beeinflusst. Dabei wird angenommen, dass nährstoffarme Bedingungen den evolutionären Prozess der Genomverkleinerung auslösen indem die Menge von Nährstoffen nicht zu stark dezimiert wird und die Vermehrung der Bakterien weiterhin möglich bleibt.
Diese Studie unterstreicht den signifikanten Einfluss der Nährstoffverfügbarkeit auf genomische Eigenschaften, wenn auch mit bemerkenswerter Variabilität. Diese Variabilität manifestiert sich nicht nur zwischen verschiedenen Bakterienarten innerhalb der Gemeinschaft, sondern auch in verschiedenen essentiellen Nährstoffen in Süßwasserökosystemen. Dabei wurde entdeckt, dass verschiedenen Bakterienstämme unterschiedliche Strategien zum Umgang mit Nährstoffbeschränkungen haben. Während Pseudomonadota ihre hohe Beweglichkeit nutzen, um Nährstoffe einzufangen, regenerieren Actinomycetota reduzierte Verbindungen, um in oligotrophen Gewässern zu überleben.
Die Open-Access-Förderung dieser Publikation wurde ermöglicht und organisiert vom Projekt DEAL.
online seit 18.07.2024
Neue Publikation am ILIM (Mitarbeiter hervorgehoben)/new publication at ILIM (staff members in bold):
Kuhl R., Strassert J.F.H., Čertnerova D., Varga E., Kreuz E., Lamatsch D.K., Wuertz S., Köhler J., Monaghan M.T., Stöck M. (2024). The haplotype-resolved Prymnesium parvum (type B) microalga genome reveals the genetic basis of its fish-killing toxins, Current Biology 34: 1-9, https://doi.org/10.1016/j.cub.2024.06.033
Diese Studie liefert beispiellose Details die Mikroalge Prymnesium parvum, die durch ihre Giftproduktion die Oderkatastrophe im Jahr 2022 verursachte. Hier wurde erstmals die Erbinformationen von P. parvum vom Typ B in Referenzqualität zusammengestellt. Das Genom in Referenzqualität wird ermöglichen, Veränderungen in der mikrobiellen Vielfalt angesichts zunehmender Umweltbelastungen besser zu verstehen, und bietet eine Grundlage für die Überwachung invasiver Prymnesium-Stämme in der Zukunft.
Die Publikation ist frei zugänglich Open Access erschienen und wurde vom Bundesamt für Naturschutz (BfN) mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Reaktorsicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) und einem Martina Roeselová-Gedächtnisstipendium finanziert.
Pressemeldungen:
Zeit online Erwischt! Jetzt haben Forscher den Fingerabdruck der Oder-Giftalge
idw: Komplettes Erbgut und Gift-Gene der Mikroalge der Oder-Katastrophe entschlüsselt
online seit, 12.07.2024
Biologisch Technische/r Assistent:in (m/w/d) gesucht
Für die Forschungsgruppe „Experimentelle Evolutionsökologie“ suchen wir zum nächst möglichen Zeitpunkt eine/n Biologisch Technische/n Assistent:in (m/w/d) in Teilzeit zu 20 Wochenstunden. Die Stelle ist auf zwei Jahre befristet.
Nähere Infos zur Forschung: https://www.uibk.ac.at/limno/personnel/stelzer/forschungsdetails.html
Hauptaufgaben
- Selbstständige Durchführung und Mitarbeit bei Forschungsarbeiten/Experimenten
- Aufrechterhaltung der Tier- und Algenzuchten
- Eingabe und Verwaltung von Forschungsdaten
- Anleitung von Studierenden bei Labortätigkeiten
Ihre Qualifikation
- Abgeschlossenes einschlägiges Bachelorstudium oder äquivalente technische Ausbildung (BTA/MTA/CTA/BMA oder Fachmatura mit Spezialkenntnissen)
- Fähigkeit zur selbstverantwortlichen und eigenständigen Planung und Durchführung komplexer Arbeitsvorgänge
- Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
- Hohe Kommunikationskompetenz, Fähigkeit zur Teamarbeit und Flexibilität
Das bieten wir
- Eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit in der biologischen Grundlagenforschung
- Beste Arbeitsbedingungen und ein nettes, hochqualifiziertes Team
- Darüber hinaus bietet die Universität Innsbruck ihren Mitarbeitern zahlreiche Zusatzleistungen (https://www.uibk.ac.at/universitaet/zusatzleistungen/).
Für diese Position ist ein kollektivvertragliches Entgelt von mindestens* brutto € 1299 / Monat (14-mal) bei 20h/Woche vorgesehen (VwGr. 3a).
*tätigkeitsbezogene Vorerfahrungen werden angerechnet
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis zum 07.08.2024. Bitte senden Sie Ihr Bewerbungsschreiben mit Unterlagen an:
claus-peter.stelzer@uibk.ac.at.
online seit 09.07.2024
Neue Publikation am ILIM (Mitarbeiter hervorgehoben)/new publication at ILIM (staff members in bold):
Weisse T., Pröschold T., Kammerlander B., Sonntag B., Schicker L. (2024). Numerical and thermal response of the bacterivorous ciliate Colpidium kleini, a species potentially at risk of extinction by rising water temperatures, Microbial Ecology 87:89, https://doi.org/10.1007/s00248-024-02406-y
In der vorliegenden Studie wurde das nahrungsabhängige Wachstum und die Wärmereaktion der bakterienfressenden Wimpertierchenart Colpidium kleini mit Hilfe von Experimenten untersucht. Der dabei verwendete C.-kleini-Stamm wurde aus dem Rifflsee, einem kleinen Alpensee, isoliert und durch die Kombination detaillierter morphologischer Untersuchungen mit molekularer Phylogenie bestimmt. Die Ergebnisse aus dieser Studie festigen die zunehmenden Belege dafür, dass viele Süßwasser-Ciliaten vom lokalen Aussterben bedroht sind, wenn die Erwärmung der Seen anhält. Wie etwa 70 andere Süßwasserwimpertierchen ist die hier untersuchte Spezies Colpidium kleini eine temperaturempfindliche Art, die keine Temperaturen über 22 °C verträgt. Dieser Ciliat kann als Indikatorart für eine kritische Erwärmung in kleinen Gewässern dienen.
Die Open Access Publikation wurde aus Mitteln der Universität Innsbruck und der Medizinischen Universität Innsbruck, die Forschungsarbeit wurde vom Österreichischen Forschungsfonds (FWF) und der Österreichischen Akademie der Wissenschaft (DOC-fFORTE-Stipendium) finanziert.
online seit 03.07.2024
Forschung zu Parasiten am Mondsee
online seit, 21.06.2024
Neuerliche Elritzenfunde im Sparkling Scienceprojekt


Im Mondsee konnten wieder Elritzen gefangen werden, Foto: S. Wanzenböck
Fotogalerie von der Freilandbeprobung 2024
Am 20. Juni 2024 startete die 2. Klasse der Mittelschule Mondsee mit den beiden Pädagog:innen Karin Stüber und Michael Maier erneut ins Freiland. Gemeinsam mit dem Projektteam im Sparkling Science Projekt "Kleine Fische ganz groß - Biodiversität der Elritzen in Österreich" wurden zum zweiten Mal Standorte am Mond- und Attersee und deren Einzugsgebiete beprobt. An allen Standorten wurden Wasserproben entnommen, die im Anschluss im Labor filtriert wurden um danach auf die Erbsubstanz (DNA) der Elritzen analysiert zu werden. An einer Probestelle wurde auch ein Uferzugnetz verwendet und erfolgreich einige Elritzen gefangen und damit direkt nachgewiesen. Außerdem fanden die Schüler:innen im Kandlbach einen Amerikanischen Signalkrebs, damit konnte auf die Problematik der invasiven Arten aufmerksam gemacht werden. An der Fuschler Ache gab es noch einen zusätzlichen Programmpunkt: hier fingen die Kinder die im Flussbett lebenden Insektenlarven (Makrozoobenthos) und bestimmten sie danach unter Anleitung. Für die Nahrung der Elritzen wäre an diesem Standort reichlich gesorgt. An den unterschiedlichen Probenahmestellen wurden die physikalische Parameter mittels Messsonde aufgenommen und protokolliert. Die unterschiedlichen Werte waren später auch im Labor beim Filtrieren der Proben ersichtlich. Nun geht es ans Auswerten und es bleibt spannend: Die Ergebnisse zeigen an, an welchen Standorten die gefährdete Elritze noch vorkommt. Im nächsten Jahr gibt es dann die letzte Probenahmeserie, dann kann auch ein Vergleich zwischen den drei Probenahmejahren gezogen werden.
Sparkling Science Projekt "Kleine Fische ganz groß - Biodiversität der Elritzen in Österreich"
online seit, 21.06.2024
PhD position available
at the Research Department for Limnology in Mondsee, Upper Austria (University of Innsbruck)
affiliated to the Interreg (Alpine Space) project “DiMark” (1st September 2024- 31th August 2027)
Alpine lakes face major challenges such as eutrophication through global change. In particular cyanobacteria and algae blooms the suitability of water bodies for drinking, recreational and economic purposes. Furthermore, algae blooms are usually associated with reduced biodiversity, lack of oxygen in the deep-water body as well as toxins posing a health risk. These developments can be better tracked and controlled through satellite data used for remote observation and improve collaboration between science and decision-makers. The aim of the project is to improve lake management using novel satellite-based methods to support adaptation to global change and disaster risk reduction. Within the project an online visualization tool with maps of the Alpine region to inspect and compare water status using key water quality indicators shall be developed.
The major tasks will include (i) the application of the satellite-based detection via the algae pigments (chlorophyll and phycobilin) for the remote observation of algae blooms in alpine lakes and (ii) comparing the satellite data with existing WFD monitoring data, e.g. for lakes in Upper Austria, Salzburg and Carinthia.
The PhD position will be financed for 3 years (30 hours per week) according to the University Collective Contract PhD salary (2684,10 € brutto per month). We are looking for a person holding a Master degree in Ecology/Limnology or related discipline with experience in imaging and processing of remote data for environmental observation. Parts of the working activities (e.g. linking of satellite data to water quality indices) will be performed with partner organisations of the project, i.e. in Italy, Switzerland, France, Germany or Slovenia. Further activities will comprise exploitation of metabarcoding data and its relation to remote sensing, report writing, preparation of scientific manuscripts, as well as communication with project partners and observers. The registration of the PhD thesis in Biology at the University of Innsbruck and the administration within the doctoral programme “Alpine Biology and Global Change” will be expected.
Further Information: Assoc. Prof. Dr. Rainer Kurmayer
Research Department for Limnology Mondsee, University of Innsbruck
For application please send a motivation letter together with a CV (in English) until 20th July 2024 to rainer.kurmayer@uibk.ac.at
online seit 18.06.2024
Positives feed back zweier italienischer Erasmusstudierender am Mondsee
Die beiden Erasmus-Studierenden Luna und Federico von der University of Camerino in Italien berichten über ihre Erfahrungen beim 3-monatigen Aufenthalt am Forschungsinstitut für Limnologie in Mondsee. Sie waren in die Forschungsgruppe von Bettina Sonntag eingebunden und wurden von Alexey Potekhin betreut. Sie hatten nicht nur die Möglichkeit neue Analysemethoden im Bereich der Gewässerökologie (Arbeit mit Wimpertierchen/Ciliaten) und Limnologie kennenzulernen, sondern konnten auch in einem internationalen Team ihre skills für ihre weitere berufliche Zukunft erweitern. Wir freuen uns, dass Luna und Federico von ihren Erasmusprojekten in Mondsee profitieren konnten und wünschen ihnen alles Gute für ihre weiteren Karrieren!
online seit, 17.06.2024
Neue Publikation am ILIM (Mitarbeiter hervorgehoben)/new publication at ILIM (staff members in bold):
Becz Á., Buonanno F., Achille G., Ortenzi C., Wanzenböck S., Warren A., Sonntag B. (2024). Protists in science communication, EJOP 95: 126094, doi: https://doi.org/10.1016/j.ejop.2024.126094
Protisten sind zu den Eukaryoten gehörende, mikroskopische ein- bis mehrzellige Lebewesen, die in einem eigenen Reich der Lebewesen zusammengefasst werden. Diese Gruppe ist trotz ihres großen Vorkommens und ihrer weiten Verbreitung in Ökosystemen in der Öffentlichkeit meist noch unbekannt. In dieser Publikation werden ausgewählte Ideen und Aktivitäten präsentiert und zusammengefasst, damit auch Multiplikator:innen und geschulte Laien anderen beibringen können, wie man Protisten erkennt, wo sie leben, in welchen Lebensräumen sie zu finden sind, wie sie aussehen und warum sie wichtig sind. In einem umfangreichen Anhang werden Beispiele und altersgerechte Methoden vorgeschlagen, um in Workshops Protisten erkennen zu können und generell für Protisten zu begeistern.
online seit 14.06.2024
Neue Publikation am ILIM (Mitarbeiter hervorgehoben)/new publication at ILIM (staff members in bold):
Darienko T., Pröschold T. (2024). Solotvynia, a New Coccoid Lineage among the Ulvophyceae (Chlorophyta). Microorganisms 12, 868. https://doi.org/10.3390/microorganisms12050868
Kokkoide (rundlich) Grünalgen die zur Klasse der Ulvophyceae gehören, werden trotz ihrer weiten Verbreitung oft übersehen. Sie kommen als Aufwuchs auf Meeresalgen vor oder wachsen auf Steinen oder Schalen von Muscheln und Korallen. Die meisten Arten sind allein anhand der Morphologie nicht leicht zu bestimmen, lassen sich jedoch anhand der gegeißelten Zellen bei der ungeschlechtlichen Vermehrung in zwei Gruppen einteilen: eine Gruppe mit zwei und eine Gruppe mit vier Geisseln. In der vorliegenden Veröffentlichung wird aufgrund der Analysen ein bisher nicht identifizierter Stamm nunmehr als neue Gattung Solotvynia innerhalb der neuen Ordnung Solotvyniales vorgeschlagen.
online seit 14.06.2024
Gewinnspiel bei der Langen Nacht der Forschung 2024 am Mondsee
Die fünf Gewinner:innen der Langen Nacht der Forschung 2024
mit den beiden Veranstalterinnen S. Wanzenböck (ILIM, links) und M. Ellmauer (TechnoZ, 5. von links)
Am 12.06.2024 hatte das Warten ein Ende...
die Gewinner:innen unseres Ratespiels standen fest und die Preise wurden im Technologiezentrum Mondseeland überreicht. Die Veranstalter:innen freuten sich über die große Zahl an Teilnehmer:innen beim Gewinnspiel, leider waren aber nur 5 Preise zu vergeben. Die Preise wurden vom Technologiezentrum Mondseeland und vom Forschungsinstitut für Limnologie, Mondsee, der Universität Innsbruck gestiftet.
Herzliche Gratulation an die fünf Gewinner:innen!
Wer noch mehr Forschung in den Sommerferien erleben möchte, der kann sich für unsere Junge Uni Workshops für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren über den Tourismusverband Mondseeland anmelden. Da kann man wieder mikroskopieren, pipettieren, ein Aquarium einrichten oder in die geheime Welt der Schnecken eintauchen. Gleich anmelden, die Plätze sind begrenzt!
Junge Uni Workshops 2024 Programm und Infos zur Anmeldung
Erinnerungen zur Langen Nacht der Forschung 2024 am Forschungsinstitut für Limnologie, Mondsee
online seit 13.06.2024
Das war die Lange Nacht der Forschung am Mondsee 2024


Blick vom Forschungsinstitut für Limnologie, Mondsee, bei der Langen Nacht der Forschung 2024
Foto: S. Wanzenböck
Mit 950 Besucher:innen am Forschungsinstitut für Limnologie in Mondsee konnten die Veranstalter:innen den Erfolg der Langen Nacht der Forschung in Mondsee bereits zum dritten Mal in Präsenz fortführen. An 34 Stationen wurde ein vielfältiges Programm für alle Altersstufen geboten. Die Mitarbeiter:innen des Forschungsinstituts der Universität Innsbruck präsentierten spannende Forschungsthemen und vermittelten die teilweise komplexen Ergebnisse auf verständliche Art. Planktonorganismen im Mikroskop, Fischsektion, Genetik, Klimafolgenforschung, neue Süßwasserbakterienarten, die Kooperation mit Schulen, Giftproduktion bei Blaualgen, Algen kosten, und mehr erfuhren Besucher:innen bei den Stationen des Forschungsinstituts. Dazu gab es noch weitere spannende Stationen vieler Partner und Institutionen aus der Region Mondseeland (Programm).
Ein Video von ML24 https://ml24.at/videos/lange-nacht-der-forschung-mondsee-21384 und Fotos von Cityfoto geben ein Stimmungsbild der Veranstaltung https://www.cityfoto.at/content/de/fotogalerie/17103/
Wir bedanken uns bei allen Stationsbetreiber:innen für ihren unermüdliche Einsatz und allen Besucher:innen für das große Interesse!
Bildergalerie des Forschungsinstituts für Limnologie, Mondsee
online seit 28.05.2024
Neue Publikation am ILIM (Mitarbeiter hervorgehoben)/new publication at ILIM (staff member in bold):
Jablonska, M., Cerasino L., Boscaini A., Capelli C., Greco C., Klemenčič A.K., Mischke U., Salmaso N., Kurmayer R. (2024). Distribution of toxigenic cyanobacteria in Alpine lakes and rivers as revealed by molecular screening. Water Research 121783, https://doi.org/10.1016/j.watres.2024.121783
Die Überwachung von Gewässern mit molekularen Methoden hinsichtlich zunehmender Nährstoffmengen und damit verbundenen, hohen Mengen an giftbildenden Cyanobakterien (Blaualgen), vermindert das Risiko für die menschliche Gesundheit. In dieser Studie wurden 29 Alpenseen und 18 Flüsse mit PCR-basierten Methoden einschließlich der Sequenzierung von PCR-Produkten und chemisch-analytischen Methoden untersucht, um viele Plankton- (n = 123) und Biofilmproben (n = 113) auf ihr Cyanotoxin-Produktionspotenzial zu untersuchen. Die molekularen Methoden bieten einen effizienten Ansatz für ein schnelles Screening von Gewässern auf das Vorhandensein toxischer Cyanobakterien sowohl in planktischen als auch benthischen Lebensräumen.
online seit 28.05.2024
Schüler:innen im Sparkling Science Projekt entdecken zwei neue Süßwasserbakterienarten
Sparkling Science Projekt Aquirufa
online seit 17.05.2024
Projekt "MINT connect" gestartet

Kürzlich wurde vom Technologiezentrum Mondseeland und dem Forschungsinstitut für Limnologie, Mondsee, der Universität Innsbruck die ARGE Wissensregion Fuschlsee Mondseeland gegründet – mit dem Ziel, MINT Themen (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik) in der Region voranzutreiben. Mit Unterstützung der LEADER-Region FUMO startet im Mai das Projekt “MINT connect” mit drei Ideenwerkstätten, die der Ideenfindung im MINT Bereich in den Themenbereichen Forschung, Bildung, Wirtschaft, Landwirtschaft, Kunst, Kultur, Soziales und Inklusion dienen und das große vorhandene Potential für künftige Aktivitäten in der Region zusammenführen sollen. Gefördert wird das Projekt von der Forschungsförderungsgesellschaft FFG im Förderprogramm Ländliche Innovationssysteme im Rahmen der Europäischen Innovationspartnerschaft.
online seit 12.5.2024
Lange Nacht der Forschung 2024 am Forschungsinstitut für Limnologie in Mondsee
Eindrücke von der Langen Nacht der Forschugn 2022, rechts, Fotos: ILIM, TechnoZ
Heuer wird die Lange Nacht der Forschung bereits zum dritten Mal in Mondsee veranstaltet. Am 24. Mai 2024 zwischen 17 und 23 Uhr am Forschungsinstitut für Limnologie der Universität Innsbruck, Mondseestrasse 9, 5310 Mondsee, können mehr als 30 Stationen kostenfrei besucht werden.
Ein interessanter Mix aus unterschiedlichen Fachbereichen wird im Institutsgebäude und im Außenbereich für die Besucher:innen aller Alterstufen geboten. Es werden Themenbereiche wie z.B. Gewässerforschung, Robotik, Astronomie, Gesundheit, Klimaforschung, Fischbiologie, Pfahlbau, Technik, Upcycling, Genetik, Mikrobiologie und vieles andere mehr vertreten sein. Tolle Preise warten bei einem Gewinnspiel auf Sie.
In Kürze wird die Webseite der Langen Nacht der Forschung 2024 freigeschalten, dann können Sie sich unter der Region Mondsee einen Überblick über das breite Angebot machen. Schon jetzt stellen wir auf unserer Facebook-Seite, unter https://www.facebook.com /Mondseelimnology/ und der Facebook-Seite des Technologiezentrums Mondseeland, unter https://www.facebook.com/tzmondseeland jeden Tag eine Station vor, die Sie am 24.5.2024 besuchen können.
Für internationale Gäste wird eine Station mit mehrsprachigen Guides zur Verfügung stehen.
Freuen Sie sich mit uns auf diesen spannenden Forschungsevent in Ihrer Region!
online seit 12.04.2024
Seminarankündigung
Neue Publikation am ILIM (Mitarbeiter hervorgehoben)/new publication at ILIM (staff member in bold):
Bunell D.B., Anneville O., Baer J., Bean C.W., Kahilainen K.K., Sandström A., Selz O.M., Vonlanthen P., Wanzenböck J., Weidel B.C. (2024). How diverse is the toolbox? A review of management actions to conserve or restore coregonines. International Journal of Limnology 60(5), https://doi.org/10.1051/limn/2024002

Coregone (Reinanke), Foto: Josef Wanzenböck
In den vergangenen Jahrhunderten waren Coregonen, beliebte Speisefische aus der Gruppe der Lachsartigen, einer Reihe von Stressfaktoren ausgesetzt, die in manchen Gebieten zum Rückgang oder sogar zum Aussterben dieser Fischgattung geführt haben. Fischereimanager:innen sind sich dieser Problematik bewusst und haben begonnen, Coregonen dort wieder anzusiedeln, wo sie ausgerottet worden waren. Die vorliegende Arbeit fasst die Primär- und graue Literatur zusammen, um die Vielfalt der bisher angewandten Maßnahmen zur Wiederherstellung oder Erhaltung von Coregonenpopulationen aufzuzeigen, die bisher zum Einsatz kamen. Aus der gesichteten Literatur und den in internationalen Coregonensymposien präsentierten Daten wird klar, dass die Maßnahmen von Erhaltungs- oder Wiederherstellungsmaßnahmen bei Coregonen im Gegensatz zu traditionellen, fischereilichen Ansätzen (z.B. Ergänzung der der Fischerei, Bestandsabschätzung) oder der Untersuchung der Lebensgeschichte und Genetik nicht so gut dokumentiert sind. Im Idealfall können durch diesen umfassenden Überblick Erhaltungs- und Wiederherstellungsstrategien bei künftigen Bewirtschaftungsmaßnahmen besser durchgeführt und eine größere Vielfalt an potenziellen Maßnahmen vor Ort angewandt werden.
Die Thematik war Inhalt eines eingeladenen Plenarvortrags beim Internationalen Coregonensymposiums 2023 in Evian, Frankreich und ist als Open Accesspublikation verfügbar.
online seit 10.04.2024
Neue Publikation am ILIM (Mitarbeiter:innen hervorgehoben)/new publication at ILIM (staff members in bold):
Seppälä O., Katsianis G., Stabauer V., Seppälä K., Salo T. (2024). Resource level modifies heatwave responses in the freshwater snail Lymnaea stagnalis. Freshwater Biology (online first) DOI: https://doi.org/10.1111/fwb.14239
Profitieren oder Verlieren bei Hitzewellen

Spitzschlammschnecken (Lymnaea stagnalis), Foto: O. Seppälä
Steigende Temperaturen infolge des Klimawandels bringen für viele Organismen große Einschränkungen, für andere können sie auch positive Effekte haben. Wer profitiert und wer verliert hängt wahrscheinlich von Umweltfaktoren ab. Nun hat ein Team um den Ökologen Otto Seppälä von der Universität Innsbruck am Mondsee experimentell beobachtet, wie Süßwasserschnecken Hitzewellen bei guten Futterbedingungen überstehen und neben den erlittenen negativen Folgen auch so manchen Vorteil daraus ziehen können.
Mehr Futter macht fitte Schnecken hitzebeständiger
Die Auswirkungen sind einerseits von der Höhe der Hitzebelastung abhängig, aber auch von der Verfügbarkeit an Ressourcen, die die negativen Effekte abmildern können. Otto Seppälä hat am Forschungsinstitut für Limnologie in Mondsee Süßwasserschnecken der Art Lymnea stagnalis experimentell Hitzewellen ausgesetzt, indem er das Wasser eine Woche lang auf 27° Celsius erwärmt hat. Dies entspricht etwa der Dauer von Hitzewellen an Seen und Teichen in Mitteleuropa. Einer Gruppe von Schnecken wurde dabei uneingeschränkt Salatblätter zur Verfügung gestellt, andere Schnecken erhielten nur die Hälfte oder überhaupt kein Futter. Es zeigte sich, dass die Schnecken bei höheren Temperaturen, unbeschränkter Futtermenge und besserem physiologischem Ausgangszustand ihre Wachstumsrate und Fruchtbarkeit um das Dreifache gegenüber jenen Schnecken steigern konnten, die bei einer moderaten Temperatur von 17°C gehalten wurden. Diese positiven Effekte waren bei Schnecken mit begrenzten Nahrungsressourcen schwächer ausgeprägt. Nach der Hitzewelle zeigten hitzegeplagte Schnecken jedoch eine geringere Reproduktionsrate als andere Schnecken, und dieser Effekt war bei Schnecken mit reduzierten Nahrungsressourcen am stärksten. Nach der Hitzewelle wuchsen die nach belieben fressenden Schnecken genauso schnell wie jene Schnecken, die keinem Temperaturversuch ausgesetzt waren.
Verschiebung der Hitzeperioden als Risikofaktor
Die Verfügbarkeit von Ressourcen und Nahrung im natürlichen Lebensraum der Schnecken variiert normalerweise sowohl räumlich als auch zeitlich. Aus der Studie resultiert, dass Schneckenpopulationen in den Sommermonaten mit vielen Ressourcen am besten in der Lage sein werden, die negativen Auswirkungen hoher Temperaturen und künftiger Hitzewellen zu vermeiden. „Eine zeitliche Verschiebung der Hitzewellen ins Frühjahr oder in den Herbst würde aber auch für diese Populationen ein Problem darstellen, dem die Schnecken nur durch evolutionäre Anpassungen langfristig entkommen könnten“, erklärt Otto Seppälä.
Pressemeldung Newsroom der Universität Innsbruck
online seit 10.04.2024
Partnerwahl bei Schmetterlingen: Gen steuert Präferenzen
links: Heliconius Schmetterling am Cover der Zeitschrift Science, Foto: Carolin Bleese, LMU;
rechts: FG-Leiter Markus Möst, Foto: Sabine Wanzenböck, ILIM
Ein internationales Team von Biologen – unter ihnen Markus Möst von der Universität Innsbruck – hat in tropischen Heliconius-Schmetterlingen erstmals eine direkte Verbindung zwischen einem Gen und dem Balzverhalten nachgewiesen. Ein bei der Kreuzung zweier Schmetterlingsarten weitergegebenes Gen ist verantwortlich dafür, dass Männchen beider Arten Weibchen mit roten Mustern bevorzugen. Damit haben die Forschenden nachgewiesen, dass Hybridisierung bei der Evolution von Verhaltensweisen eine wichtige Rolle spielen kann.
Leuchtende Farben und Muster auf den Flügeln sind ein charakteristisches Kennzeichen der tropischen Heliconius-Schmetterlinge. Dieses auffällige Äußere schreckt nicht nur Fressfeinde ab – die Schmetterlinge sind giftig und schmecken für Vögel bitter – es ist auch ein wichtiges Signal für die Partnerwahl. Ein Team um den Evolutionsbiologen Richard Merrill von der Ludwig-Maximilians-Universität München hat sich in Kooperation mit Markus Möst, Gruppenleiter am Forschungsinstitut für Limnologie, Mondsee, der Universität Innsbruck und Forschenden der Universidad del Rosario in Bogota und dem Smithsonian Tropical Institute in Panama nun die außergewöhnliche Vielfalt der Warnmuster verschiedener Heliconius-Arten zunutze gemacht, um die genetischen Grundlagen solcher Präferenzen zu untersuchen. „In dieser Studie ist es zum ersten Mal gelungen, ein Gen zu identifizieren, das die visuelle Partnerwahl bei Tieren bestimmt und damit für die Bildung und Abgrenzung von Arten eine wichtige Rolle spielt,“ erklärt Markus Möst, Co-Autor der im Fachmagazin Science publizierten Arbeit.
Für ihre Studie untersuchten die Forschenden in Verhaltensexperimenten die Paarungspräferenzen von drei Arten in Kolumbien: Heliconius melpomene und Heliconius timareta, die beide ein leuchtend rotes Band auf dem Vorderflügel tragen, sowie Heliconius cydno, die ein weißes oder gelbes Vorderflügelband aufweist. Dabei zeigte sich, dass Männchen aller Arten jeweils Partner bevorzugen, die aussehen wie sie selbst, wobei es bei den roten Arten keine Unterschiede in ihren Präferenzen gab.
Genaustausch durch Kreuzung
Alle in der Studie untersuchten Heliconius-Arten können sich grundsätzlich kreuzen und fruchtbare Nachkommen hervorbringen, wobei sich nur das Verbreitungsgebiet von H. melpomene mit dem der anderen beiden Arten überschneidet. Mithilfe verschiedener genetischer Untersuchungen wiesen die Forschenden nach, dass die Präferenz für rote Weibchen sowohl bei H. melpomene als auch bei H. timareta mit einer genomischen Region verbunden ist, die diesen beiden rot-gebänderten Arten infolge von Hybridisierung gemeinsam ist. „Uns ist es gelungen, in genau dieser Region das Gen regucalcin1 als das ausschlaggebende Gen zu identifizieren, das die visuellen Präferenzen beider Arten steuert“, sagt Matteo Rossi, der gemeinsam mit Alexander Hausmann als Doktorand in Merrills Labor an den Schmetterlingen forschte. „Wird regucalcin1 ausgeschaltet, beeinträchtigt das das Balzverhalten gegenüber Artgenossen, was eine direkte Verbindung zwischen diesem Gen und dem Balzverhalten beweist“, erklärt Rossi.
Durch ihre Analysen zeigten die Wissenschaftler, dass irgendwann in der evolutionären Vergangenheit regucalcin1 durch Kreuzung von H. melpomene an H. timareta weitergegeben wurde – es hat also Artgrenzen überwunden. „Wir wussten schon länger, dass das Gen für das rote Farbmuster durch Hybridisierung von einer Art auf die andere übertragen wurde, und vermuteten, dass dies auch für die entsprechende Paarungspräferenz gelten könnte. Dass wir dies nun endlich zeigen und das spezifische Gen identifizieren konnten, ist wirklich großartig“, sagt Carolina Pardo-Diaz, Dekanin für Biologie an der Universidad del Rosario und eine der Co-Autorinnen der Studie. Durch regucalcin1 wurde dann die Anziehungskraft von roten Weibchen und damit der Fortpflanzungserfolg von H. timareta erhöht.
„Wir sehen überall in der Natur Unterschiede in den visuellen Präferenzen, wenn Tiere Partner wählen. Insgesamt konnten wir mit unseren Ergebnissen zum ersten Mal eine direkte Verbindung zwischen einer bestimmten visuellen Präferenz und einem spezifischen Gen zeigen und nachweisen, dass Hybridisierung bei der Evolution dieser Verhaltensweisen eine Rolle spielt“, betont Richard Merrill von der LMU München.
Publikation: Adaptive introgression of a visual preference gene. Matteo Rossi, Alexander E. Hausmann, Pepe Alcami, Markus Moest, Daniel Shane Wright, Chi-Yun Kuo, Daniela Lozano, Arif Maulana, Lina Melo-Flórez, Geraldine Rueda-Munoz, Saoirse McMahon, Mauricio Linares, W. Owen McMillan, Carolina Pardo-Diaz, Camilo Salazar & Richard M. Merrill: Science 2024 DOI: 10.1126/science.adj9201
Pressemeldungen:
Newsroom Universität Innsbruck
online seit 22.03.2024
Wasser für Frieden - Weltwassertag 2024

Foto: UN-Water
Der Weltwassertag, der jährlich am 22. März begangen wird, soll das Bewusstsein für die Wasser- und Abwasserkrise schärfen und zum Handeln anregen. Heuer steht er unter dem Motto "Wasser für den Frieden nutzen". Seit 1993 wird dieser Tag jährlich von den Vereinten Nationen (UN) als Beobachtungstag begangen. Er soll die Aufmerksamkeit auf die globale Wasserkrise lenken und das Bewusstsein für jene 2,2 Milliarden Menschen schärfen, die keinen Zugang zu sauberem Wasser haben.
Als wichtigste Schlüsselbotschaften für den Weltwassertag sind laut UN die folgenden zu nennen:
# Wasser kann Frieden schaffen oder Konflikte auslösen. Wenn Wasser knapp oder verschmutzt ist oder wenn Menschen ungleichen oder gar keinen Zugang haben, können Spannungen zwischen Gemeinschaften und Ländern entstehen. Wenn wir im Bereich Wasser zusammenarbeiten, können wir den Wasserbedarf aller ausgleichen und zur Stabilisierung der Welt beitragen.
# Wohlstand und Frieden sind auf Wasser angewiesen. Bei der Bewältigung des Klimawandels, der Massenmigration und politischer Unruhen müssen die Nationen die Zusammenarbeit im Bereich Wasser in den Mittelpunkt ihrer Pläne stellen.
# Wasser kann uns aus der Krise führen. Wir können die Harmonie zwischen Gemeinschaften und Ländern fördern, indem wir uns gemeinsam für eine gerechte und nachhaltige Wassernutzung einsetzen - von den Konventionen der Vereinten Nationen auf internationaler Ebene bis hin zu Maßnahmen auf lokaler Ebene.
# Mehr als 3 Milliarden Menschen weltweit sind von Wasser abhängig, das über nationale Grenzen hinweg fließt. Doch nur 24 Länder haben Kooperationsabkommen für ihr gesamtes gemeinsames Wasser abgeschlossen.
# Angesichts der zunehmenden Auswirkungen des Klimawandels und des Bevölkerungswachstums besteht die dringende Notwendigkeit, sich innerhalb und zwischen den Ländern zum Schutz und zur Erhaltung unserer wertvollsten Ressource zusammenzuschließen.
# Gesundheit und Wohlstand der Bevölkerung, Nahrungsmittel- und Energiesysteme, wirtschaftliche Produktivität und ökologische Integrität hängen alle von einem gut funktionierenden und gerecht verwalteten Wasserkreislauf ab.
Der Weltwasserentwicklungsbericht der Vereinten Nationen (WWDR) ist das Flaggschiff von UN-Water zu Fragen der Wasser- und Sanitärversorgung. Der Bericht, der jedes Jahr am Weltwassertag veröffentlicht wird, befasst sich mit einem anderen Thema und gibt den Entscheidungsträgern politische Empfehlungen, indem er bewährte Verfahren und eingehende Analysen vorstellt. Der WWDR wird von der UNESCO im Namen von UN-Water herausgegeben und seine Erstellung wird vom UNESCO World Water Assessment Programme koordiniert.
Wir müssen uns bewusst machen, dass Wasser nicht nur eine Ressource ist, die genutzt wird und um die man konkurriert - es ist ein Menschenrecht, das für jeden Aspekt des Lebens unverzichtbar ist. An diesem Weltwassertag müssen wir Wasser für den Frieden nutzen, um die Grundlagen für eine stabilere und wohlhabendere Zukunft zu schaffen.
Link zum Weltwasserbericht 2023
online seit 21.03.2024
Workshops am Bundesgymnasium Vöcklabruck





Schüler:innen beim Workshop am BG Vöcklabruck, Fotos: S. Wanzenböck
Am Montag, 18.03.2024 besuchten Wissenschafterinnen der Universität Innsbruck das Bundesgymnasium Vöcklabruck. Nach einer Vorstellung des Forschungsinstituts für Limnologie, Mondsee, gab es zwei parallele Workshops zu den Themen DNA/Genetik und Biodiversität. Die Schüler:innen konnten dabei nach einem Vortrag, in Mitmachexperimenten und in Gruppenarbeiten aktiv wichtige Grundlagen der Biodiversität selbst erarbeiten und verstehen lernen. Dabei wurde vor allem auf die Bewusstseinbildung zu Auswirkungen des Klimawandels und anthropogener Einflüsse Wert gelegt und mögliche Schutzmaßnahmen zur Eindämmung von Artenschwund und Zerstörung von Lebensraum eingegangen. In einem parallelen Workshop erfuhren die Schüler:innen über die Grundlagen der Genetik und der Erbsubstanz (DNA) und konnten in einer simulierten Laborsituation selbst DNA gewinnen. Die Schüler:innen der 4c diskutierten, experimentierten und arbeiteten intensiv mit. Wir bedanken uns für das Interesse!.
online seit 20.03.2024
Neue Publikation am ILIM (Mitarbeiter hervorgehoben)/new publication at ILIM (staff member in bold):
He Z., Naganuma T., Nakai R., Uetake J., Hahn M.W. (2024). Microbiomic analysis of bacteria associated with rock tripe lichens from Alpine areas in Eastern Alps and Equatorial Africa. Current Microbiology, 115: 81 (https://doi.org/10.1007/s00284-024-03626-8)
In der Studie wurde die Vielfalt der mit alpinen Flechten assoziierten Bakterien in den osteuropäischen Alpen (Österreich) und in den Rwenzori-Bergen in Äquatorialafrika (Uganda) verglichen. Dabei lag der Schwerpunkt auf Kammflechten der Familie der Umbilicariaceae. Die Analysen der Daten lassen darauf schließen, dass die regionsspezifischen Unterschiede in der Zusammensetzung des bakteriellen Mikrobioms auf einen von drei Faktoren oder eine Kombination dieser Faktoren zurückzuführen sein könnten. Diese Faktoren sind (i) regionsspezifische taxonomische Unterschiede zwischen den Flechtenwirten, wobei die Algensymbionten ein potenziell wichtiger Faktor sein könnten, aber eine weitere Validierung erforderlich ist, (ii) ein Mechanismus der Isolierung durch Entfernung, der die bakterielle Ausbreitung zwischen den beiden alpinen Regionen potenziell einschränkt, und (iii) regionsspezifische klimatische Unterschiede, die teilweise unterschiedliche Gruppen von Bakterientaxa begünstigen, die ausreichend an die lokalen klimatischen Bedingungen angepasst sind.
online seit 15.03.2024
Exzellenter Abschluss einer Doktorarbeit am Mondsee


Elisabeth Entfellner mit "Doktorhut" (links), und mit dem Prüfungs-Betreuerteam (rechts), v.l.n.r.: M. Hahn, E. Entfellner, M. Cichna-Markl, R. Kurmayer, Fotos: S. Wanzenböck
Am 12.03.2024 verteidigte Elisabeth Entfellner am Forschungsinstitut für Limnologie in Mondsee ihre Doktorarbeit. Der Titel ihrer defensio lautete "Towards an understanding of secondary metabolite diversity among the algal-bloom forming cyanobacterium Planktothrix". In ihrem Vortrag referierte sie über die vier Publikationen aus ihrer Abschlussarbeit und konnte das sehr komplexe Thema dem interessierten Publikum vermitteln. Unter anderem untersuchte sie in ihrer Arbeit die genetischen Grundlagen der, von Cyanobakterien (Blaualgen) produzierten Verbindungen, z.B. dieTetrapeptide Aeruginosine (Aer), die weit verbreitet sind. Insgesamt wurden 124 Stämme von filamentösen Cyanobakterien Planktothrix spp., aus verschiedenen Süßwassergewässern isoliert und hinsichtlich der Variabilität innerhalb der Aer-Biosynthesegene analysiert. Sowohl die schriftliche Arbeit, als auch die defensio und die anschließenden Fragen der Prüfer:in konnte sie exzellent meistern und erhielt dafür eine Auszeichnung.
Als Prüfer fungierten die Chemikerin und stv. Leiterin des Instituts für Analytische Chemie der Universität Wien, Margit Cichna-Markl (auch Betreuerin der PhD) und der Mikrobiologe und Forschungsgruppenleiter (FG) in Mondsee, Martin Hahn. Die Publikation wurde von FG- und stv. Institutsleiter Rainer Kurmayer betreut, der bei der defensio den Vorsitz übernahm.
Wir gratulieren sehr herzlich!
online seit, 13.03.2024
Hanna Pritsch gewinnt den Student Paper Award 2023 des "IDC Alpine Biology and Global Change" der Universität Innsbruck
Konzept der Publikation (links) und Preisträgerin Hanna Pritsch, Foto: privat
Beim IDC 2023 Student Paper Award des IDC Alpine Biology and Global Change wurden die besten Arbeiten prämiert, die von IDC-StudentInnen als HauptautorInnen veröffentlicht wurden. Die Publikationen mussten dafür im Jahr 2023 in einem international-begutachteten Journal veröffentlicht oder angenommen worden sein, das in den Journal Citation Reports unter den besten 25% (=Q1) der jeweiligen Kategorie gelistet ist. Zudem war die aktive Teilnahme an den IDC-Seminaren Voraussetzung für eine Auszeichnung. Die Beteiligung mehrerer Forschungsgruppen an der Arbeit wurde zusätzlich gewichtet.
Doktorandin Hanna Pritsch (Betreuer: R. Kurmayer) wurde diesmal für ihre Publikation:
Pritsch, H., Schirpke, U., Jersabek, C. D., and Kurmayer, R. (2023). Plankton community composition in mountain lakes and consequences for ecosystem services. Ecological Indicators, 154, 110532. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2023.110532
ausgezeichnet.
In der veröffentlichten Studie wurden die Zusammensetzung der Planktongemeinschaft in 26 Bergseen in den europäischen Alpen und die Folgen für die Ökosystemleistungen (ÖSL) untersucht. Unter ÖSL versteht man die direkten und indirekten Beiträge von Ökosystemen zum menschlichen Wohlergehen. Sie beschreiben damit die Mensch-Umwelt-Beziehungen. Dabei ist zu beachten: je intakter ein Ökosystem ist, desto hochwertiger können die ÖSL sein, die der Mensch von der Natur bezieht. Die Ergebnisse zeigen, dass eine ökologische Verschlechterung in diesen Seen die zukünftige Bereitstellung von ÖSL negativ beeinflussen könnte, was die Dringlichkeit von Schutzmaßnahmen angesichts des globalen Wandels unterstreicht. Die Studie unterstreicht die Bedeutung des Schutzes unberührter Bergseen. Insbesondere die Daten zur Zusammensetzung der Planktongemeinschaft könnten als wertvolle Orientierungshilfe für die Priorisierung von Seen für Schutzmaßnahmen dienen.
Wir gratulieren herzlich!
online seit 04.03.2024
Besuch im Forschungsinstitut
Gruppenfoto vor dem Forschungsinstitut und Schüler am Mikroskop, alle Fotos: S. Wanzenböck
Früh übt sich... Die erste Klasse der Mittelschule Mondsee hat im Zuge ihres Projekts "Sauberes Wasser" das Forschungsinstitut für Limnologie, Mondsee besucht. Forschungsgruppenleiter Rainer Kurmayer und Werkstattleiter Sebastian Mayer zeigten den Schüler:innen wie Wasserproben aus dem Mondsee gewonnen werden und welche Planktonorganismen man darin findet. Wir hoffen, dass uns einige der Schüler:innen auch bei der Langen Nacht der Forschung und bei unseren Junge Uni Sommerworkshops besuchen werden.
Beim Mikroskopieren des Mondseeplanktons
online seit 04.03.2024
Einladung zur Verteidigung
Elisabeth Entfellner wird am 12. März 2024 um 14 Uhr ihre Doktorarbeit mit dem Titel "Towards an understanding of secondary metabolite diversity among the algal-bloom forming cyanobacterium Planktothrix" am Forschungsinstitut für Limnologie, Mondsee, verteidigen. Es besteht die Möglichkeit auch online daran teilzunehmen, Link https://eu01web.zoom.us/j/61147978878 Die Studierende wurde während ihrer PhD am Forschungsinstitut von FG Leiter Rainer Kurmayer betreut.
online seit 28.02.2024
Abschluss Hydrobotanik Kurs am Mondsee
Studierende mit LV-Leiter R. Kurmayer (links) und Tutorin (rechts außen), Foto: S. Wanzenböck
Studierende im Masterstudium Botanik absolvierten in dieser Woche das einwöchige Wahlmodul 11/Hydrobotanik am Forschungsinstitut für Limnologie, Mondsee. Das Modul befähigt die Studierenden in einer Kombination von traditionell taxonomischen und molekular-taxonomischen Untersuchungen zur funktionalen und ökologischen Bewertung von Gewässern in Theorie und Praxis.
online seit 09.02.2024
Neue Publikation am ILIM (Mitarbeiter hervorgehoben)/new publication at ILIM (staff member in bold):
Castelli M., Nardi T., Gammuto L., Bellinzona G., Sabaneyeva E., Potekhin A., Serra V., Petroni G., Sassera D. (2024). Host association and intracellularity evolved multiple times independently in the Rickettsiales. Nature communications 15:1093, https://doi.org/10.1038/s41467-024-45351-7
Die Rickettsiales sind eine Bakteriengruppe, die nur als Endosymbionten innerhalb fremder Zellen überleben können. Zu ihnen zählen sowohl Krankheiterreger, als auch Bakterien, die z.B. in Wechselbeziehung mit anderen Organismen leben, aus der beide Partner einen Vorteil haben (Mutualismus). In der vorliegenden Studie wurden Ursprung und Entwicklung der Wechselwirkungen zwischen den Rickettsiales und ihren Wirten untersucht.
Die Publikation ist im Open Access verfügbar und wurde im Human Frontier Science Program (HFSP), im European Community’s H2020 Programme H2020-MSCA-RISE 2019 und der Förderung NextGenerationEU-MUR PNRR Erweiterte Partnerschaftsinitiative zu neu auftretenden Infektionskrankheiten unterstützt.
online seit 09.02.2024
Junge Uni Programm 2024 am Mondsee
Junge Uni Workshop, Foto: S. Wanzenböck
In den Sommerferien 2024 gibt es wieder 5 Junge Uni Workshops am Forschungsinstitut für Limnologie in Mondsee! Lerne mit uns Mikroorganismen unter dem Mikroskop kennen und entdecke wer im Mondsee trötet, geh mit uns zur Schneckensafari, richte mit uns ein Aquarium ein oder schlüpfe als Forscher:in selbst in Labormantel und Handschuhe! Wir freuen uns auf Kinder zwischen 7 und 12 Jahren! Heuer können wir sogar mehrsprachige Workshops anbieten! Unsere Workshopleiter:innen sprechen deutsch, englisch und russisch!
Gleich anmelden beim Tourismusverband Mondseeland unter +43 (0)6232 2270 oder info@mondsee.at
online seit 08.02.2024
Neue Publikation am ILIM (Mitarbeiter:innen hervorgehoben)/new publication at ILIM (staff members in bold):
Pitt A., Lienbacher S., Schmidt J., Neumann Schaal M., Wolf J., Hahn M.W. (2024). Description of a new freshwater bacterium Aquirufa regiilacus sp. nov., classification of the genera Aquirufa, Arundinibacter, Sandaracinomonas, and Tellurirhabdus to the family Spirosomataceae, classification of the genus Chryseotalea to the family Fulvivirgaceae and Litoribacter to the family Cyclobacteriaceae, as well as classification of Litoribacter alkaliphilus as a later heterotypic synonym of Litoribacter ruber. Archives of Microbiology 206(79), https://link.springer.com/article/10.1007/s00203-023-03801-8
Schüler:innen im Sparkling Science Projekt Aquirufa, Fotos: A. Pitt
Der Artikel enthält die Beschreibung einer neuen Bakterienart aus dem Leopoldskroner Weiher. Sie ist im Rahmen des Sparkling Science Projektes Aquirufa: Biodiversität und Ökologie von Gewässerbakterien entstanden. Im Projekt arbeiten Wissenschaftler/innen gemeinsam mit Citizen Scientists an der Erforschung von Gewässerbakterien. Entdeckt haben die neue Art Schülerinnen des BORG Nonntal. An der Publikation sind neben Kooperationspartnern von der Deutschen Sammlung von Mikroorgansimen und Zellkulturen, Braunschweig und den Global Underwater Explorers, Austria, Schülerinnen und Schüler vom BORG Nonntal, dem BG Vöcklabruck und dem BRG Schloss Wagrain auf vielfältige Weise beteiligt. Die Schüler/innen wählten Gewässer aus, sammelten Wasserproben, führten Messungen durch, legten Bakterienkulturen an, arbeiteten im Labor in Mondsee mit und kreierten einen Namen für die neue Art.
online sei 30.01.2024
Tiroler Nachwuchsförderung an PhD Studierenden in Mondsee
Links: Gruppe der Preisträger mit Vizerektor und Landesrätin, Foto Universität Innsbruck
Rechts: Rubén Morón-Asensio, Foto: S. Wanzenböck
28 Wissenschaftler:innen unterschiedlichster Fachrichtungen erhielten kürzlich eine Förderzusage aus der Tiroler Nachwuchsforscher:innen-Förderung. Mit dabei Rubén Morón-Asensio, der gerade in der Forschungsgruppe von Rainer Kurmayer an seiner Doktorarbeit über das Blaualgengift Microcystin und den Nachweis in Wasserflöhen arbeitet. Die PhD wurde bisher im Rahmen des FWF projekts "SLOT - Subcellular localization of toxin production in cyanobacteria" finanziert. Das bewilligte Projekt trägt den Titel "Tracking of Exposure to clickable Microcystins in Daphnia sp.". Landesrätin Cornelia Hagele (im Foto rechts vorne) und Vizerektor Gregor Weihs (im Foto links vorne) gratulierten den Preisträger:innen bei der Feierlichkeit persönlich. Wir schließen uns der Gratulation sehr herzlich an!
online seit 30.01.2024
Von Wasserflöhen lernen

FG Leiter Markus Möst, Foto: S. Wanzenböck
Projektstudie für Studierende der Universität Innsbruck
Gruppenfoto der Studierenden mit Betreuern und Tutorin, Foto: S. Wanzenböck
Aktuell findet erstmalig ein zweiwöchiger Parallelkurs zum Pflichtmodul "Ökologische Projektstudie" im Masterstudium Ökologie und Biodiverstität am Forschungsinstitut für Limnologie in Mondsee statt. 13 Studierende nehmen an der Lehrveranstaltung teil und werden von den Forschungsgruppenleitern Markus Möst, Rainer Kurmayer und Josef Wanzenböck unterrichtet. In theoretischen und praxisnahen Unterrichtseinheiten lernen die Studierenden zurzeit eine Woche lang Methoden für Experimente und Freilandarbeit kennen und formulieren anschließend eigene Forschungsthemen, die dann im Juli 2024, in einer zweiten Woche der Lehrveranstaltung am Mondsee, umgesetzt und präsentiert werden sollen.
online seit 25.01.2024
Neue Publikation am ILIM (Mitarbeiter:in hervorgehoben)/new publication at ILIM (staff members in bold):
Bierenbroodspot J.M., Darienko T., de Vries S., Fürst-Jansen J.M.R., Buschmann H., Pröschold T., Irisarri I., de Vries J. (2024). Phylogenomic insights into the first multicellular streptophyte. Current biology 34: 1-12, https://doi.org/10.1016/j.cub.2023.12.070
Neben den Landpflanzen beheimatet die Gruppe der Streptophyten auch eine Reihe von Süßwasser- und Landalgen, z.B. die Klebsormidiophyceae, die wichtige Informationen über die Entstehung von Schlüsselmerkmalen der Landpflanzen liefern. Sie gedeihen auf Baumrinden und Felsen aber auch in extremen, terrestrischen Lebensräumen, wie Wüsten oder der Antarktis, und zeigen bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit.
In der vorliegenden Studie wurde eine phylogenomische Analyse durchgeführt um die verschiedenen Gattungen der Klebsormidiophyceae in ein neuartiges System einzuteilen. Die Rekonstruktionen der Vorfahren deuten darauf hin, dass die Klebsormidiophyceae in ihrer Entwicklungsgeschichte mehrmals zwischen terrestrischen und aquatischen Lebensräumen gewechselt haben, wobei die Stamm-Klebsormidiophyceen das Land früher erobert haben als die Landpflanzen. Es werden Beweise geliefert, dass die ersten mehrzelligen Streptophyten wahrscheinlich bereits vor etwa einer Milliarde Jahren lebten.
Die Studie wurde von der Deutschen Forschugnsgemeinschaft (DFG) im Rahmen mehrerer Einzelprojekte, im Prioritäts- Förderprogramm ‘‘MAdLand – Molecular Adaptation to Land: Plant Evolution to Change’’ sowie in Horizon 2020 im ERC-StG ‘‘TerreStriAL’’ gefördert.
online seit 22.01.2024
Kursankündigung SS 2024 am Mondsee
online seit 22.01.2024
PostDoc Position zu besetzen (80-100%, 3 Jahre)
Forschungsbereich: Daphniengemeinschaften im globalen Wandel - öko-evolutionäre Auswirkungen und ihre Folgen
Mehr unter: https://www.uibk.ac.at/limno/jobs/
online seit 18.01.2024
Neue Publikation am ILIM/new publication at ILIM:
Weisse T. (online first). Physiological mortality of planktonic ciliates: Estimates, causes, and consequences. Limnology and Oceanography. doi: 10.1002/lno.12503
Die Bewertung der räumlichen und zeitlichen Variabilität geeigneter Nahrung für Ciliaten (Wimpertierchen) im Meer ist von entscheidender Bedeutung um die Hungersituation von Wimpertierchen auf globaler Ebene einschätzen zu können. Die verfügbaren Daten deuten darauf hin, dass im Meer die physiologische Sterblichkeit für heterotrophe Arten höher ist als der Verlust von Wimpertierchen die durch räuberische Planktonkrebse gefressen werden. In vielen Süßwasserseen ist das Gegenteil der Fall. Die Zystenbildung bei Wimpertierchen ist ein wirksames Merkmal um die hohe Sterblichkeit unter schlechten Bedingungen zu überwinden. Es scheint als hätte die Temperatur dabei keinen Einfluss auf die Mortalitätsrate der Wimpertierchen, im Gegenteil, die spezifischen Wachstumsraten von Ciliaten nehmen mit der Temperatur sogar zu. Um Aussagen zur Hypothese, dass Ciliaten von steigenden Meeres- und Seetemperaturen profitieren könnten, wenn die Temperatur für die Ciliatensterblichkeit keine Rolle spielt, zu bestätigen, sind allerdings noch weitere Untersuchungen erforderlich.
Die Rohdaten sind unter doi:10.5061/dryad.cnp5hqc99 im DRYAD Repositorium verfügbar.
online seit 11.01.2024
Neue Publikationen am ILIM (Mitarbeiter hervorgehoben)/new publications at ILIM (staff member in bold):
Ålund M., Cenzer M., Bierne N., Boughman J.W., Cerca J., Comerford M.S., Culicchi A., Langerhans B., McFarlane S.E., Möst M.H., North H., Qvarnström A., Ravinet M., Svanbäck R., Taylor S.A. (2023). Anthropogenic change and the process of speciation. Cold Spring Harbor Perspectives in Biology, a041455. https://doi.org/10.1101/cshperspect.a041455
Anthropogene Einflüsse können sich sowohl auf die Geographie als auch auf die Selektion auswirken und damit oft parallel und sehr schnell die vorherrschenden Mechanismen der Artbildung verändern. Es wird angenommen, dass es in der Zukunft keine evolutionären Prozesse ohne menschliche Störung geben wird. Daher sind Untersuchungen natürlicher Ökosysteme besonders wertvoll um die Auswirkungen des Menschen überhaupt erkennen und quantifizieren zu können und diese Auswirkungen zu beheben. Die Erhaltung und Wiederherstellung von ganzen Ökosystemen um eine (Re-)Diversifizierung zu fördern, hat größere Chancen für die Verbesserung der biologischen Vielfalt als die Konzentration auf die Erhaltung einzelner Arten.
Govaert L., Hendry A.P., Fattahi F., Möst, M. (2023). Quantifying interspecific and intraspecific diversity effects on ecosystem functioning. Ecology e4199. https://doi.org/10.1002/ecy.4199
Rasche Umweltveränderungen führen zu einem massiven Verlust an biologischer Vielfalt, was sich nachteilig auf das Funktionieren von Ökosystemen auswirkt. Jüngste Studien deuten darauf hin, dass die intraspezifische Vielfalt (innerhalb einer Art) in ähnlichem Maße zum Funktionieren von Ökosystemen beitragen kann wie die interspezifische Vielfalt (zwischen verschiedenen Arten). Um quantitative Einblicke in das Funktionieren von Ökosystemen zu ermöglichen, wurde eine bereits bekannte Methode der interspezifischen Preisaufteilung erweitert um auch die Auswirkungen von intraspezifischen Diversitätsverlusten und -gewinnen auf das Funktionieren von Ökosystemen zu berücksichtigen. Die Anwendung dieser Methode auf sorgfältig konzipierte Experimente wird zusätzliche Erkenntnisse darüber liefern, wie der Verlust der biologischen Vielfalt auf verschiedenen ökologischen Ebenen zum Funktionieren von Ökosystemen beiträgt und diese verändert.
online seit 10.01.2024
Neue Publikation am ILIM (Mitarbeiter hervorgehoben)/new publication at ILIM (staff member in bold):
Potekhin A., Plotnikov A.O., Gogoleva N., Sonntag B. (2024). Editorial: Microbial associations formed and hosted by protists, algae, and fungi. Front. Microbiol. 14:1341058. doi: 10.3389/fmicb.2023.1341058
Für das Forschungsthema "Mikrobielle Assoziationen, die von Protisten, Algen und Pilzen gebildet und beherbergt werden" wurden Artikel gesammelt, die Hinweise liefern, dass die Mikrobiome von Protisten und Algen eine wichtige Rolle in der Biologie ihrer Wirte spielen. Dazu gehören unter anderem die Rolle als Nahrungsquelle für den Wirt, die Bereitstellung von Stoffwechselhilfen und Kompensationen, der Schutz des Wirts und die Aufrechterhaltung der Gemeinschaft. Die Artikel zeigen deutlich die Perspektive für Methoden der Bewirtschaftung des Mikrobioms von Protisten und Algen auf, um die Ernte von Wirten in Labors und biotechnologischen Anlagen zu verbessern.
Die Publikation ist als Open Access Veröffentlichung frei zugänglich und ist die Einleitung für fünf weitere wissenschaftliche Publikationen zum Forschungsthema in dieser Ausgabe der Zeitschrift Frontiers in Microbiology.
online seit 09.01.2024
Obwohl auf drei repräsentative Gattungen beschränkt, ermöglichten phylogenetische Analysen eine Klärung des taxonomischen Charakters und der Positionen von ASVs, die sonst einer einzigen Gattung zugeordnet würden. Generell sollte dieser Ansatz immer dann angewandt werden, wenn Interesse daran besteht, die Taxonomie und die unterschiedliche Verteilung von ASVs in bestimmten Cyanobakterienarten, einschließlich Ökotypen, näher zu untersuchen. Ein aufschlussreiches Beispiel waren die kleinen Picocyanobakterien, die normalerweise in breite funktionelle Gruppen eingeteilt werden, aber in dieser Arbeit in mindestens zwei große Ökotypen unterteilt wurden, die auf pelagische Lebensräume und Seebiofilme beschränkt sind.


Grafischer Abstract der Publication in Marine Drugs
Diese Studie wurde vom Österreichischen Wissenschaftsfonds (FWF) P24070 und P32193 an R. Kurmayer finanziert. E. Entfellner wurde durch das Doktorandenprogramm der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) unterstützt.
online seit 08.01.2024
2023
Frohe Weihnachten und ein erfolgreiches Neues Jahr

Wir freuen uns auf viele, neue Aktivitäten, Kooperationen, Projekte und Ideen, die wir im Jahr 2024 am Forschungsinstitut für Limnologie, Mondsee, umsetzen und hier mit Ihnen teilen können.
online seit 23.12.2023
Langzeitforschung am Mondsee - Netzwerktreffen
Netzwerktreffen am Forschungsinstitut für Limnologie, Mondsee, Foto: S. Wanzenböck
LTER Seite des Standortes Mondsee
Es waren Vetreter:innen folgender Institutionen beim Netzwerktreffen anwesend:
Bundesamt für Wasserwirtschaft - Institut für Gewässerökologie und Fischereiwirtschaft
Amt der OÖ-Landesregierung - Gewässeraufsicht, hydrographischer Dienst
Bundesforschungszentrum für Wald
Tourismusverband Mondsee-Irrsee
Natura 2000 - Technisches Büro blattfisch
Forschungsinstitut für Limnologie, Mondsee, der Universität Innsbruck
online seit 06.12.2023
ADVENT - ADVENT
Besuchen Sie unseren Adventkalender und erfahren Sie mehr über die Arbeit und Forschung am Mondsee.
Wir wünschen viel Spaß!
online seit 01.12.2023
Schüler:innen berichten...


Schüler:innen der Mittelschule Mondsee beim Interview von Hans Rund für den Schulpodcast im Sparkling Science Projekt "Biodiversität der Elritzen",
Foto links: Sabine Wanzenböck. Elritzen, Foto rechts: Sylvia K. Wanzenböck
Weitere Aktivitäten und Details zum Projekt sind unter www.elritzen.at abrufbar.
online seit 24.11.2023
Neue Publikation am ILIM (Mitarbeiterin hervorgehoben)/new publication at ILIM (staff member in bold):
Gogoleva N., Chervyatsova O., Balkin A., Kuzmina L., Shagimardanova E., Kiseleva D., Gogolev Y. (2023). Microbial tapestry of the Shulgan-Tash cave (Southern Ural, Russia): influences of environmental factors on the taxonomic composition of the cave biofilms, Environmental Microbiome 18: 82, https://doi.org/10.1186/s40793-023-00538-1
In dieser Studie wurde die Shulgan-Tash-Höhle im südlichen Ural, ein Höhlenbiotop, das für einzigartige, paläolithische Malereien berühmt ist, hinsichtlich des Bewuchses von Biofilm untersucht. Höhlenbiotope zeichnen sich generell durch stabile niedrige Temperaturen, hohe Feuchtigkeit und einen Mangel an organischen Substraten aus. Trotz dieser Bedingungen dienen sie mikrobiellen Gemeinschaften als Lebensraum. Ziel der Untersuchung war es die Vielfalt, die Verteilung und die möglichen Auswirkungen dieser Biofilme auf die paläolithischen Malereien der Höhle zu untersuchen und gleichzeitig zu erforschen, wie Umweltfaktoren die mikrobiellen Gemeinschaften in der Höhle beeinflussen. Die Forscher:innen konnten feststellen, dass die Artenzusammensetzung dieser Biofilme die Veränderungen der Umweltbedingungen, wie Substratzusammensetzung, Temperatur, Feuchtigkeit, Belüftung und CO2-Gehalt, widerspiegelt. Die intensive Auflösung und Ablagerung von Karbonaten, die durch Actinobakterien verursacht wird, stellt eine potenzielle Gefahr für die Erhaltung der alten Felsmalereien in der Höhle dar.
Die Publikation ist als Open Access frei zugänglich.
online seit 21.11.2023
Veranstaltungstipp: Vortrag in Traunkirchen am 7.12.2023
Was sind invasive Arten? Welche Auswirkungen haben sie auf unser Ökosystem und wie kann man ihrer Ausbreitung entgegenwirken?
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Beitrag in 3sat - Forschung am Mondsee
Algen als Wunderwuzzi
Bei der vom BMK initiierten und von der ÖGUT in Kooperation mit BEST - Bioenergy and Sustainable Technologies GmbH durchgeführten Veranstaltung "Netzwerk Algen" werden jährlich der Stand von Forschung, Entwicklung und Innovation hinsichtlich Algen in Österreich mit Fachleuten diskutiert. 2023 wurden unter dem Thema "Wunderwuzzi Algen: von der Hautcreme bis zur Batterie" wissenschaftliche Fachvorträge aber auch angewandte Beiträge im Wiener ZOOM Kindermuseum präsentiert. Das FFG Talente regional Projekt "geniALGE-Algentechnologie als Zukunftshoffnung" bereicherte auf persönliche Einladung ebenfalls das Programm. Im passenden Rahmen wurde dem Fachpublikum das erfolgreiche Algenprojekt mit einem Kurzvortrag und einem Poster vorgestellt, in dem mehr als 800 Kinder und Jugendliche für Mikroalgen begeistert werden konnten. Schon beim letzten Netzwerk Algen-Treffen im Jahr 2022 konnten zwei Schülerinnen der HBLA Ursprung ihre vorwissenschaftliche Arbeit (VWA), die im Projekt entstanden war, mit einem Poster vorstellen. Das Projekt konnte Ende 2022 abgeschlossen werden. Zwei weitere Schülern der HBLA Ursprung haben die Entwicklung und den Bau eines geniALGE-Algenreaktors in ihren VWAs auch noch nach Abschluss des Projekts zum Inhalt.
online seit 03.11.2023
WIRTUNWAS - Schülerinnen und Schüler aus Mondsee, Wien und Tirol packen bei der Forschung mit an
In der Septemberausgabe der Zeitschrift "Wirtunwas" ist ein Artikel über unser aktuelles Sparkling Science Projekt "Kleine Fische ganz groß - Biodiversität der Elritzen in Österreich" erschienen. Das Naturhistorischen Museum Wien und das Forschungsinstitut für Limnologie in Mondsee sind dabei Projektpartner. Schülerinnen und Schüler der Mittelschule Mondsee sind in das Projekt mit Exkursionen, Laborworkshop, Schulpodcast und anderen Aktivitäten eingebunden.
Zur Septemberausgabe der Zeitschrift
online seit 18.10.2023
Neue Publikation am ILIM (Mitarbeiter hervorgehoben)/new publication at ILIM (staff member in bold):
Melekhin M., Potekhin A., Gentekaki E., Chantangsi C. (2023). Paramecium (Oligohymenophorea, Ciliophora) diversity in Thailand sheds light on the genus biogeography and reveals new phylogenetic lineages, J. Eukaryot. Microbiol. 00:e13004, https://doi.org/10.1111/jeu.13004
Wimpertierchen der Gattung Paramecium sind als Modellorganismen für die Untersuchung der Biogeografie gut geeignet. Die bisher sehr umfangreichen Probenahmen, hauptsächlich in der nördlichen Hemisphäre, haben zu 16 gültigen morphologischen Artbeschreibungen geführt.
In der vorliegenden Studie wurden auch schwer zugängliche Regionen, einschließlich Südostasien, durch kombinierte traditionelle sowie morphologische und molekulare Ansätze untersucht. So konnten neue Informationen zur Biodiversität von Paramecium in Thailand anhand von mehr als 110 Proben aus 10 Provinzen gewonnen werden. Außerdem wurde eine Vielzahl von bakteriellen, zytoplasmatischen Symbionten aus mindestens neun monoklonalen Kulturen von Paramecium dokumentiert.
online seit 18.10.2023
Neue Publikation am ILIM (Mitarbeiter:innen hervorgehoben)/new publication at ILIM (staff members in bold):
Stelzer C.-P., Pichler M., Stadler P. (2023). Genome streamlining and clonal erosion in nutrient-limited environments: a test using genome-size variable populations, Evolution, https://doi.org/10.1093/evolut/qpad144

Chemostatkultur, Foto: S. Wanzenböck, ILIM
In dieser Studie wurden Populationen von Rädertieren (Rotatorien) mit unterschiedlichen Genomgrößen der Selektion in einer Chemostat-Kultur ausgesetzt. Hauptziel war es, die Auswirkungen der genetischen Zusammensetzung der Ausgangspopulation und der Phosphorbeschränkung auf die Intensität der Selektion zu bewerten, die als Rate der klonalen Erosion quantifiziert wird. Auch alle phänotypischen Veränderungen in den entstandenen Populationen, einschließlich der Veränderungen in ihrer GS-Verteilung und jegliche phänotypische Anpassung an die Chemostatbedingungen, wurden berücksichtigt. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Populationen einen schnellen evolutionären Wandel durchliefen, der nur wenige Wochen dauerte und zu besser angepassten Populationen führte.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Genomgröße bei Rädertieren mit kleinem bis mittlerem Genom nur eine begrenzte Auswirkung auf die Klonfitness hat, während sie sich bei Rädertieren mit größerem Genom negativ auf die Wirtsfitness auswirken kann. Die Populationen zeigten auch rasche evolutionäre Veränderungen durch klonale Selektion, was zu einer besseren Anpassung an die neue Umgebung führte. Der Verlust an klonaler Vielfalt im Laufe der Zeit, der als klonale Erosion bezeichnet wird, wurde weitgehend durch die genetische Ausgangszusammensetzung der Population bestimmt. Insgesamt wirft diese Forschung ein neues Licht auf die Evolution der Genomgröße und bietet einen neuen Rahmen für das Verständnis des Zusammenspiels zwischen nukleotypischen und genotypischen Faktoren in diesem Prozess.
Die Finanzierung dieser Studie wurde vom FWF im Rahmen zweier Forschungsprojekte gefördert.
online seit 10.10.2023
Brand aus am Forschungsinstitut für Limnologie, Mondsee

Die Verwendung des Feuerlöschers wurde praktisch geübt, Foto: S. Wanzenböck, ILIM
Am 9.10.2023 bekamen die Mitarbeiter: innen des Forschungsinstituts Nachhilfe in Sachen Feuerbekämpfung. Die Verwendung einer Löschdecke und die Nutzung verschiedener Feuerlöschertypen wurden geübt. In der Hoffnung, dass dieses Wissen nie zum Einsatz kommen wird, vermittelt es den Mitarbeiter:innen ein Gefühl der Sicherheit zu wissen, was bei einem Brand zu tun ist und welche Hilfsmittel wann verwendet werden sollen. Was viele nicht wussten: Diese Maßnahme ist laut ArbeitnehmerInnenschutzgesetz gesetzlich vorgeschrieben.
online seit 10.10.2023
Neue Publiation am ILIM/new publication at ILIM:
Dokulil M.T., Teubner K. (2023). Long-term adjustment of phytoplankton structure to environmental traits at timescales during lifetime development and over generations. Hydrobiologia https://doi.org/10.1007/s10750-023-05365-6

Probenahme mit dem Planktonnetz am Mondsee, Foto: ILIM
Über mehr als 60 Jahre wurden ökologische Daten zum Phytoplankton des Mondsees erhoben. Die Autoren stellen fest, dass Phytoplanktongruppen mit unterschiedlichen phänologischen Eigenschaften gut geeignet sind, um die Auswirkungen der beiden Umweltstressoren Nährstoffüberschuss durch Eutrophierung von 1968 bis 1998 und die Erwärmung durch den Klimawandel nachzuweisen. In der vorliegenden Publikation lag der Fokus auf dem Biovolumen, der Artengemeinschaft, den Nettoveränderungsraten und der Biodiversität des Phytoplanktons im Mondsee.
Schlüsselarten, wie die Cyanobakterie Planktothrix rubescens werden als omnipotente Akteure in Phytoplanktongemeinschaften angesehen, weil sie unter verschiedenen Umweltbedingungen langfristig auftreten können und daher für die ökologische Langzeitforschung von großer Bedeutung sind. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Phytoplanktonarten ausgezeichnete Organismen sind, um die Auswirkungen von Umwelteinflüssen aufgrund ihrer kurzen Generationszeit, ihrer lebenslangen Anpassung und des Vorkommens im Langzeitverlauf über Generationen zu erheben.
Dieser Artikel ist als Open Access Publikation erschienen.
online seit 20.09.2023
Neue Publikation am ILIM/new publication at ILIM:
Carrea L., Merchant C.J., Creatux J.-F., Dokulil T.M., Dugan H.A., Gibbes B., Laas A., Leibensberger E.M., Maberly S., May L., Matsuzaki S.-I., Monet G., Pierson D., Pulkkanen M., Rusanovskaya O.O., Shimaraeva S.V., Silow E.A., Schmid M., Timofeyev M.A., Verburg P., Woolway R.I. (2023). Lake surface water temperature, S28-S30 in: Special Supplement to the Bulletin of the American Meteorological Society 104(9) https://doi.org/10.1175/2023BAMSStateoftheClimate.1
Das vorliegende Kapitel über die Seeoberflächentemperaturen, in dem auch Daten aus dem Mondsee einfließen, wurde in der bereits 33. Ausgabe der jährlichen Bewertung, die seit 1996 im Bulletin of the American Meteorological Society veröffentlicht wird und jetzt als State of the Climate bekannt ist, veröffentlicht. Der Bericht wird der von den Nationalen Zentren für Umweltinformationen (NOAA) erstellte und basiert auf Beiträgen von Wissenschaftler:innen aus der ganzen Welt. Er bietet einen detaillierten Überblick über globale Klimaindikatoren, bemerkenswerte Wetterereignisse und andere Daten, die von Umweltüberwachungsstationen und -instrumenten auf dem Land, im Wasser, im Eis und im Weltraum gesammelt wurden. Als Ergänzung zum Bulletin, dient er in erster Linie dazu, den Zustand und die Entwicklung vieler Komponenten des Klimasystems zu dokumentieren. Der Bericht dokumentiert jedoch auch den Status und die Entwicklung der eingesetzten Kapazitäten und des weltweiten Engagements um das Klimasystem zu beobachten.
online seit 18.09.2023
Masterstudium abgeschlossen

Josef Wanzenböck, Aylin Olgun, Dunja Lamatsch und Claus-Peter Stelzer bei der Gratulation (v.l.n.r.), Foto. S. Wanzenböck, ILIM
Heute, 15.09.2023, hat Aylin Olgun ihre Verteidigung der Masterarbeit "Population-genetic structure of Austrian Carassius spp. populations and their artificially bred F1 and F2 offspring" erfolgreich abgeschlossen. Sie wurde dabei von Dunja Lamatsch und Josef Wanzenböck am Forschungsinstitut für Limnologie in Mondsee betreut und geprüft. Als Vorsitzender der Verteidigung fungierte Claus-Peter Stelzer.
Aylin Olgun hat in ihrer Masterarbeit vor allem den Giebel, eine der invasivsten Fischarten, aber auch die einheimische Karausche untersucht. Dabei konnte sie teilweise auf Wildfänge als auch auf Fische, die schon in den hauseigenen Aquarienräumen zu Untersuchungszwecken gehalten worden waren, zurückgreifen. Interessant ist die Fähigkeit des Giebels sich sowohl sexuell, als auch asexuell fortzupflanzen. Das Giebelweibchen nutzt dabei das Sperma von Männchen der gleichen Familie nur zur Anregung der Eizelle zur Teilung. Das genetische Material der artfremden Männchen wird aber nicht verwendet. Das Giebelweibchen bringt in der Folge Klone zur Welt, die sich auch wieder ungeschlechtlich oder geschlechtlich fortpflanzen können. Diese Strategie ermöglicht die enorm rasche Ausbreitung der Art und die Gefährdung der ursprünglich im gleichen Lebensraum vorkommenden Karausche.
Aylin Olgun hat verschiedene Giebelpopulationen aus ganz Österreich untersucht und festgestellt, dass Hybride zwischen Giebel und Karausche nur dann fertil waren, sich also wieder fortpflanzen konnten, wenn das Weibchen der Giebel und das Männchen die Karausche war. Bei anderen Kombinationen der Eltern konnten sich die Jungen nicht mehr reproduzieren.
Aus ihren Ergebnissen konnte sie auch eine 2n-Population (mit diploidem Chromosomensatz) aus dem Neusiedlersee als möglicherweise während der Eiszeit isolierte Population identifizieren. Die anderen untersuchten Populationen aus Österreich waren entweder triploid oder tetraploid. Als Analysemethoden hat sie Mikrosatelliten und die Flowzytometrie verwendet.
Wir gratulieren Aylin zum erfolgreichen Abschluss ihrer interessanten Arbeit, die weitere Forschungsfragen aufwirft.
online seit 15.09.2023
Neue Publikation am ILIM (MitarbeiterInnen hervorgehoben)/new publication at ILIM (staff members in bold):
Purker, M., Dobrovolny S. , Kreuml M. , Hufnagl P. , Indra A. , Kurmayer R. (2023). Quantitative relationships among high-throughput sequencing, cyanobacteria toxigenic genotype abundance and microcystin occurrence in bathing waters, Science of The Total Environment 901:165934 https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.165934
Toxinproduzierende Cyanobakterien (Blaualgen) in Badegewässern können eine erhebliche Bedrohung für die Gesundheit von Mensch und Tier darstellen. Um die öffentliche Gesundheit besser zu schützen und die Gesundheitsrisiken während der Badesaison zu verringern, ist eine wirksame Überwachungs- und Bewirtschaftungsstrategie erforderlich. In der vorliegenden Studie wurden molekulare Instrumente zur Überwachung giftbildender Cyanobakterien bewertet um eine Frühwarn-Überwachungsstrategie für Badegewässer in der EU einzurichten. Weiters soll das toxische Potenzial von Cyanobakterien mit dem tatsächlichen Vorkommen und der Konzentration von Microcystin (kleine Eiweißstoffe, die enzymhemmende Eigenschaften aufweisen und eine toxische Wirkung haben) verglichen werden. Zu diesem Zweck wurden 16 Badegewässerstandorte gemäß der Badegewässerrichtlinie (BWD) der Europäischen Kommission überwacht.
Für die Analysen kamen zwei Methoden zum Einsatz:
Die Hochdurchsatz-Sequenzierung (HTS), die die parallele Sequenzierung von mehreren DNA-Abschnitten in einem Durchgang ermöglicht und die quantitative oder Echtzeit PCR, bei der fluoreszierende Moleküle verwendet werden, die sich an die DNA binden. Die Fluoreszenz der Probe steigt proportional zur Anzahl der DNA-Moleküle an.
Durch die Kombination der beiden Methoden wurde Microcystin am zuverlässigsten vorhergesagt. Daher wird der Einsatz von HTS- und qPCR-Techniken in Kombination mit der Überwachung von Standard-Umweltparametern HTS- und qPCR-Techniken als äußerst nützlich angesehen, um die rechtzeitige Erkennung von Gesundheitsrisiken für realen Nutzern zu gewährleisten, wie dies von der BWD gefordert wird.
Die Arbeit wurde von der Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES), Mitteln aus dem EU-Interreg Alpine Space Projekt "Eco-AlpsWater" und Fördermitteln aus dem FWF Projekt SLOT finanziert.
online seit 10.08.2023
Neue Publikation am ILIM (MitarbeiterInnen hervorgehoben)/new publication at ILIM (staff members in bold):
Pitt A., Hahn M. (2023). Wissen schaffen mit Citizen Scientists: Biodiversität und Ökologie von Süßwasserbakterien. Biologie in unserer Zeit, 53(3): 272–279. https://doi.org/10.11576/biuz-6525

Abbildung aus der Publikation
Die Einbindung von Citizen Scientists in wissenschaftliche Forschung wird in dieser Veröffentlichung anhand zweier Sparkling Science Projekte erläutert. Schülerinnen und Schüler unterstütz(t)en Mondseer Forschende aus dem Bereich Umweltmikrobiologie bei der Suche und Bestimmung von Süßwasserbakterien und waren bereits in die Namenssuche neu gefundener Arten eingebunden. Neben der Vermittlung der Bedeutung von Süßwasserbakterien für Gewässerökosysteme, konnten in diesen Projekten bereits zahlreiche wissenschaftliche Publikationen dem immer höheren Anspruch von Citizen Science Projekten gerecht werden. Damit profitieren sowohl die beteiligten Wissenschafterinnen und Wissenschafter als auch die Cititzen Scientists von der Zusammenarbeit.
Die Publikation wurde vom BMBWF gefördert und ist online frei zugänglich.
online seit 09.08.2023
Bundespräsident Alexander van der Bellen besuchte Forschungsinstitut für Limnologie in Mondsee
Dekan Paul Illmer, Doris Schmidauer, Bundespräsident Alexander van der Bellen,
Institutsleiter Otto Seppälä, Foto: Sabine Wanzenböck
Fotogalerie zum Besuch ILIM, Fotos: S. Wanzenböck
Fotogalerie zum Besuch offiziell, Fotos: P. Lechner/HBF
Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am 28.07.2023 das Forschungsinstitut für Limnologie der Universität Innsbruck in Mondsee (OÖ) besucht. Dabei führte er u.a. Gespräche mit Forscher:innen zu Auswirkungen der Klimakrise auf Österreichs Seen. Acht Forschungsgruppen widmen sich am Institut in Mondsee der Erforschung von See-Ökosystemen und der Evolution von Organismen in einer sich ändernden Umwelt. Der Bundespräsident hat sich von den Forscher:innen am Mondsee u.a. über die Auswirkungen der Klimakrise auf Österreichs Seen informieren lassen. „Mit ihren Forschungsergebnissen und ihren Erkenntnissen zur Auswirkung der Klimakrise, leisten das Institut und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen wichtigen Beitrag zum Schutz von Österreichs Gewässern. Damit wir unsere Seen auch für kommende Generationen erhalten und gesund halten können“, betonte der Bundespräsident.
Wie passen sich Seebewohner an klimatische Veränderungen sowie zunehmende menschliche Eingriffe an und welche Auswirkungen hat das auf Ökosysteme? Unter anderem diesen Fragen gehen die Mitarbeiter:innen des Instituts unter der Leitung von Otto E. Seppälä in ihrer evolutionsökologischen Forschung nach. Sie gaben Van der Bellen Einblick in ihre Arbeit: Mit Hilfe von Bakterien, Planktonorganismen, Algen, Schnecken, Fischen, etc. werden am Mondsee Muster und Prozesse ökologischer und evolutionsbiologischer Relevanz untersucht. Die Auswertung von Langzeitdaten zur Limnologie im Mondsee und weiteren Seen in verschiedenen Höhenlagen sollen ein vollständiges Bild der Ökologie der heimischen Seen ergeben – wichtige Erkenntnisse für die Grundlagenforschung, die aber auch für den Schutz der heimischen Gewässer und das Gewässermanagement von Bedeutung sind. Die Universität Innsbruck war beim Besuch auch durch Paul Illmer, den Dekan der Fakultät für Biologie, vertreten.
In einem Übersichtsvortrag stellte Dekan Paul Illmer die Fakultät für Biologie der Universität Innsbruck vor. Während einer Fahrt mit dem Forschungsboot auf dem Mondsee präsentierten Wissenschafter:innen des Instituts Freilandmethoden und Daten zur aktuellen Situation des Mondsees. An fünf Stationen vermittelten Studierende aus verschiedenen Forschungsgruppen des Instituts Methoden und eigene Ergebnisse zu den Themen UmweltDNA-Analyse zur Bestimmung von Fischarten, Pigmente von Cyanobakterien/Blaualgen und ihre Nutzung bei Gewässeruntersuchungen, Biodiversität von Ciliaten/Wimpertierchen und ihre Nutzung als Bioindikatoren, Problematik der invasiven Arten am Beispiel der Fischart Giebel.
online seit 28.07.2023
Internationaler Workshop zur Ökologie von Ciliaten am Mondsee
NGTax-Gruppenbild, Foto: V. Trifinov
Im Rahmen des EU Projekts Next Generation Taxonomy: Ciliophora and their bacterial symbionts as a proof of concept (NGTax) - EU - Horizon 2020 Marie Curie Actions fand zwischen 17. und 21. Juli 2023 der Ciliate Ecology Workshop - Next Generation Taxonomy am Forschungsinstitut für Limnologie, Mondsee, statt. In Vorträgen und Freiland- sowie Laborworkshops wurden die internationalen Teilnehmer:innen von der Forschungsgruppenleiterin Bettina Sonntag und ihrem internationalen Team betreut.
Im Programm wurden Themen wie die Biodiversität und Ökologie der Ciliaten im Seeplankton und Biofilm, die Diversität, Bestimmung und Kultivierung von Algen- und Bakterienendosymbionten, sowie die Funktion von Ciliaten als Bioindikatoren für die Bestimmung der Wasserqualität behandelt.
Tagung der Europäischen und Internationalen Gesellschaften für Protistologie
Der Workshop in Mondsee fand im Anschluss an die Internationale und Europäische Tagung für Protozoologie (ECOP-ISOP) in Wien statt, bei der Mitarbeiter:innen des Forschungsinstituts für Limnologie, Mondsee, im Organisationsteam mitarbeiteten und Wissenschafter:innen aus Mondsee zahlreiche, wissenschaftliche Beiträge präsentierten. Der Kongress der Europäischen Gesellschaften ist die wichtigste Veranstaltung der Federation of European Protistological Societies (FEPS), die alle vier Jahre stattfindet. Die Tagung wurde von der Fakultät für Biologie der Universität Innsbruck finanziell unterstützt.
ECOP-ISOP Gruppenbild Wien, Foto: S. Wickham
online seit 24.07.2023
Puzzlestück zur Geburtenkontrolle bei invasiver Fischart entdeckt

Moskitofischweibchen, Foto: M. Pichler
Einem internationalen Forschungsteam unter der Leitung von Dunja Lamatsch vom Forschungsinstitut für Limnologie, Mondsee, der Universität Innsbruck ist es gelungen, das W-Geschlechtschromosom des weiblichen Moskitofischs auf molekularer Ebene zu entschlüsseln. Damit könnte in Zukunft die Ausbreitung dieser äußerst invasiven Fische gebremst werden. Mehr im Newsroom der Universität Innsbruck unter https://www.uibk.ac.at/de/newsroom/2023/puzzlestuck-zur-geburtenkontrolle-bei-invasiver-fischart-entdeck/
online seit 12.07.2023
Neue Publikation am ILIM (Mitarbeiter:innen hervorgehoben)/new publication at ILIM (staff members in bold):
Schirpke U., Ebner M., Fontana V., Enigl K., Ohndorf M., Pritsch H., Kurmayer R. (2023). Climate response of alpine lakes and impacts on ecosystem services, Landscape Online 98: 1109, doi:10.3097/LO.2023.1109  . https://landscape-online.org/index.php/lo/article/view/LO.2023.1109
. https://landscape-online.org/index.php/lo/article/view/LO.2023.1109
Globale Erwärmung und menschlicher Einfluss sind Faktoren, die die ökologische Integrität kleiner Alpenseen stark beeinflussen können. Im interdisziplinären Projekt CLAIMES (CLimate response of AlpIne lakes: resistance variability and Management consequences for Ecosystem Services) wurden neben den limnologischen Daten und der Modellierung der Oberflächentemperatur auch die potentiellen Auswirkungen auf die damit verbundenen Ökosystemleistungen an 15 Seen in den Niederen Tauern (Österreich) und Südtirol (Italien) untersucht. Die priorisierten Ökosystemleistungen wurden anhand mehrerer Indikatoren quantifiziert, und die potenziellen künftigen Auswirkungen wurden auf der Grundlage verschiedener möglicher Worst-Case-Szenarien bewertet.
Unsere Ergebnisse zeigen, dass die globale Erwärmung die die Dauer der Eisbedeckung verringert, was sich auf die Ökosystemfunktionen und folglich auf den trophischen Zustand auswirken wird. Die Ergebnisse zeigen auch, dass die Bereitstellung von Ökosystemleistungen durch Seen weitgehend von den lokalen sozio-ökologischen Merkmalen beeinflusst wird. Der prognostizierte Rückgang der Ökosystemleistungen in der Zukunft erfordert eine bessere Integration der Ökosystemleistungen alpiner Seen in die Entscheidungs- und Politikgestaltung auf verschiedenen Verwaltungsebenen.
online seit 07.07.2023
Neue Publikation am ILIM (Mitarbeiter hervorgehoben)/new publication at ILIM (staff member in bold):
Seppälä O., Schlegel T. (2023). Substrate specificity of phenoloxidase-like activity in an ecoimmunological model species Lymnaea stagnalis, Journal of Molluscan Studies 89(1): eyad005, https://doi.org/10.1093/mollus/eyad005
Um die Stärke der Immunfunktion von Schnecken gegenüber verschiedenen Umweltfaktoren, wie z.B. Temperaturveränderungen oder chemischen Verschmutzungen in Gewässern abschätzen zu können, wird in der Forschung die Aktivität von Phenoloxydase-Enzymen (PO) in der Hämolymphe untersucht. In der vorliegenden Studie wurden diese Enzyme und deren Stärke der oxidativen Reaktionen bei der Spitzschlammschnecke Lymnaea stagnalis, einer in Österreich verbreiteten, heimischen Süßwasserschnecke, analysiert. Wirbellose Tiere (und damit auch Schnecken) verfügen über drei PO-Aktivitäten, aber ihre relative Rolle bei oxidativen Reaktionen ist in der Regel unbekannt. Dies liegt daran, dass die PO-Aktivität meist mit L-Dopa (o-Diphenol, das von allen PO-Enzymen oxidiert wird) als Substrat quantifiziert wird. Das Verständnis der relativen Bedeutung der verschiedenen PO-Enzyme könnte jedoch von großem Nutzen sein. Die Ergebnisse der Studie regen dazu an, die Rolle der verschiedenen PO-Enzyme bei der Bestimmung der PO-Aktivität bei verschiedenen ökologisch-immunologischen Modellarten zu untersuchen, um die Forschung durch verbesserte PO-Tests zu stärken.
online seit 07.07.2023
Neue Publikation am ILIM (MitarbeiterInnen hervorgehoben)/new publication at ILIM (staff member in bold):
Fokin S.I., Lebedeva N.A., Potekhin A., Gammuto L., Petroni G., Serra V. (2023). Holospora-like bacteria “Candidatus Gortzia yakutica” and Preeria caryophila: Ultrastructure, promiscuity, and biogeography of the symbionts. European Journal of Protistology 90: 125998, https://doi.org/10.1016/j.ejop.2023.125998
Es ist bekannt, dass Bakterien der Familie Holospora im Zellkern von Wimpertierchen der Gattung Paramecium leben können. Diese Bakterien müssen als Parasiten betrachtet werden, auch wenn die Wimpertierchen durch den erfolgten Stress nach dem Befall besser gegen negative Umweltweinflüsse wie erhöhte Salinität oder Temperaturanstieg gewappnet sind. In der vorliegenden Studie konnten zwei Holospora-ähnliche Bakterienarten "Candidatus Gortzia yakutica" in den neuen Wirten Paramecium nephridiatum bzw. Paramecium polycaryum gefunden werden. Die bisherige Annahme der Wirtsspezifität der Bakterienarten muss damit kritisch betrachtet werden und wird unter biogeographischen und ökologischen Gesichtspunkten diskutiert.
online seit 26.06.2023
Neue Publikation am ILIM (Mitarbeiter hervorgehoben)/new publication at ILIM (staff members in bold):
Pritsch H., Schirpke U., Jersabek C.D., Kurmayer R. (2023). Plankton community composition in mountain lakes and consequences for ecosystem services, Ecological Indicators 154: 110532, https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2023.110532
Bergseen bieten eine Vielzahl von Ökosystemleistungen (ES) wie Wasser, Lebensraum, Erholung und ästhetische Werte. Durch unterschiedliche Einflüsse geraten diese Seen immer mehr unter Druck. Die Entwicklung geeigneter Indikatoren zur Überwachung von Veränderungen der ES soll bei der Planung gezielter Schutzmaßnahmen helfen. Als Grundlage dafür sind auch limnologische Daten erforderlich. In dieser Studie wurde, neben den weit verbreitete Standardparametern, die genetische Untersuchung des Phytoplanktons mittels Metabarcoding auf der Grundlage von 16S/18S rDNA-Hochdurchsatzsequenzierung (HTS) verwendet. Die Ergebnisse der Untersuchung deuten darauf hin, dass eine Verschlechterung der ökologischen Bedingungen in Bergseen die künftige Bereitstellung von ES negativ beeinflussen könnte. Daher wird es immer wichtiger, unberührte Seen zu schützen, wobei Daten über die Zusammensetzung der Planktongemeinschaft nützliche Anhaltspunkte für die Entscheidung liefern können, welche Seen vorrangig durch geeignete Maßnahmen geschützt werden sollten.
Die Publikation entstand im Earth System Sciences (ESS 2018) Programm "Water in Mountains", Projekt CLAIMES (Climate response of alpine lakes: resistance variability and management consequences for ecosystem services): https://www.uibk.ac.at/projects/claimes/ finanziert durch das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung durch die Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW) und ist Teil der Doktorarbeit von Hanna Pritsch am Forschungsinstitut für Limnologie, Mondsee, der Universität Innsbruck (Betreuung: R. Kurmayer).
online seit 23.06.2023
Schulpodcast zum Sparkling Science Projekt "Biodiversität der Elritzen" und Freilandexpedition mit der Mittelschule Mondsee
Interview von Hans Rund für den Schulpodcast im Sparkling Science Projekt (links), Uferzugnetzfang mit den Schüler:innen am Mondsee (rechts), Fotos: S. Wanzenböck
Im Projekt "Kleine Fische ganz groß - Biodiversität der Elritzen in Österreich", das im Rahmen von Sparkling Science gefördert wird, arbeiten Wissenschafter:innen des Naturhistorischen Museums Wien und des Forschungsinstituts für Limnologie, Mondsee, gemeinsam mit Schulen in Wien, Schladming, Mondsee und Innsbruck zusammen. Die Mittelschule Mondsee hat zum Projekt den ersten Schul-Podcastbeitrag erstellt, der nun unter #6 "Kleine Fische ganz groß - Biodiversität der Elritzen Österreichs" (Citizen Science Project) - Schooltalk der Mittelschule Mondsee | Podcast on Spotify abrufbar ist. Darin erklären die Projektmitarbeiter Hans Rund und Sabine Wanzenböck, die Grundlagen des Projekts, die Vorteile für Wissenschaft und Schulen, sowie die geplanten Aktivitäten. Zurzeit arbeiten die Schüler:innen der Mittelschule Mondsee bereits am zweiten Podcastbeitrag zum Projekt.
Die erste Freilandbeprobung im Rahmen des Projekts fand am 22.06.2023 mit der ersten Klasse der Mittelschule Mondsee statt.
Nach mehreren theoretischen Teilen ging es nun ins Freiland. Ausgerüstet mit Kanister, Handschuhen und Uferzugnetz, nahmen die Schüler:innen unter Anleitung der Projektmitarbeiter vom Forschungsinstitut für Limnologie, Mondsee, Proben am Zellerbach, der Fuschler Ache und am Mondsee. Ziel der Aktion war es festzustellen, ob in den Wasserproben die Erbsubstanz (DNA) einer gefährdeten Kleinfischart, der Elritze, zu finden ist. Akribisch wurden von den Kindern Protokollblätter mit wichtigen Daten an den Probestandorten ausgefüllt. Dabei lernten die Schüler:innen limnologische Arbeitsmethoden im Freiland kennen. Biotische und abiotische Parameter wurden mit einer Sonde gemessen und als Höhepunkt kam das Uferzugnetz zum Einsatz. Dadurch konnten die Schüler:innen erstmals Elritzen in ihrem Lebensraum kennenlernen. Im Labor wurden die Wasserproben gemeinsam durch Spezialfilter filtriert und für die DNA-Analyse vorbereitet. Wir sind schon auf die Ergebnisse gespannt!
online seit 23.06.2023
Helfen Sie mit – Auf der Suche nach der Spitzschlammschnecke!

Spitzschlammschnecken (Lymnaea stagnalis), Foto: O. Seppälä
Sie haben einen Gartenteich, Sie bewegen sich gerne in der Natur und wollen sich bei einem Forschungsprojekt beteiligen? Dann helfen Sie uns bei der Suche nach einer einheimischen Süßwasserschneckenart, der Spitzschlammschnecke (Lymnaea stagnalis), die ausschließlich im Wasser lebt!
Die Spitzschlammschnecke wird von Parasiten infiziert, die für den Menschen ungefährlich sind. Wir wollen in unserer Forschung herausfinden, wie sich sommerliche Hitzewellen auf die Schnecken und ihre Parasiten auswirken.
Wir haben dazu einen Fragebogen entwickelt und ersuchen Sie um Ihre Unterstützung zur Sammlung von wichtigen Daten für die Forschung in Österreich und im Raum Bayern. Dazu sollen die Schnecken NICHT aus dem Gewässer entnommen werden! Bitte füllen Sie den Erhebungsbogen aus und senden ihn mit Fotografien der Fundstelle an: snailpop2023@gmail.com
Vielen Dank für Ihre Unterstützung bei der Erhebung von Forschungsdaten!
online seit 20.06.2023
Girls´ Academy - Workshops zum Einblick in MINT Berufe


Im Genetikworkshop wurde die Erbsubstanz extrahiert (links) und im Mikroskopierworkshop konnten die Schülerinnen die
mikroskopische Biodiversität im See kennenlernen (rechts), Fotos: Sabine Wanzenböck
Die Geschlechterausgewogenheit in Mathematik-Informatik-Naturwissenschaften-Technik (= MINT) Berufen lässt immer noch zu wünschen übrig. Daher soll mit dem Projekt "MI(N)Tgestalten" eine "Community of Practice" für mehr Frauen in MINT-Berufen im Salzkammergut aufgebaut werden. Am 14.06.2023 wurden Schülerinnen des BG Schloss Traunsee zum Girls´ Academy-Workshop "Faszination Wasser – Lebensraum für Artenvielfalt und Forschungsobjekt" eingeladen. Dunja Lamatsch und Bettina Sonntag, beide Forschungsgrippenleiterinnen am Forschungsinstitut für Limnologie, Mondsee, gaben an der Schule Einblick in die Gewässer- und Evolutionsforschung. Sabine Wanzenböck informierte über die dazu erforderliche Ausbildung und gab Infos zu Praktikumsmöglichkeiten am Forschungsinstitut in Mondsee. Dieser Workshop ist nur einer einer ganzen Reihe, die im Rahmen der Girls´ Academy in Kooperation mit der Internationalen Akademie Traunkirchen organisierten werden.


Die beiden Forschungsgruppenleiterinnen Dunja Lamatsch und Bettina Sonntag
bei der Girls´ Academy in Altmünster, Fotos: Sabine Wanzenböck
online seit 16.06.2023
Postdoc Position: UInnsbruck.HeatwaveAdaptation
A postdoc position is available in the group of Aquatic Evolutionary Ecology at the University of Innsbruck (Research Department for Limnology, Mondsee), Austria.
In this position, you can experimentally examine the evolutionary ecology of the responses of the freshwater snail Lymnaea stagnalis to changing environmental conditions under climate change.
The specific goals are to evaluate
(1) if natural snail populations are adapted to local temperature conditions that they experience, and
(2) if and how much evolutionary potential exists in their heatwave responses.
The project is linked to other work in the research group focusing on natural selection on and quantitative genetics of heatwave responses of L. stagnalis.
General information about the research group and the institute can be found at https://www.uibk.ac.at/limno/
The Research Department for Limnology is located on the edge of the Alps in the small town of Mondsee (Upper Austria). The nearest city is Salzburg, which offers history, culture and entertainment at a convenient distance from Mondsee.
We invite highly motivated persons with a strong background in evolutionary ecology and experimental research to apply for this position. A PhD degree is required. Earlier experience with the study system is not necessary.
The project is funded by the Austrian Science Fund (FWF) for a maximum of 27 months depending on the starting date. The salary is based on the personnel cost rates of the FWF https://www.fwf.ac.at/en/research-funding/personnel-costs
Start of the project: as soon as possible.
Qualified persons are invited to apply by email. Please attach a single PDF file including a letter of motivation, CV, a research statement (max 2 pages), and names plus contact information of two references to otto.seppaelae@uibk.ac.at. The subject line should read “postdoc 2023”. Evaluation of the applications starts June 16, 2023. Only complete applications are considered. Top candidates will be interviewed.
Prof. Otto Seppälä
online seit 6. Juni 6, 2023
Neue Publikation am ILIM/new publication at ILIM:
Dokulil, M.T. (2023). Die Lunzer Seen – ein wissenschaftlich-historischer Exkurs. Hommage an Prof. Dr. Franz Berger. The Lakes near Lunz, Austria – a science-historic perspective. Homage to Prof. Dr. Franz Berger, Acta ZooBot Austria 159: 229-271.

Abbruch der Biologischen Station in Lunz am See 2010, Foto: S. Wanzenböck
Mit dieser umfangreichen Arbeit präsentiert Martin Dokulil mehr als ein Jahrhundert Forschung an der Biologischen Station
Lunz am See seit 1900. Die Biologische Station in Lunz war, bis 2003, wie auch das Institut für Limnologie in Mondsee, eine Abteilung an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Das Gebäude der Biologischen Station in Lunz wurde 2010 großteils entfernt und neu adaptiert. Seit 2011 wird das neue Gebäude dort vom WasserCluster Lunz genutzt, an dem die limnologische Forschung am Lunzer See fortgeführt wird.
Martin Dokulil hat in dieser Veröffentlichung bisher unbekannte Daten aus dem wissenschaftlichen Nachlass des legendären Limnochemikers Prof. Dr. Franz Berger mit veröffentlichten Ergebnissen kombiniert und bekannte, aber verstreute Daten zusammengeführt, verglichen und neu interpretiert. Auch Doktorarbeiten und weniger bekannte Veröffentlichungen wurden in die Publikation eingebunden. Mit einem Resümee der historischen Abläufe gibt er einen Hinweis auf künftige Forschungsfragen.
online seit 05.06.2023
Machen Sie beim Citizen Science Projekt Aquirufa mit!


Standorte des Projekt Aquirufa in der Weitwörther Au (links) und am Mondsee (rechts), Fotos: A. Pitt
Am Forschungsinstitut in Mondsee (16.06.2023, 14:00 Uhr) sowie in der Auenwerkstatt in der Weitwörther Au (23.06.2023, 14:00 Uhr) werden im Sparkling Science Projekt Aquirufa: Biodiversität und Ökologie von Süßwasserbakterien (www.sparklingbacteria.com) Workshops für interessierte Bürger/innen stattfinden.
Wir werden gemeinsam (in Mondsee mit dem Boot) Wasserproben nehmen, Messungen durchführen und mit den Proben wie in einem mikrobiologischen Labor arbeiten. Die Teilnehmer/innen erhalten einen Einblick in das wissenschaftliche Arbeiten mit Gewässerbakterien und werden selbst als Citizen Scientists aktiv. Das ist gar nicht schwer, es sind keine Vorkenntnisse nötig und ab ca. 15 Jahren geeignet. Kinder ab ca. 12 Jahren können auch gerne mit einem Erwachsenen gemeinsam teilnehmen. Wer mag, kann nach vorheriger Absprache auch eine Probe aus einem Gewässer (z.B. Gartenteich) mitbringen.
Information und Anmeldung: Alexandra.Pitt@uibk.ac.at
online seit 30.05.2023
Energy Globe Auszeichnung für Algenprojekt am Mondsee
Verleihung der Auszeichnung für das Projekt geniALGE durch LR Kaineder an das Projekt geniALGE, Foto: Mathias Lauringer (links)
Die Urkunde und die Energy Globe Medaille wurden von Projektleiterin S. Wanzenböck und Projektkoordinatorin M. Ellmauer übernommen,
Foto rechts: Wirtschaftslandesrat M. Achleitner und Landesrat S. Kaineder mit den Projektverantwortlichen
Die Freude war groß: Projektleiterin S. Wanzenböck vom Forschungsinstitut für Limnologie, Mondsee, der Universität Innsbruck konnte für das FFG Talente regional Projekt geniALGE einen Energy Globe Award Preis in der Kategorie Jugend entgegennehmen. Gemeinsam mit Projektkoordinatorin M. Ellmauer vom Technologiezentrum Mondseeland fand die Preisverleihung am 24.05.2023 im ORF Landesstudio OÖ in Linz vor zahlreichen Gästen statt. Danke an alle, die beim Projekt mitgewirkt und uns unterstützt haben, ihnen allen sei dieser Preis gewidmet.
online seit 25.05.2023
Innsbrucker Schule im Rahmen eines Sparkling Science Projekts
zu Besuch am Mondsee
Fotos: S. Wanzenböck, V. Razumov
Interview für den Schulpodcast der MS Mondsee, Foto: S. Wanzenböck
Neue Publikation am ILIM (MitarbeiterInnenhervorgehoben)/new publication at ILIM (staff members in bold):
Müller S., Du K., Guiguen Y., Pichler M., Nakagawa S., Stöck M., Schartl M., Lamatsch D.K. (2023). Massive expansion of sex–specific SNPs, transposon related elements, and neocentromere formation shape the young W-chromosome from the mosquitofish Gambusia affinis. BMC BIOLOGY 21: 109, https://doi.org/10.1186/s12915-023-01607-0

Gambusia Weibchen, Foto: M. Pichler
In dieser Studie wurden neue Erkenntnisse über die genomische Organisation und Differenzierung von evolutionär jungen Geschlechtschromosomen bei Fischen untersucht und eine solide Grundlage für die weitere Erforschung der funktionellen Bedeutung dieses evolutionären Prozesses geschaffen.
online seit 16.05.2023
Geniale Algen - Kooperationsprojekt bekommt mit Ihrer Hilfe den Energy Globe Award OÖ



Wozu braucht man Algen? Welche Algen gibt es überhaupt? Wie können Algen für Nahrung, Energie und als Rohstoff genutzt werden? Spannende Fragen, die im Projekt geniALGE beantwortet wurden. Jetzt steht das Projekt vor der Preisverleihung für den Energy Globe Award OÖ und Sie können zur Auszeichnung beitragen!
Im FFG Talente regional Projekt "geniALGE - Algentechnologie als Zukunftshoffung" konnten insgesamt 835 Kinder und Jugendliche an spannenden Exkursionen, Workshops, peer-learning Aktivitäten aktiv teilnehmen und mehr zu Forschung Technologie und Innovation erfahren. Sechs Schulen aus der Region waren ins Projekt eingebunden, zehn Kooperationszuschüsse an Kindergärten und Schulen in ganz Österreich konnten vergeben werden, vier vorwissenschaftliche Arbeiten wurden erfolgreich abgeschlossen und bereits mit zwei Preisen ausgezeichnet. Das Projekt wurde von Juli 2020 bis Dezember 2023 vom Forschungsinstitut für Limnologie der Universität Innsbruck in Mondsee geleitet und vom Technologiezentrum Mondseeland koordiniert. Experten und Expertinnen aus Wissenschaft, und Technik begleiteten die Kinder und Jugendlichen während des Projekts. Jetzt bitten die Projektverantwortlichen um Ihre Unterstützung! Mittels Publikumsvoting rittern die nominierten Projekte um die Zuerkennung des Energy Globe Award OÖ 2023. Bis 23. Mai 2023 12:00 Uhr kann auf der Webseite des Energy Globe Awards www.energyglobe.at für das Projekt geniALGE unter https://www.energyglobe.at/voting/forschungsinstitut-fur-limnologie-mondsee-der-universitat-innsbruck abgestimmt werden. Mehrfachabstimmungen werden ermöglicht.
Mehr zum Projekt geniALGE finden Sie unter www.genialge.at und www.instagram.com/geni.alge
Das Projekt wurde von der Forschungsförderungsgesellschaft FFG finanziert.
online seit 12.05.2023
Zwei Masterarbeiten am Mondsee zu vergeben
Wir suchen Bewerber:innen für zwei Masterarbeiten im FWF Projekt "Süßwasser-Ulvophyceae: Biodiversität, Ökologie und Evolution" am Forschungsinstitut für Limnologie, Mondsee (OÖ).
Forschungshintergrund und Hypothese des Projekts:
Phylogenetische Analysen von SSU rRNA Sequenzen haben die Systematik der Viridiplantae revolutioniert.
Das traditionelle Klassifizierung basierend auf Organisationsstufen wurde ersetzt durch ein System, welches
ultrastrukturelle und molekulare Merkmale benutzt. Kokkale und fädige Grünalgen, ursprünglich zu zwei
Ordnungen Chlorococcales und Ulotrichales/Chaetophorales gestellt, sind in allen Klassen der Chlorophyta
(Chlorophyceae, Trebouxiophyceae and Ulvophyceae) verbreitet. Die letztgenannte Klasse enthält meistens
marine Seetange und Mikroalgen. Allerdings haben neue Studien gezeigt, dass auch Süßwasser- und
Bodenalgenarten bei den Ulvophyceae vertreten sind, aber es ist sehr wenig über diese Arten bekannt.
Traditionell gehören diese Arten zu Gattungen der Chloro- oder Trebouxiophyceae. Diese sind aber bislang
nicht taxonomisch revidiert wurden. Vorläufige Untersuchungen zeigten, dass nicht-marine Ulvophyceen in
mindestens fünf unabhängige Linien der Ulvophyceae zu finden sind. Daher ist Diversität dieser Grünalgen
größer als erwartet. Phylogenetische Analysen haben sogar die Monophylie der Ulvophyceae in Frage
gestellt und macht ein neues Klassifikationssystem notwendig, um die Phylogenie dieser sehr diversen
Gruppe der Grünalgen zu klären.
Wir möchten vier Hypothesen prüfen, um die Monophylie der Ulvophyceae zu klären (H1), Informationen
über die Architektur und Phylogenomik von Plastidengenomen zu bekommen (H2), die Rolle von
osmotischen Stress (H3) und den Einfluß assoziierter Bakterien (H4) auf die phenotypische Plastizität zu
prüfen.
Bei Interesse bitte direkt bei der Projektleitung melden (Abbildungen anklicken).
online seit 04.05.2023



Girls´ Day am Mondsee, Fotos: S. Wanzenböck
GIRLS´ DAY am Forschungsinstitut in Mondsee
online seit 27.04.2023
Seeuferreinigung 2023 am Mondsee
Mitarbeiter:innen des Forschungsinstituts bei der Seeuferreinigung 2023 am Mondsee, Fotos: P. Kerschbaumer, S. Mayer
Trotz Starkregens fand am Samstag, 15.04.2023 die zweijährliche Seeuferreinigung am Mondsee statt, bei der neuerlich Vereine und Institutionen aufgerufen wurden tatkräftig bei der Entsorgung von Müll am Seeufer zu helfen. Drei Mitarbeiter:innen des Forschungsinstituts für Limnologie in Mondsee waren heuer mit der Institutszille wieder freiwillig im Einsatz. Bereits seit vielen Jahren unterstützen die Mitarbeiter:innen des Forschungsinstituts diese Aktion durch ihre aktive Teilnahme. Heuer waren alte Autoreifen, Metallschrott und angeschwemmter Kunststoffmüll die Hauptausbeute bei ihrer Reinigungsaktion. Besonders die sensiblen Schilfzonen am Ufer des Sees, die von Wasservögeln und Jungfischen als Kinderstube genutzt werden, aber auch andere unverbaute Uferabschnitte, dienen der aquatischen Tier- und Pflanzenwelt im NATURA 2000 Gebiet als wichtige Rückzugs- und Schutzbereiche. Die Reinhaltung dieser Gebiete von jeglichem Müll dient daher dem Umwelt- und Naturschutz. Dabei sollte das Umweltbewusstsein für intakte Uferregionen nicht auf die Tage der Seeuferreinigung beschränkt werden, auch während des Jahres können aufmerksame Besucher:innen und Nutzer:innen der Region aktiv den angeschwemmten oder mutwillig eingebrachten Müll entsorgen helfen. Sie unterstützten damit das Ökosystem See.
online seit 17.04.2023
Neue Publikation am ILIM/new publication at ILIM:
Weisse T., Scheffel U., Stadler P. (2023). Temperature-dependent resistance to starvation of three contrasting freshwater ciliates,
European Journal of Protistology 88: 125973, https://doi.org/10.1016/j.ejop.2023.125973
In der Studie wurde die temperaturabhängige Reaktion auf Hunger bei drei unterschiedlichen Süßwasser-Ciliaten (Ciliophora) untersucht. Meseres corlissi (eine zystenbildende, algivore Art) und Glaucomides bromelicola (eine baktivore Art die keine Zysten bilden kann) kommen gemeinsam in Reservoiren von Baumbromelien vor. Die mixotrophe Art Coleps spetai ist in vielen Seen verbreitet. Es wurde angenommen, dass die unterschiedlichen Merkmale und Lebensstrategien dieser Ciliaten ihre Überlebensraten und ihre Temperaturempfindlichkeit unter nahrungsarmen Bedingungen beeinflussen. In Mikrokosmosexperimenten wurden die Sterblichkeitsraten der Organismen, bei verschiedenen Temperaturen und einer Hungerperiode über mehrere Tage, untersucht. Mithilfe eines bildgebenden Durchflusszytometers wurde die Größe der Ciliaten bestimmt und ihre morphologischen und physiologischen Veränderungen als Reaktion auf die Hungersnot gemessen. Bei den zystenbildenden Arten wurde, im Gegensatz zu den nicht zystenbildenden Arten, zwar die höchste Sterblichkeitsrate registriert, durch Zystenbildung könnten diese Arten aber eine langfristige Hungersnot überstehen. Die mixotrophen Arten hatten eine mittlere Sterblichkeitsrate, zeigten jedoch die höchste phänotypische Plastizität als Reaktion auf den Hunger. Ein erheblicher Teil der C. spetai-Population schien von der Hungerphase unbeeinflusst. Dies deutet darauf hin, dass die Endosymbionten den Wirtszellen einige Ressourcen zur Verfügung stellen. Die mittlere Sterblichkeitsrate pro Tag stieg bei allen drei Arten mit der Temperatur um 0,09 °- C1.
Die Open Access Publikation enstand im Rahmen der FWF Projekte P 16796-B06 und P 32714-B .
online seit 11.04.2023
Verabschiedung von Prof. Dr. Arnold Nauwerck

Foto: privat
Am 29.03.2023 nahmen wir in der Evangelischen Kirche Mondsee Abschied von Prof. Dr. Arnold Nauwerck.
Prof. Dr. Arnold Nauwerck, ehemaliger Direktor des Instituts für Limnologie in Mondsee zwischen 1987 und 1997, ist am 8. Februar 2023 verstorben. Als Gewässerforscher hat er schon in den 1960er Jahren mit bahnbrechenden Arbeiten in Schweden internationale Bekanntheit erlangt. Nach weiteren Forschungstätigkeiten in Schweden, Österreich und Kanada kam er schließlich nach Mondsee, leitete das Institut für Limnologie der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, lehrte an den Universitäten Salzburg und Innsbruck und machte sich um den internationalen Kurs für Studierende aus Entwicklungsländern verdient. Nach seiner Pensionierung wandte er sich anderen Themen zu und veröffentliche Bücher über die Küche des Klosters Mondsee, über Wirtshausnamen und eine Biographie über J. Grammont, einen Jugendfreund Schillers. Obwohl er die letzten Jahrzehnte relativ zurückgezogen in Scharfling lebte, bleibt er vielen als Forschungskollege, Vorbild, Mentor und Freund in Erinnerung.
Publikationsliste Prof. Dr. Arnold Nauwerck
online seit 03.04.2023
Erfolgreicher MSc-Abschluss in Mondsee
v.l.n.r: Vorsitzender C.-P. Stelzer, Prüfer T. Weisse, S. Seywald und Prüfer J. Wanzenböck.,
Foto: S. Wanzenböck
Mit ihrer Verteidigung "Does connectivity affect phytoplankton species and functional diversity?" schloss Sabrina Seywald am 31.03.2023 ihr Masterstudium erfolgreich am Forschungsinstitut für Limnologie, Mondsee, ab. In der Forschungsgruppe von Thomas Weisse untersuchte sie, ob die hydrologische Konnektivität den Artenreichtum und die funktionelle Vielfalt des Phytoplanktons in Seen beeinflusst. Ihr Ziel war es, den Phytoplanktonarten geeignete funktionelle Merkmale zuzuordnen, um ihre Fressbarkeit für Ciliaten und anderes Mikrozooplankton (hauptsächlich Copepoden und Cladocera) zu charakterisieren. Die Masterarbeit entstand im FWF Projekt "Functional Diversity of Planktonic Ciliates". Wir gratulieren sehr herzlich!
Sabrina Seywald ist bis Ende 2023 im Rahmen des Projekts "Long-Term Ecological Data" (ÖAW, ESFRI/eLTER Data call) weiterhin am Forschungsinstitut in Mondsee beschäftigt (Projektleitung: J. Wanzenböck).
online seit 03.04.2023
Zwei Wissenschaftler aus Mondsee neuerlich unter den 50 führenden Ökologie- und EvolutionswissenschaftlerInnen in Österreich


Martin Dokulil und Thomas Weisse, Fotos: privat und ILIM
Research.com, eine führende akademische Plattform für ForscherInnen, hat kürzlich die Ausgabe 2023 mit den Rankings der 50 führenden WissenschaftlerInnen im Bereich Ökologie und Evolution veröffentlicht. Neuerlich ist das Forschungsinstitut für Limnologie, Mondsee, gleich mit zwei Plätzen vertreten:
Martin Dokulil belegt den 29. und Thomas Weisse den 40. Rang in Österreich.
Das Ranking basiert auf dem D-Index (Discipline H-index), der nur Arbeiten und Zitationswerte für eine untersuchte Disziplin berücksichtigt. Das Ranking umfasst nur führende Wissenschaftler mit einem D-Index von mindestens 30 für akademische Publikationen im Bereich Ökologie und Evolution und wurde anhand von Daten erstellt, die aus mehreren Datenquellen, darunter OpenAlex und CrossRef, kombiniert wurden. Die bibliometrischen Daten für die Auswertung der zitationsbasierten Metriken wurden am 21.12.2022 erfasst.
Wir gratulieren sehr herzlich!
online seit 03.04.2023
Schaffen wir das 6. nachhaltige Entwicklungsziel (SDG) bis 2030?
Weltwassertag, 22.03.2023

Die nachhaltigen Entwicklungsziele (Sustainable Development Goals, SDGs) sollen bis Ende 2030 die Armut beseitigt, die Gleichstellung von Frauen vorgetrieben, die Gesundheitsversorgung verbessert und dem Klimawandel entgegengesteuert werden. Dazu haben sich 193 internationale VetreterInnen aus UN-Staaten geeinigt. Es wurden 17 Ziele und 169 Zielsetzungen der nachhaltigen Entwicklung formuliert, die für alle Staaten weltweit gleichermaßen Gültigkeit haben. Das 6. Entwicklungsziel "Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und Sanitärversorgung für alle gewährleisten" soll dabei ebenfalls bis 2023 umgesetzt werden.
Der diesjährige Weltwassertag, am 22.03.2023, mit dem Thema "Be the change you want see in the world" fordert alle Menschen auf selbst aktiv zu werden um die Wasser- und Sanitärkrise zu verbessern. Mit einem von UN-Water zur Verfügung gestellten Aktions-Kit, können Gemeinden, Schulen, Firmen, u.v.m. dazu beitragen, dass das 6. Nachhaltigkeitsziel öffentlich thematisiert wird und möglichst viele Menschen zu einer raschen Umsetzung beitragen können.
Mit den Aktions-Kits werden folgende Hilfen zur Verfügung gestellt: (Unterlagen in anderen Sprachen)
Factsheet - Ein kurzer Leitfaden zur Krise und zu den Möglichkeiten, sich zu engagieren. Verfügbar als bearbeitbare Datei
Nachrichten und Karten für soziale Medien - Gebrauchsfertige Inhalte für Ihre sozialen Kanäle
Postkarten - Senden Sie diese an Ihre Kontakte oder verteilen Sie sie bei Veranstaltungen
Poster - Zeigen Sie die Kampagne an und machen Sie auf sie aufmerksam. Erhältlich als bearbeitbare Datei
Banner - Verleihen Sie Ihrem Veranstaltungsraum ein offizielles Branding
Die UN-Wasserkonferenz in New York, am 22. und 23.03.2023, ist die erste Veranstaltung dieser Art seit fast 50 Jahren
(Programm). Hier wird besonderes Augenmerk auf die Zwischenbilanz der UN-Wasserdekade (2018-2028) gelegt.
Als generelles Fazit kann festgehalten werden:
> Es besteht die dringende Notwendigkeit, den Wandel zu beschleunigen - über das "business as usual" hinauszugehen.
> Die neuesten Daten zeigen, dass die Regierungen im Durchschnitt viermal schneller arbeiten müssen, um das SDG 6 rechtzeitig zu erreichen, aber dies ist keine Situation, die ein einzelner Akteur oder eine Gruppe lösen kann. Wasser geht alle an, also müssen alle etwas tun.
Quellen: UN, BM f. europäische und internationale Angelegenehiten, BMUV
online seit 22.03.2023
Vernetzungsgespräch mit dem Bundesamt für Wasserwirtschaft

v.l.n.r. J. Wanzenböck (ILIM) mit D. Achleitner und P. Strauss (beide BAW) im Uferbereich des ILIM am Mondsee,
Foto: S. Wanzenböck
Am Donnerstag, dem 16.03.2023, fand ein Austausch mit dem Bundesamt für Wasserwirtschaft (BAW) am Forschungsinstitut für Limnologie (ILIM) in Mondsee statt. DI Dr. Peter Strauss (Direktor des BAW) und Mag. Dr. Daniela Achleitner, stv. Leiterin des Instituts für Gewässerökologie und Fischereiwirtschaft in Scharfling, besuchten das ILIM. Besonders gemeinsame Synergien hinsichtlich Langzeitdaten und gemeinsame Projektideen wurden mit Forschungsgruppenleiter Dr. Josef Wanzenböck diskutiert. In der Geschichte des ILIM und des BAW Instituts in Scharfling gibt es schon jahrelange Verbindungen, nicht zuletzt haben mehrere Mitarbeiter:innen des Instituts in Scharfling ihre Master- bzw. Doktorarbeiten am ILIM absolviert. Dabei wurden u.a. Richtlinien entwickelt, die seither im Rahmen der EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) zum Einsatz kommen. Für die Vertiefung der Kooperation wurden weitere Vernetzungsgespräche und gemeinsame Seminare vereinbart.
online seit 20.03.2023
Mikroorganismen sind überall
Fotos vom Workshop, credit: S. Wanzenböck
Unser Workshop "Superstarke Mikroorganismen" am 14.03.2023, diesmal an der Internationalen Akademie Traunkirchen, traf bei unseren 18 Jungforscher:innen auf großes Interesse. Neben der Beobachtung von Plankton und Schimmelpilz unter dem Mikroskop konnten die Kinder auch Algen, (fast) unter Laborbedingungen, pipettieren und Hefe beim Wachsen zusehen. Sogar Salzstangerl wurden gebacken und verspeist. Das einstimmige Fazit des Workshops war: "Toll, was man da über Mikroorganismen so alles lernen konnte!"
Im Sommer starten wieder Junge Uni Workshops diesmal zu Aliens im Wasser, Laborabenteuer und den winzigen Planktonorganismen im See, die man unter dem Mikroskop erforschen kann. Alle diese Jungen Uni Veranstaltungen finden am Forschungsinstitut für Limnologie in Mondsee statt. Anmeldung bitte über den Tourismusverband Mondseeland info@mondsee.at oder 06232/2270.
online seit 16.03.2023
Neue Publikation am ILIM/new publication at ILIM:
Weisse T., Scheffel U., Stadler P. (2023). Functional ecology of planctonic ciliates: Measuring mortality rates in response to starvation, J. Eukaryot. Microbiol. 00:e12969, https://doi.org/10.1111/jeu.12969
Thomas Weisse an der FlowCam, Foto: S. Wanzenböck
In dieser Studie wurde die, durch Hunger verursachte, Sterblichkeitsrate von Ciliaten (Wimpertierchen) untersucht. Dabei wurde die Reaktion der planktischen Ciliaten auf Hunger mit drei verschiedener Methoden festgestellt. Zwei dieser Methoden analysierten die Reaktion der Wimperntierchenpopulation mit Hilfe der herkömmlichen Lichtmikroskopie. Bei einer weiteren Methode kam die bildgebende Zytometrie mit einer FlowCAM zum Einsatz, bei der der relative zelluläre Chlorophyll-a-Gehalt in den Nahrungsvakuolen der Wimpertierchen als Indikator für den Ernährungszustand der Zellen gemessen wurde. Die drei verwendeten Methoden ergaben übereinstimmende Schätzungen der Mortalitätsraten von Wimpertierchen, wobei die FlowCAM Methode erstmals eingesetzt wurde um eine Ciliatenpopulation zu überwachen, die einer Hungersnot ausgesetzt war. Es wäre denkbar, dass transkriptomischen Genexpressionsanalysen von Schlüsselenzymen der Nahrungsaufnahme und Verdauung von Ciliaten und anderen phagotrophen Protisten künftig die optischen Methoden für Ciliaten und andere heterotrophe Protisten ergänzen können. Wie die Bildzytometrie kann auch die Einzelzell-Transkriptomik die phänotypische Plastizität der Räuberpopulation bei Hungersnöten abschätzen.
Die Open Access Publikation wurde vom FWF im Rahmen des Projekts "Funktionelle Diversität planktischer Ciliaten" (P 32714, FG Weisse) finanziert.
online seit 15.03.2023
Restplätze im WM 22 Ausgewählte Kapitel: Parasitologie (Master Zoologie)
Für Studierende der Universität Innsbruck gibt es noch Restplätze im WM 22 Ausgewählte Kapitel: Parasitologie vom Masterstudium Zoologie. Bei Interesse bitte dem LV Leiter schreiben.
Termine: 5-16.Juni (am Mondsee, OÖ) + Seminar Ende Juni (online)
kostenlose Unterkunft im Forschungsinstitut für Studierende der Uni Innsbruck
online seit 07.03.2023
Restplätze im WM 10 Physiologische Toxikologie und Umwelttoxikologie (Master Zoologie)
Für Studierende der Universität Innsbruck im Master Zoologie: Es gibt noch Restplätze im Modul Physiologische Toxikologie und Umwelttoxikologie. Bei Interesse bitte dem LV Leiter schreiben.
Aquatischer Teil: 22-26. Mai (Mondsee, OÖ) - kostenlose Unterkunft im Forschungsinstitut für Studierende der Uni Innsbruck
Terrestrischer Teil: 15-19. Mai
online seit 07.03.2023
ECOP-ISOP Kongress 2023 vom 9.-14. Juli in Wien

Zwischen 9. und 14. Juli 2023 findet in Wien der 9. Europäische Kongress für Protistologie (ECOP) statt. Die Tagung wird alle 4 Jahre veranstaltet und findet diesmal als gemeinsame Veranstaltung mit dem Kongress der Internationalen Gesellschaft für Protistologie (ISOP) statt. Als Organisator ist die Deutsche Gesellschaft für Protistiologie (ISOP)/Föderation Europäischer Protistologischer Gesellschaften (FEPS) federführend. Mitarbeiter*innen des Forschungsinstituts für Limnologie sind Teil des Kongress-Organisationsteams.
Die Veranstaltung wird als "Green Event" veranstaltet und findet im Universitätscampus des Alten AKH statt. Die Registrierung der Konferenz ist auf der Konferenzwebseite unter https://ecop-isop2023.univie.ac.at/ möglich. Die ermässigte "Early bird" Anmeldung kann noch bis 17. März 2023 genutzt werden! Die Anmeldung für Vorträge ist noch bis 1. Mai 2023 geöffnet. Die offizielle Konferenzsprache ist Englisch. Für Poster und Nachwuchswissenschafter*innen sind wieder Preise ausgeschrieben. Details finden Sie bitte auf der Tagungswebseite.
online seit 27.03.2023
Erfolgreicher MSc Abschluss zur Blaualgenforschung

Christoph Kotzorek (2. von links) bei der Defensio , die in hybrider Form abgehalten wurde, screenshot: S. Wanzenböck
Am 22.02.2023 schloss Christoph Kotzorek mit seiner Defensio "Click labelling and In Vitro clicking (CuAAC) of the widespread cyanotoxin Microcystin and the bioactive peptide Anabaenopeptin from cyanobacteria" seine Masterarbeit in der Forschungsgruppe von Rainer Kurmayer ab.
Toxinproduzierende Cyanobakterien (Blaualgen) bilden häufig schädliche Algenblüten, die oft mit hohen Konzentrationen von Microcystinen (MC) und Anabaenopeptinen (AP) verbunden sind, die durch die so genannte nichtribosomale Synthese entstehen. Die Methode der Klick-Chemie ist ein wertvolles Instrument zur Verfolgung und Markierung von Biomolekülen in den
Zellen und wurde zur Untersuchung der subzellulären Lokalisierung dieser Moleküle eingesetzt. Generell gilt, dass
das Verständnis der zellulären Lokalisierung, Speicherung und Funktion von MCs oder APs nach wie vor schwer zu fassen ist aber angesichts ihrer zunehmenden Bedeutung in der aquatischen Umwelt ein wichtiges Forschungsthema darstellt.
In seiner komplexen MSc-Arbeit verwendete Christoph Kotzorek zwei in vitro Klick-Chemie-Experimente zur Kopplung modifizierter MCs und APs an einen säuremodifizierten Alexa-Farbstoff über die sogenannte Kupfer-katalysierte Azid-Alkin-Cycloaddition (CuAAC) Reaktion. Er konnte zeigen, dass CuAAC ein wertvolles Instrument für die subzelluläre Lokalisierung und Biomarkierung von Cyanopeptiden unter Verwendung der Standard-Epifluoreszenzmikroskopie ist. Die bei der Markierung sichtbaren helleren Signale und konsistenteren Ergebnisse für Alexa 488-Azid als für Alexa 405-Azid, waren wahrscheinlich auf die optische Interferenz von AF 405-Azid mit der Autofluoreszenz von Cyanobakterien und/oder dem Antifade-Mittel zurückzuführen. Außerdem wurde eine höhere Variabilität und geringere Konsistenz der Fluoreszenzanalyse von Bildern beobachtet, während auf der Ebene der einzelnen Zelle die Hintergrundfluoreszenz reduziert wurde, was zu besser reproduzierbaren Messungen führte.
Wir gratulieren herzlich!
online seit 23.02.2023
Interesse an einer MSc-Arbeit zum Thema Parasitologie?
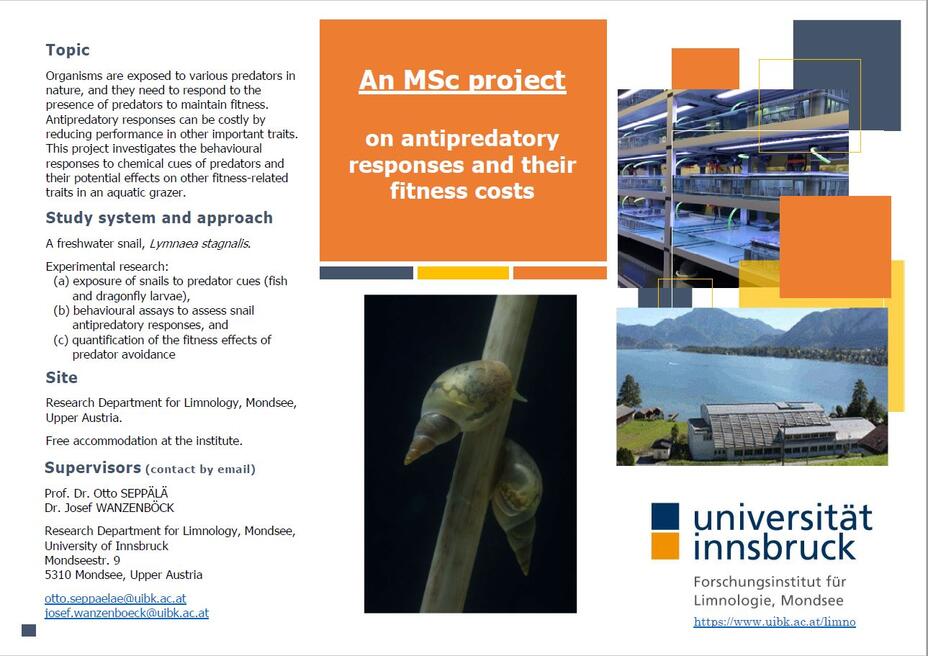
online seit 22.02.2023
Schüler/innen erforschen die Biodiversität von Süßwasserbakterien in Gewässern
Fotos und Probenahmekarte: A. Pitt
Im Sparkling Science Projekt des Institutes Aquirufa: Biodiversität und Ökologie von Süßwasserbakterien gibt es die ersten wissenschaftlichen Ergebnisse. Die Schüler/innen zweier Schulklassen vom BORG Nonntal und dem BRG Schloss Wagrain hatten im Herbst aus selbst gewählten Gewässern Proben genommen und dabei Messungen durchgeführt. Die Proben wurden dann im Klassenzimmer mit den in einem Workshop erlernten Techniken mikrobiologisch bearbeitet. Zur Überraschung für das Projektteam (Alexandra Pitt, Johanna Schmidt, Stefan Lienbacher, Projektleiter Martin Hahn) konnte aus jeder dritten Wasserprobe Bakterienstämme der gesuchten Gattung Aquirufa gewonnen werden. Erste Untersuchungen deuten darauf hin, dass darunter auch neue, noch nicht beschriebene Arten sind. Derzeit werden von 10 Bakterienstämmen die Genome sequenziert, damit lassen sich genauere Analysen durchführen. Die ersten Schulklassen waren schon aus jetziger Sicht durch ihren Einsatz überaus erfolgreich. Im Frühjahr werden weitere vier Klassen in das Projekt einsteigen. Alle Citizen Scientists werden über den gesamten Projektverlauf (bis Herbst 2025) aktiv eingebunden sein. Auch für interessierte Bürger besteht die Möglichkeit zum Mitforschen in Workshops im Institut in Mondsee und in der Auenwerkstatt in der Weitwörther Au im Juni und Herbst 2023. Nähere Informationen gibt es auf der Projektwebseite www.sparklingbacteria.com.
online seit 21.02.2023
Auf der Suche nach der Elritze im Mondseeland


Schüler*in der Mittelschule Mondsee beim Workshop, credit: S. Wanzenböck
Am 14. Februar 2023 fand der erste Schulworkshop an der Mittelschule Mondsee im Rahmen des Sparkling Science Projekts "Biodiversität der Elritzen in Österreich" statt. Projektmitarbeiter Hans Rund hat über die Lebensweise der Elritze, einer gefährdeten Kleinfischart, und Details zum Projekt informiert. In praktischen Teilen konnten die Schüler:innen selbst Wasser aus drei Standorten, die später auch gemeinsam in den drei Projektjahren beprobt werden, mit Handpumpen filtrieren. So wurde den Schüler:innen die Methode zur Gewinnung der UmweltDNA aus dem Wasser, um die ElritzenDNA nachzuweisen, verständlich gemacht. Die Rundfilter zeigten deutliche, farbliche Unterschiede, die Rotfärbung der Mondsee Probe war auf eine lokale, vorübergehende Blaualgenblüte zurückzuführen, was die Kinder besonders beeindruckte. Die Bewertung der Probenstandorte, biotischen und abiotischen Parameter müssen künftig in einem Protokoll festgehalten werden. Die Bestimmung der verschiedenen Kategorien von Ufer, Substrat, Habitattyp usw. wurde mit den Kindern als Quiz abwechslungsreich vermittelt. Als nächste Aktivität mit der Mittelschule Mondsee sind bereits die Freilandprobenahmen vorgesehen. Das Projekt wird in Kooperation mit dem Naturhistorischen Museum Wien zwischen 2023 und 2025 durchgeführt.
Projekt "Kleine Fische ganz groß-Biodiversität der Elritzen in Österreich"
online seit 15.02.2023
We look for an
University Assistant – Postdoc (40 hours per week), University of Innsbruck, Research Department for Limnology, Mondsee, Austria, earliest possible start, duration 3 years.
Position:
In this position, you will carry out independent research in the field of aquatic evolutionary ecology by developing a project at the interface of ecology and evolution. The initial idea for the project comes from you, and you will develop it in collaboration with Prof. Seppälä. Collaboration with other research groups at the Research Department for Limnology and at other departments at the University of Innsbruck is encouraged. Possible research fields include, but are not limited to, species interactions, responses to environmental change, evolutionary genetics, and ecosystem functioning. In an ideal case, your project combines different fields.
Qualifications:
- PhD in Biology
- Research experience in Aquatic Ecology and/or Evolutionary Ecology
- Desired: Postdoc experience, publications in high-ranking journals, experience in supervision of students, acquisition of third-party funds and international work experience
- Flexibility and ability to work in a group are essential
For this position we would need a CV, a motivation letter and a brief (max. 2 pages) description of the research idea (e.g., study question, taken approach, possible collaborators).
Location:
The Research Department for Limnology is located on the edge of the Alps in the small town of Mondsee (Upper Austria). The nearest city is Salzburg, which offers history, culture and entertainment at a convenient distance from Mondsee.
Job profile:
The full, legally binding call for application (in German) can be found at www.uibk.ac.at/karriere.
Qualified persons are invited to apply through the Career Portal of the University of Innsbruck (position: BIO-13290).
We are looking forward to receiving your online application by 24th February 2023.
Salary:
The minimum gross salary (stipulated by collective agreement) for this position amounts to € 4.352,00 per month (14 times). Furthermore, the university has numerous attractive offers (https://www.uibk.ac.at/universitaet/zusatzleistungen/).
For more information considering research, please contact Prof. Otto Seppälä: otto.seppaelae@uibk.ac.at
online seit 06.02.2023
Studierende mit fischökologischem Interesse gesucht

online seit 26.01.2023
JUNGE UNI am Mondsee
Unser JUNGE UNI Programm 2023 für den Sommer ist fertig. Wir freuen uns auf viele interessierte Kinder bei unseren Workshops in den Sommerferien. Bitte um rechtzeitige Anmeldung über den Tourismusverband Mondseeland (Ausnahme: Mikroorganismen Workshop am Traunsee - Anmeldung über die Internationale Akademie Traunkirchen).
Auch dieses Jahr gibt es wieder spannende Workshops für Kinder zwischen 7 und 12 Jahren:
- Superstarke Mikroorganismen (am IAT Traunsee), 14.3.2023
- Aliens unter uns (am Forschungsinstitut für Limnologie, Mondsee), 11.7.2023
- 2x Was lebt im See – eine Unterwasserreise mit dem Mikroskop (am Forschungsinstitut für Limnologie, Mondsee), 24.7.2023, 25.7.2023 (Wiederholungstermin)
- 2x CSI Natur- Genetik im Labor (am Forschungsinstitut für Limnologie, Mondsee), 8.8.2023 vormittags, 8.8.2023 nachmittags (Wiederholungstermin)
Wir freuen uns auf eure Anmeldungen!
Details zum Programm 2023
online seit 16.01.2023
Wir stellen ein...
Biologisch Technischer Assistent (m/w/d) in der Forschungsgruppe Evolutionsökologie,
30 Wochenstunden, am Forschungsinstitut für Limnologie, Mondsee, OÖ
Bewerbungsfrist: 14.02.2023
Details siehe https://www.uibk.ac.at/limno/jobs/
online seit 13.01.2023
Ruhestand


Mit Beginn dieses Jahres gehen zwei langgediente KollegInnen in den wohlverdienten Ruhestand.
Wir wünschen Prof. Dr. Thomas Weisse, FG Leiter Planktonökologie und ehemaliger Institutsleiter, und Dipl. Biol. Ulrike Scheffel alles Gute und bedanken uns für viele gemeinsame und prägende Jahre am Forschungsinstitut.
online seit 10.01.2023