Germanistische Reihe Band 61

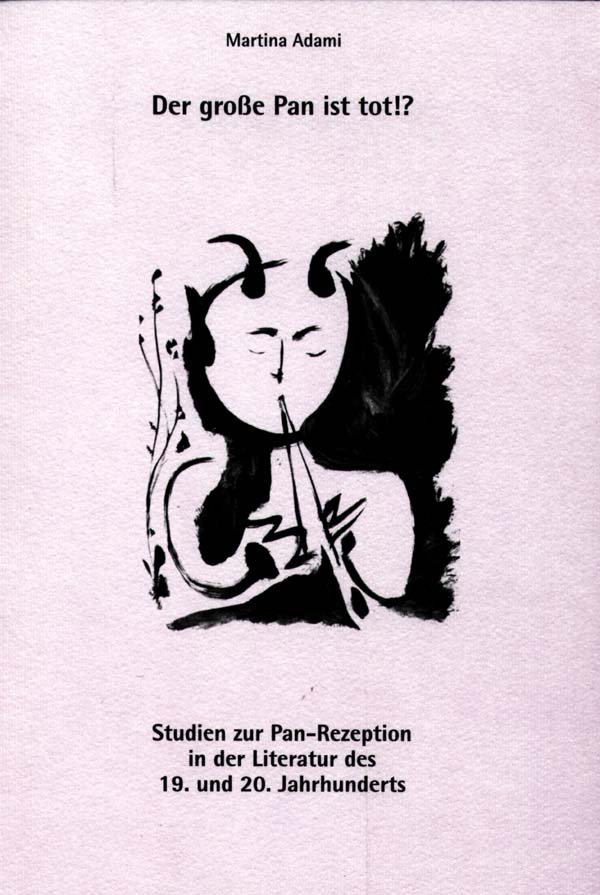
Martina Adami:
Der große Pan ist tot!?
Studien zur Pan-Rezeption in der Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts.
ISBN-10: 3-901064-24-9
ISBN-13: 978-3-901064-24-1
Bestellen Sie diesen Titel
Die vorliegende Arbeit aus dem Grenzbereich zwischen Klassischer und Deutscher Philologie beleuchtet ein weites Untersuchungsfeld, auch wenn sie die Pan-Rezeption in der deutschsprachigen Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts in den Mittelpunkt stellt. So behält sie nicht nur die vielfältigen antiken Pan-Vorstellungen im Blick, sie verweist auch immer wieder darauf, daß die Pan-Rezeption in der neueren Literatur den Bezug zur Antike nicht selten über diverse mittlere Vermittlungsinstanzen gewinnt.
Die Autorin berücksichtigt darüber hinaus die Pan-Rezeption auch in anderen Literaturen (zum Beispiel in der englischsprachigen, italienischen oder russischen Literatur) sowie in philosophischen oder pseudo-philosophischen Strömungen (wie in der New-Age-Bewegung) und erörtert nicht zuletzt Pan-Darstellungen in der Kunst, die ebenfalls auf literarische Darstellungen ausstrahlen.
Nach einer Präsentation der antiken Vorstellungen des Hirten- und All-Gottes Pan konzentriert sich Adami auf die vielfältigen Pan-Deutungen von Heinrich Heine über Friedrich Nietzsche bis zu Hofmannsthal, Otto Julius Bierbaum und Hamsuns Pan-Roman, von Georg Heym und Georg Trakl bis zu Benn und Loerke, von Gerhart Hauptmann bis zu Ernst Wiechert und Arno Schmidt, von Ingeborg Bachmann und Marie Luise Kaschnitz bis zu Peter Rühmkorf, György Sebestyén, Botho Strauss und Dieter Wellershoff: Alle nur denkbaren Genres der Literatur und beinahe alle nur denkbaren Literaturkonzeptionen, von starr traditionsgebundenen bis zu postmodernen, werden hier unter dem Blickpunkt der Pan-Rezeption analysiert.
Besprechungen
Gymnasium. Zeitschrift für Kultur der Antike und humanistische Bildung 109/4 (2002), 365–366, Klaus Fetkenheuer
Österreich in Geschichte und Literatur 46 (2002), 136–137, Gennadij Vasilev
Kulturelemente 30 (2001), 13, Ferruccio Delle Cave
Dolomiten 8 (10.01.2002), 17, Josef Ties
