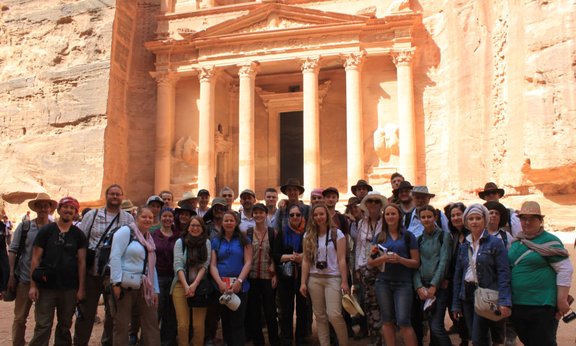Neuigkeiten
Im weltweiten QS-Hochschulranking, welches vom Londoner Hochschulanalysten Quacquarelli Symonds erstellt wird und das zu den drei etabliertesten Rankingsystem gehört, wurde die Archäologie neben der Physik und der Astronomie als einer drei besten Fachbereiche der Universität Innsbruck gereiht.
(6.1.2026) Das Institut für Archäologien betrauert das Ableben der geschätzten Kollegin Ao. Univ.-Prof. i. R. Dr. Brinna Otto (21.7.1938-6.1.2026) und wird ihr stets ein ehrendes Andenken bewahren.
(17.12.2025) Der Best Paper Award 2025 der Zeitschrift „Archaeologia Austriaca“ wurde durch die Wahl der Beiratsmitglieder Markus Staudt, Gert Goldenberg, Roman Lamprecht und Bianca Zerobin für ihren Artikel „Montanarchäologische Prospektionen zum prähistorischen Kupferbergbau in den Kitzbüheler Alpen. Neue Fundstellen und erste Ergebnisse zum Abbau und zur Erzaufbereitung von Kupferkies im Raum Jochberg (Nordtirol)“ zugesprochen. Wir gratulieren!
(17.09.2025) Wir gratulieren Aydin Abar und Fabian Dielmann ganz herzlich zur Verleihung des Ars Docendi 2025 Hauptpreises in der Kategorie Gesellschafts- und Nachhaltigkeitsorientierte Lehref ür das Lehreprojekt Heavy Metal Sustainability. On the rocky road to a circular economy: Tracing the life cycle of metals from past to future.
Veranstaltungen
Semestervorbesprechung
Montag, 02.03.2026, 8.30 Uhr, kleiner Hörsaal, Innrain 52a, 1. UG (Ágnes-Heller-Haus)
Vortrag
Dr. Günther Kaufmann
Römischer Mithraskult an der Brennerroute
Montag, 23. März 2026, 19.00 Uhr
Institut für Archäologien, Innrain 52a, 6020 Innsbruck, 1. UG, Kleiner Hörsaal
Vortrag
Dr. Philipp Margreiter
Africam defendere. Byzantinische Fortifikationen in der nordafrikanischen Region Thugga im 6. und 7. Jahrhundert
Donnerstag, 26. März 2026, 19.00 Uhr
Institut für Archäologien, Innrain 52a, 6020 Innsbruck, 1. OG, Seminarraum 14
CfP-Tagung
Innsbrucker Tag der Archäologie
Samstag, 11. April 2026
Palais Claudiana, Herzog-Friedrich-Straße 43, 6020 Innsbruck
Veranstaltung
Institut für Archäologien bei der Langen Nacht der Forschung
Freitag, 24. April 2026, 17.00-23.00 Uhr
Institut für Archäologien, Innrain 52a, 6020 Innsbruck, EG
Archäologisches Universitätsmuseum, Innrain 52a, 6020 Innsbruck, 1. UG
Vortrag
Prof. Dr. Martin Guggisberg
Identitäten im Wandel: Das Gräberfeld von Francavilla Marittima bei Sybaris und die Transformation des kulturellen Raum
Dienstag, 28.04.2026, 17:30
Institut für Archäologien, Innrain 52a, 6020 Innsbruck, 1. OG, Seminarraum 13
Vortrag
Univ.-Prof. Dr. Matthias Grawehr
Bildlampen und Big Data. Neue Perspektiven für die Erforschung römischer Tonlampen
Donnerstag, 28. Mai 2026, 19.00 Uhr
Institut für Archäologien, Innrain 52a, 6020 Innsbruck, 1. UG, Kleiner Hörsaal
Vortrag
Prof. Dr. Ute Verstegen
Zwischen China und Byzanz. Frühchristliche Kunst entlang der Seidenstraße
Montag, 15. Juni 2026, 19.00 Uhr
Institut für Archäologien, Innrain 52a, 6020 Innsbruck, 1. UG, Kleiner Hörsaal
Museumspädagogisches Programm - Sommerferienzug Innsbruck 2026
Donnerstag, 16. Juli 2026, 9.00–11.00 Uhr
Wie lebten Kinder und Jugendliche im alten Rom?
Archäologisches Universitätsmuseum, Innrain 52a, 6020 Innsbruck, 1. UG
Museumspädagogisches Programm - Sommerferienzug Innsbruck 2026
Dienstag, 21. Juli 2026, 9.00–11.00 Uhr
Die Götter Griechenlands
Archäologisches Universitätsmuseum, Innrain 52, 6020 Innsbruck, 3. OG
Museumspädagogisches Programm - Sommerferienzug Innsbruck 2026
Donnerstag, 23. Juli 2026, 9.00–11.00 Uhr
Wie arbeiten ArchäologInnen?
Archäologisches Universitätsmuseum, Innrain 52a, 6020 Innsbruck, 1. UG
Museumspädagogisches Programm - Ferienexpress Hall-Absam 2026
Donnerstag, 30. Juli 2026, 9.00–11.00 Uhr
Wie arbeiten ArchäologInnen?
Archäologisches Universitätsmuseum, Innrain 52a, 6020 Innsbruck, 1. UG
Museumspädagogisches Programm - Sommerferienzug Innsbruck 2026
Dienstag, 4. August 2026, 9.00–11.00 Uhr
Auf den Spuren der Römer in Tirol
Archäologisches Universitätsmuseum, Innrain 52a, 6020 Innsbruck, 1. UG
Veranstaltung
ÖGUF Innsbruck-Wochenende
Freitag, 9. bis Sonntag, 11. Oktober 2026
Institut für Archäologien, Innrain 52a, 6020 Innsbruck
Tagung
CHAT 2026 - Contemporary and Historical Archaeology in Theory
Group Annual Meeting
Donnerstag, 29. bis Samstag, 31. Oktober 2026
Call for papers Deadline: 31.01.2026
Tagung
Sitzung der AG Bronzezeit
zum Thema „Mensch-Umwelt-Interaktionen in der Bronzezeit“ sowie „Aktuelle Forschungen zur Bronzezeit“
Anreise & Get-together 24.09.2026, Konferenzbeiträge 25.–26.09.2026, Exkursion am 27.09.2026
Call for papers Deadline: 30.04.2026
Informationen
Für Studierende
Vorlesungsverzeichnis SS 2026
- Vorlesungsverzeichnis Archäologien - SS 2026
- Stundenplan Archäologien
- Online-Lehrzielkatalog der Universität Innsbruck – SS 2026
Anmeldungen zu Lehrgrabungen
- Lehrgrabung Aguntum
Grabung in der römischen Stadt Aguntum bei Lienz in Osttirol
29.06.-14.08.2026
Anmeldung über LFU Online; im Anmerkungsfeld "Grabung Aguntum" und gewünschten Teilnahmezeitraum angeben
- Lehrgrabung Kropfsberg
Grabung in der prähistorischen Höhensiedlung Burghügel Kropfsberg (Reith i. A.)
29. Juni bis 31. Juli 2026
Anmeldung bis spätestens 15.03.2026 per Mail an peter.trebsche@uibk.ac.at
Für Mitarbeiter*innen
Weiterführende Links
Kontakt
Universität Innsbruck, Ágnes-Heller-Haus
Innrain 52A, 4. OG
6020 Innsbruck
Archaeologien@uibk.ac.at
Institutsleitung:
Sekretariat: