Kapitel
15 | |
| |
 Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis |
 B. Dingliche Sicherheiten B. Dingliche Sicherheiten |
| |
A. (Privat)Rechtliche Sicherungsmittel |
| |
1. Wer braucht
Sicherheit/en | |
Das Rechts- und Wirtschaftsleben
verlangt in vielfacher Hinsicht nach Sicherheit/en, konkreter: nach
größerer als der üblichen Sicherheit; etwa im Rahmen der Rechtsstellung
des Gläubigers gegenüber seinem Schuldner. Der Gläubiger ist mit
seinem Forderungsrecht auf die Leistungsfähigkeit und Leistungswilligkeit
des Schuldners angewiesen und daher zufälligen Änderungen derselben
ohne zusätzliche Sicherheit/en weitgehend ausgeliefert; mögen das
Tod oder Krankheit des Schuldners oder eine nachteilige wirtschaftliche
Veränderung seines Vermögens sein, die Exekutionen oder seine Insolvenz
( → KAPITEL 19: Insolvenzrecht) bewirken können. – Sich dagegen zu schützen,
ist das gute Recht eines jeden Gläubigers. – Umgekehrt benötigt
auch der Schuldner Schutz bei seiner Leistungserbringung, zumal
diese ohne Zug um Zug-Leistung des Gläubigers ebenso gefährdet sein
kann. Das haben jene (Anlass)Fälle drastisch vor Augen geführt,
die zur Erlassung des BTVG geführt haben; RA Itzlinger und Maculan-Pleite. | Was
meint „Sicherheit”? |
Das erinnert uns an die große Bedeutung
der Zug um Zug-Leistung für die rechtliche Sicherheit beider (!)
Vertragsteile → KAPITEL 2: Zug
um Zug-Leistung. Es ist daher kein Zufall, dass das Zug
um Zug-Leistungsprinzip in der Frühzeit des Rechtsdenkens, etwa
von den Griechen, besonders betont wurde. | |
Rechtssicherheit
ist ein hoher Rechtswert. Das Rechtssystem wird ihm – wie uns dieses
Kapitel zeigt – in ganz unterschiedlicher Weise gerecht. Der Formenreichtum
ist groß. Dadurch werden mittels rechtlicher „Zuschaltung” Verhaltenserwartungen
der einen oder der anderen, aber auch beider Vertragsteile gefördert
und stabilisiert. |
Rechtssicherheit |
Das „Erste Hauptstück”
des „Dritten Teiles” des ABGB (§§ 1342 ff) trägt die Überschrift
„Von Befestigung der Rechte und Verbindlichkeiten”. § 1342 ABGB
zieht den Rahmen: | ”Befestigung
der Rechte und Verbindlichkeiten” |
”Sowohl Personenrechte als Sachenrechte,
und daraus entspringende Verbindlichkeiten können gleichförmig befestigt,
umgeändert und aufgehoben werden.” | |
Und § 1343 ABGB nennt die „Arten der
Befestigung eines Rechtes”: | ”Arten
der Befestigung“ |
”Die rechtlichen Arten der Sicherstellung
einer Verbindlichkeit und der Befestigung eines Rechtes, durch welche dem
Berechtigten ein neues Recht eingeräumt wird, sind: die Verpflichtung
eines Dritten für den Schuldner, und die Verpfändung.” | |
Diese
Aufzählung ist – wie wir sehen werden – unvollständig. – Rechtliche
Vorsorge sollte immer auch rechtzeitig getroffen werden. Dafür vorzusorgen
gehört zu den Aufgaben der Kautelarjurisprudenz. | Kautelarjurisprudenz |
 | |
2. Vertragliche
und gesetzliche Sicherheiten | |
Wird von Sicherungsmitteln
gesprochen, meint man idR vertragliche, also von den Vertragsparteien
im konkreten Fall erst noch zu vereinbarende Sicherheiten; sei es
ein Eigentumsvorbehalt, eine Wertsicherungsklausel, eine Konventionalstrafe
(§ 1336 ABGB) oder ein Vertragspfand (§ 1368 ABGB). | |
Neben den vertraglichen oder rechtsgeschäflichen
Sicherheiten gibt es aber auch eine Reihe schon gesetzlich vorgesehener
Sicherheiten, die auch ohne Vereinbarung wirken; etwa das gesetzliche
Vermieterpfandrecht des § 1101 ABGB, das Zurückbehaltungs- oder
Retentionsrecht (§ 471 ABGB und §§ 369, 370 HGB) oder die wichtigen
gesetzlichen Pfandrechte des Handelsrechts zugunsten von Kommissionär
(§ 397 HGB), Spediteur (§ 410 HGB), Lagerhalter (§ 421 HGB) und Frachtführer
(§ 440 HGB). | Gesetzliche
Sicherheiten |
| Schutz- oder
Sicherungsgesetze |
3. Dingliche
und obligatorische Sicherheiten | |
Bevor auf
wichtige Sicherungsmittel eingegangen wird, soll über das reiche
Instrumentarium dinglicher und obligatorischer Sicherungsmittel
ein – wenn auch unvollständiger – erster Überblick geboten werden,
zumal deren nominelle Kenntnis für die künftige (Berufs)Praxis,
aber auch den privaten Bedarf von Vorteil ist. | |
| |
So
wie die Sachenrechte insgesamt (durch den Typenzwang! → KAPITEL 8: Typenzwang)
überschaubar sind, gibt es bislang auch nur wenige dingliche Sicherheiten: | |
| •
Der Eigentumsvorbehalt,
ist das am weitesten verbreitete dingliche Warensicherungsmittel (samt
Exszindierung und Aussonderung) → KAPITEL 8: Eigentumsvorbehalt
als Warensicherungsmittel; | |
| •
das Pfandrecht:
als Faustpfand oder Hypothek → Das
Pfandrecht;
zum Lombardkredit (Wertpapier- oder Warenlombard) → Zur wirtschaftlichen
Bedeutung des Pfandrechts; | |
| •
die Sicherungsübereignung
→ KAPITEL 8: Die
Sicherungsübereignung; | |
| •
das (kaufmännische)
Zurückbehaltungs- oder Retentionsrecht
→ Das
Zurückbehaltungsrecht: § 471 ABGB
| |
| |
| |
| Obligatorische
Sicherheiten iwS |
| •
Garantievertrag
/ Bankgarantie
→ Garantievertrag
und Bankgarantie; | |
| •
Bürgschaft:
§§ 1346 ff ABGB → Die
Bürgschaft: §§ 1346 ff ABGB; | |
| •
Dokumentenakkreditiv
→ Das
Dokumentenakkreditiv; | |
| •
Angeld:
§ 908 ABGB → Angeld:
§ 908 ABGB; | |
| •
Reugeld:
§§ 909 ff ABGB, § 7 KSchG + Storno → Reugeld:
§§ 909 ff ABGB und § 7 KSchG; | |
| •
Konventionalstrafe:
§ 1336 ABGB und § 348 HGB iVm Art 8 Nr 3 der 4. EVHGB → Die
Konventionalstrafe des § 1336 ABGB; | |
| •
Schuldbeitritt und Schuldnerwechsel
→ KAPITEL 14: Der
Schuldnerwechsel; | |
| •
Sicherungszession
→ KAPITEL 14: Sicherungszession + Factoring
→ KAPITEL 14: Das
Factoring; | |
| •
Terminsverlust:
§ 13 KSchG → KAPITEL 2: Terminsverlust (§ 13); | |
| •
Wechsel / Scheck
→ Der
Wechsel und → Der
Scheck; | |
| •
(gegenseitige) Aufrechnungsmöglichkeiten:
§§ 1438 ff ABGB → Aufrechnung
/ Kompensation; | |
| •
Vorkaufs-
→ KAPITEL 2: Das Vorkaufsrecht (§§
1072 ff ABGB) und Wiederkaufsrecht
→ KAPITEL 2: Nebenabreden
beim Kauf ¿ Übersicht (§§
1068 ff ABGB); | |
| •
Vorvertrag:
§ 936 ABGB → KAPITEL 6: Der
Vorvertrag: § 936 ABGB; | |
| •
Fixgeschäft:
§ 919 ABGB → KAPITEL 7: Das
Fixgeschäft: § 919 ABGB und § 376 HGB; | |
| •
Wertsicherung (sklauseln) → Wertsicherung; | |
| •
Kaution/en
→ Kaution/en
| |
 | |
| |
Im Rahmen der
Sicherungsmittel iwS zu erwähnen sind aber auch noch andere (Rechts)Einrichtungen,
wie bestimmte öffentliche Bücher oder Register, die ebenfalls der
(Rechts)Sicherheit dienen; vor allem das Grundbuch ( → KAPITEL 2: Das
Grundbuch)
und das Firmenbuch. Letzters wird im Anschluss
kurz behandelt → Das
Firmenbuch / FB Zum Patent-, Marken-
und Musterrechtsregister ebenfalls gleich unten →
Marken-, Muster- und Patentregister
| |
| |
Rechtsgeschichtlich ist das rechtlich-administrative Registrierungswesen griechischen
Ursprungs, wie überhaupt auch der hier so bedeutende Publizitätsgedanke des
Sachenrechts sowie das Archiv- und Urkundenwesen eine bedeutende
Leistung des antiken griechischen Rechtsdenkens darstellt. | |
 | |
Bislang werden die Möglichkeiten der EDV/ADV für rechtliche
Registrierungsaufgaben noch zu wenig genützt. Manches Publizitätsproblem
könnte dadurch aber effizienter gelöst werden. | |
| |
Das FB ist Nachfolgerin
des alten Handelsregisters; Rechtsquellen: FBG, BGBl 1991/10
und die §§ 8-16 HGB. Es dient der
Transparenz
des Handelsverkehrs. Insbesondere Vollkaufleute sind verpflichtet
bestimmte sie betreffende Daten / Tatsachen in dieses öffentliche
Register (Publizität!) eintragen zu lassen. | |
Hauptbuch und Urkundensammlung | |
Das FB ist
in seinem Aufbau dem Grundbuch nachgebildet und besteht wie dieses
aus einem
Hauptbuch und
einer
Urkundensammlung;
§ 1 Abs 1 FBG. Es dient nach § 1 Abs 2 FBG der Verzeichnung und
Offenlegung von Tatsachen die nach dem FBG oder sonstigen Rechtsvorschriften
einzutragen sind. Das FB wurde auf automationsunterstützte Datenverarbeitung
(ADV) umgestellt, was ein bequemes Abrufen dieser Daten ermöglicht;
vgl §§ 28 ff FBG. Zur FB-Abfrage ist nach § 34 FBG grundsätzlich
„jedermann” befugt; vgl auch § 9 Abs 1 HGB. Notare (§ 35 FBG) und
Rechtsanwälte (§ 35a FBG) haben die Voraussetzungen für FB-Abfragen
zu schaffen. Seit 1999 können FB und Grundbuch auch über das Internet
abgefragt werden. | |
Für aus der Führung des FB verursachte Fehler haftet
der Bund; § 37 FBG. – Das DSG 2000 (BGBl 165/1999) ist auf das FB
nicht anzuwenden; § 38 FBG. | Haftung
für Fehler |
FB-Sachen
sind Angelegenheiten des außerstreitigen Verfahrens. Sachlichzuständigsind
die Gerichtshöfe I. Instanz, sofern sie mit Handelssachen
betraut sind; örtlich zuständig ist das Gericht in dem ein Unternehmen
seine Hauptniederlassung oder seinen Sitz hat; § 120 Abs 1 JN. In
FB-Sachen entscheiden Einzelrichter und Rechtspfleger. | Zuständigkeit |
Ins FB (Hauptbuch) eingetragen
werden nach § 2 FBG bspw: Einzelkaufleute, Personengesellschaften
(OHG und KG), Erwerbsgesellschaften, Kapitalgesellschaften, Erwerbs-
und Wirtschaftsgenossenschaften, Sparkassen, Versicherungsvereine
auf Gegenseitigkeit und Privatstiftungen sowie EWIV. | Was
wird eingetragen? |
Bei allen Rechtsträgern sind nach § 3 FBG
einzutragen (sog allgemeine Eintragungen): Die
FB-Nummer, die Firma, die Rechtsform des Unternehmens, Sitz- und
Zustellungsanschrift, (nach eigener Angabe) eine kurze Bezeichnung
des Geschäftszweigs, Zweigniederlassungen, Tag des Gesellschaftsvertragsabschlusses
etc, Name und Geburtsdatum des Einzelkaufmanns (bei anderen Rechtsträgern
ihre vertretungsbefugten Personen samt Beginn und Art ihrer Vertretungsbefugnis),
bei Prokuristen (Name, Geburtsdatum sowie Beginn und Art ihrer Vertretungsbefugnis),
laufende Exekutionen oder Insolvenzverfahren, laufende Liquidationen
/ Abwicklungen, Vereinbarungen nach den §§ 25 Abs 2 oder 28 Abs
2 HGB etc. | allgemeine
Eintragungen |
Bei Einzelkaufleuten, Personengesellschaften
und Erwerbsgesellschaften sind nach § 4 FBG zB ferner einzutragen (sog besondere
Eintragungen): Bestellung eines Sachwalters oder Name und
Geburtsdatum der Kommanditisten samt Höhe ihrer Einlage etc. § 5
FBG (Aktiengesellschaften und GmbHs) und § 6 (Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften)
treffen Sondervorschriften für diese Rechtsträger. | besondere
Eintragungen |
Allfällige Änderungen
eingetragener Tatsachen sind unverzüglich anzuzeigen; §
10 FBG. § 12 FBG trifft Vorsorge hinsichtlich der Urkundensammlung,
§ 13 FBG regelt Mitteilungspflichten an die Gerichte, zumal das
FB-Gericht Anmeldungen auf ihre Zulässigkeit und Richtigkeit zu
prüfen hat. – Die §§ 15 ff FBG regeln das FB-Verfahren. | Änderungen |
Sie wird
in Form eines Auszugs / Ausdrucks gewährt. In die Urkundensammlung
kann über den Bildschirm oder durch einen Ausdruck Einsicht genommen
werden. Die Einsichtnahme ist gebührenpflichtig; derzeit beträgt
sie für je 850 angefangene Zeilen und je Bilanz 8 ı. | Einsicht ins Hauptbuch |
Eintragungen ins FB (positive wie negative)
wirken unterschiedlich; nämlich konstitutiv / rechtsbegründend oder
bloß deklarativ / rechtsbekundend. | Wie wirkt die
FB-Eintragung? |
 | |
Nach § 5 HGB (sog Scheinkaufmann)
begründet die Eintragung ins FB die unwiderlegbare
Rechtsvermutung, dass die eingetragene Firma ein Vollhandelsgewerbe
betreibt. Abgesehen von dieser besonderen Wirkung des § 5 HGB bewirken
FB-Eintragungen aber bloß widerlegbare (Rechts)Vermutungen bezüglich
Richtigkeit und Gesetzmäßigkeit der jeweiligen Eintragung. – Zur
Rechtsvermutung → KAPITEL 3: Redlichkeitsvermutung. | |
Publizität bedeutet hier, dass das FB sog öffentlichen
Glauben besitzt, also den guten Glauben Dritter im Geschäftsverkehr
schützt. – Zu unterscheiden sind negative und positive Publizität
(§ 15 HGB): | Publizität
des FB |
Negative Publizität
(§ 15 Abs 1 HGB): Eine nicht eingetragene Tatsache kann Dritten
nicht als bekannt entgegengesetzt werden; zB Erlöschen der Prokura
ohne Berichtigung im FB. | |
Positive Publizität (§ 15 Abs
2 HGB): Eingetragene Tatsachen müssen Dritte gegen sich gelten lassen;
eine Ausnahme statuiert § 15 Abs 2 Satz 2 HGB. | |
2.
Marken-, Muster- und Patentregister | |
Rechtsquelle
ist das MarkenschutzG 1970 (MarkSchG). „Marken”
sind nach § 1 MarkSchG besondere Zeichen, deren Aufgabe es ist,
Waren und Dienstleistungen bestimmter Unternehmen von gleichartigen
Waren- und Dienstleistungen anderer Unternehmen zu unterscheiden.
– Zur Marke wird ein (Kenn)Zeichen durch Eintragung ins
Markenregister. Die Registrierung einer Marke begründet Markenausschließlichkeit für
den Markeninhaber. Die Schutzdauer beträgt zunächst 10
Jahre und kann wiederholt auf weitere 10 Jahre verlängert
werden. – Eine Registrierung in Österreich schafft nur innerhalb
der nationalen Grenzen Schutz. Daneben besteht die Möglichkeit eines
europaweiten Schutzes;
Europamarke: EG-VO 40/94. | Markenrecht |
Rechtsquelle
ist das MusterschutzG 1990 (MuSchG), das sich inhaltlich
am Marken- und Patentrecht orientiert. Auch das MuSchG schafft Ausschließlichkeitsrechte
für das jeweilige Muster. Muster iSd § 1 MuSchG
ist ein Vorbild für das Aussehen eines gewerblichen Erzeugnisses. Geschützt
werden Material, Farbe und Form, nicht aber Konstruktion und Funktion
eines Produkts. – Zur Entstehung des Musterrechts ist die Anmeldung
beim Patentamt oder
bei der örtlich zuständigen Wirtschaftskammer (§
11 MuSchG) und zusätzlich die Registrierung des Musters erforderlich.
Das Musterregister wird vom Patentamt geführt.
Es ist öffentlich; § 18 Abs 3 MuSchG. | Musterrecht |
Rechtsquelle
ist das PatentG 1970 (PatG). Der Schutz von Patenten
bezweckt den Schutz geistigen Eigentums und damit
den Schutz von Erfindungen. Das Patent wird vom Patentamt verliehen
und in das Patentregister eingetragen und im Patentblatt
kundgemacht. – Auch das Patentrecht schafft ein Ausschließlichkeitsrecht
für den Patentinhaber. Patentverletzungen werden als Verletzungen
absoluter Rechte geahndet; § 147 ff PatG. – Das Patentrecht als
Ganzes kann vererbt oder rechtsgeschäftlich
übertragen und auch verpfändet oder gepfändet werden.
Neben der Übertragung des Patentrechts als Ganzem besteht auch die
Möglichkeit der Übertragung des bloßen Nutzungsrechts eines
Patents. Dies geschieht durch Lizenz ( vertrag) → KAPITEL 5: Lizenzvertrag.
– Die Schutzfrist von Patenten beträgt 20 Jahre,
berechnet ab dem Anmeldetag; §§ 28, 46 PatG. | Patentrecht |
III. „Kleinere” schuldrechtliche
Sicherheiten | |
| |
„Was bei Abschließung eines Vertrages [im] voraus
gegeben wird, ist ... nur als Zeichen der Abschließung, oder als eine
Sicherstellung für die Erfüllung des Vertrages zu betrachten ...”;
§ 908 ABGB. | |
Das Angeld hat danach Beweis-
und Sicherungsfunktion. Das zeigt sich auch an
den Rechtsfolgen: | Beweis- und
Sicherungsfunktion |
„Wird [nämlich] der Vertrag durch Schuld einer Partei nicht
erfüllt, so kann die schuldlose Partei [entweder] | |
| • das ... empfangene
Angeld behalten oder | |
| • den doppelten Betrag des von ihr gegebenen
Angeldes zurückfordern”. | |
Die schuldlose Partei muss sich aber nicht mit dem Angeldverfall
begnügen, sondern kann auf Vertragserfüllung bestehen; oder bei
verschuldeter Unmöglichkeit Schadenersatz (wegen Nichterfüllung)
verlangen → KAPITEL 7: Nachträgliche
Unmöglichkeit. | |
Das Angeld ist von der Anzahlung zu
unterscheiden, was bei Kaufverträgen eine praktische Rolle spielt.
Denn nicht jede bei Vertragsabschluss erbrachte Leistung ist Angeld!
Das gilt bspw für die Anzahlung nach § 20 KSchG beim Abzahlungsgeschäft. → KAPITEL 2: Das Abzahlungsgeschäft. | |
Die Rspr hat deshalb Auslegungs- iSv Abgrenzungskriterien entwickelt: | |
| • Angeld wird nur bei kleineren
Beträgen angenommen; | |
| •
im Zweifel wird das „Angeld”
auf die zu erbringende Gesamtleistung / das Entgelt angerechnet, was
nichts anderes bedeutet, als dass das Angeld im Zweifel als Anzahlung
behandelt wird. | |
| |
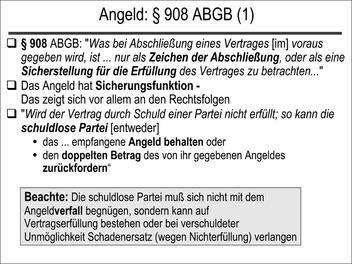 | Abbildung 15.1: Angeld: § 908 ABGB (1) |
|
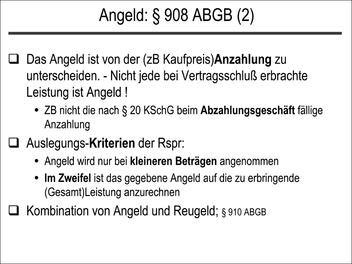 | Abbildung 15.2: Angeld: § 908 ABGB (2) |
|
2. Reugeld:
§§ 909 ff ABGB und § 7 KSchG | |
Reugeld wird das Entgelt für die Einräumung
eines vertraglichen (!) Rücktrittsrechts genannt. – Reugeld
wird statt (!) der Vertragserfüllung entrichtet;
es gewährt ein Wahlrecht. | Vertragliches
Rücktrittsrecht |
| |
Nach § 909 Satz 3 ABGB nimmt bereits Teil-Erfüllung oder Teil-Annahme der
Leistung das Reurecht. – Auch bei verschuldeter Nichterfüllung eines
Vertrags ist Reugeld zu bezahlen. | |
Damit ist idR
Reugeldvereinbarung gemeint; praktisch wichtig sind Stornovereinbarungen
zB bei Reiseverträgen. | Storno/Stornierung |
Er
ist nunmehr in den §§ 31b-31f KSchG geregelt: → KAPITEL 12: Der
(Pauschal)Reiseveranstaltungsvertrag.
– Im Zusammenhang mit Reis(veranstaltungs)verträgen spielen Reugeld
und Storno eine wichtige Rolle. Während Pauschalbuchungen über Reisebüros
meist schon eine Stornoversicherung beinhalten (20% Selbstbehalt),
muss der Individualreisende für kurzfristige „Stornos” (Rücktritte)
im eigenen Interesse selbst vorsorgen. Reisestornoversicherungen bieten
hier Abhilfe. – Die österreichische Hotelier-Vereinigung (ÖHV) empfiehlt
ihren Mitgliedern im Rücktrittsfall bis spätestens 1 Monat vor dem
Ankunftstag eine Stornogebühr im Ausmaß des Zimmerpreises für 3
Tage zu berechnen. Wird das vereinbarte Zimmer hingegen kurzfristig
nicht in Anspruch genommen, bleibt der Gast dennoch verpflichtet,
das vereinbarte Entgelt, abzüglich ca 30% für Verpflegung oder des
durch anderweitige Vermietung der bestellten Räume erlangten Betrages,
zu bezahlen. In der Praxis agieren Hoteliers meist aber zurückhaltender,
wenn es sich um Stornoforderungen gegenüber Einzelreisenden handelt,
denn der Gast soll für die Zukunft nicht verloren gehen. | (Pauschal)Reiseveranstaltungsvertrag |
§ 7 KSchG: Es handelt sich um ein
richterliches
Mäßigungsrecht” in sinngemäßer Anwendung des § 1336 Abs
2 ABGB”, wenn ein Verbraucher dem Unternehmer ein Reugeld zu entrichten hätte.
– Das gilt nach hA auch für das Angeld. | |
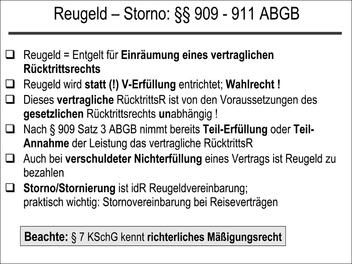 | Abbildung 15.3: Reugeld-Storno: §§ 909-911 ABGB |
|
3. Die
Konventionalstrafe des § 1336 ABGB | |
 | |
Es
existieren einige Synonyma –Vertrags- oder Konventionalstrafe, Pauschale oder Pönale. | Terminologie |
Das ABGB spricht – korrekt – von Vergütungsvertrag,
in welchem ein Vergütungsbetrag festgesetzt wird.
Es handelt sich daher nicht, wie immer wieder behauptet, um ein
Redaktionsversehen! | |
 | |
Die Konventionalstrafe wird vom Schuldner dem Gläubiger
für den Fall des: | |
| • „entweder gar
nicht oder | |
| •
nicht auf gehörige Art oder zu
spät erfüllten” Vertrags versprochen; | |
| • und zwar als bestimmter Geldbetrag „anstatt
des zu vergütenden Nachteils”; sog pauschalierter Schadenersatz.
Der im Vergütungsvertrag vereinbarte Vergütungsbetrag
tritt also an die Stelle des zu entrichtenden Schadenersatzes wegen
Nicht- oder Schlechterfüllung, nicht aber an die Stelle der geschuldeten
Leistung. – Vgl den folgenden Punkt. | |
Auch der Gesetzgeber bedient sich unserer
Rechtsfigur; etwa in § 29 Abs 2 KSchG: Danach kann ein Unternehmer die
Klage einer Verbraucherschutzorganisation abwenden, wenn er eine
durch Konventionalstrafe abgesicherte Unterlassungserklärung abgibt → KAPITEL 6: Zur
Inhaltskontrolle. | |
Die Entrichtung der Konventionalstrafe befreit den Schuldner
aber nicht von der Vertragserfüllung; es wäre denn anders vereinbart.
Vielmehr kann die Konventionalstrafe, insbesondere wenn sie für die
Nichteinhaltung der Erfüllungszeit (Verzug) versprochen wurde, neben der
(nachzuholenden) korrekten Erfüllung gefordert
werden. | |
Das darf also nicht mit der pauschalierten
Schadenersatzleistung verwechselt werden! Die Pauschalierung erspart aber
uU schwierige, (zeit)aufwendige und kostenintensive Schadensberechnungen.
Man denke an ein Groß(bau)projekt. | |
Der
in der Konventionalstrafvereinbarung (= Vergütungsvertrag) bestimmte Vergütungsbetrag kann
auch höher sein, als der eingetretene Schaden!
– Und ein Schadensnachweis ist keine Voraussetzung
für einen Anspruch nach § 1336 ABGB. Nur die (verschuldete) Verspätung
ist zu beweisen. Das Fehlen eines Schadens ist aber im Rahmen des
richterlichen Mäßigungsrechts zu berücksichtigen; bbl 1999/268.
Die Konventionalstrafe soll nämlich auch die teure und zeitaufwendige
Schadensfeststellung ersparen! – Ist der eingetretene Schaden größer,
als die vereinbarte Konventionalstrafe, kann nur die
Konventionalstrafe gefordert werden; arg: „anstatt des zu vergütenden
Nachteils ...” – Anders wiederum das Handelsrecht: Art 8 Nr 3 EVHGB. | |
Die
Konventionalstrafe setzt nach nunmehr gesicherter hA Verschulden voraus.
Verschuldensfreiheit müsste vereinbart werden. Vgl dazu → Die
Konventionalstrafe des § 1336 ABGB:
Systematische Interpretation! – Mitverschulden (§
1304 ABGB) des Geschädigten mindert die Konventionalstrafe. | |
§ 1336
Abs 2 ABGB kennt ein richterliches Mäßigungsrecht,
„wenn [sie] vom Schuldner als übermäßig erwiesen wird [= Beweislast!]”.
– Keiner richterlichen Mäßigung unterliegt die Konventionalstrafe,
die ein Vollkaufmann versprochen hat (§§ 348, 351
HGB); aber auch hier erfolgt eine Überprüfung auf Sittenwidrigkeit:
§ 879 ABGB. Die Konventionalstrafe soll nämlich nicht existenzzerstörend,
sondern bloß erfüllungssichernd wirken. Die von einem Minderkaufmann versprochene
Konventionalstrafe kann jedoch gemäßigt werden; SZ 54/186 (1981):
Die Beweislast trifft aber den Minderkaufmann. | Richterliches
Mäßigungsrecht |
Nach § 38 AngG unterliegen zwischen Arbeitgebern
und Angestellten vereinbarte Konventionalstrafen – ohne weitere
Einschränkung – dem richterlichen Mäßigungsrecht. | |
Sicherungsrechte
wie die Konventionalstrafe erlöschen nach § 1378 ABGB im Falle einer Novation ( → KAPITEL 7: Novation
oder Neuerungsvertrag),
„wenn die Teilnehmer nicht durch ein besonderes Einverständnis hierüber
etwas anderes festgesetzt haben”. | |

|
EvBl
1977/83 (Zum Wesen der Konventionalstrafe):
Unter einer Vertrags- oder Konventionalstrafe iSd § 1336 ABGB ist
eine Leistung zu verstehen, die der Schuldner dem Gläubiger für
den Fall der Nichterfüllung oder der nicht gehörigen Erfüllung verspricht.
Sie hat den Zweck, Nachteile auszugleichen, die dem Gläubiger aus
der Vertragsverletzung entstehen (können). Die Vertragsstrafe ist
pauschalierter Schadenersatz, welcher an die Stelle des Schadenersatzes
wegen Nichterfüllung oder Schlechterfüllung tritt. | |
|
|
|
JBl 1950, 241 und 7 Ob 591/76:
Eine Konventionalstrafe ist im Zweifel – also dann,
wenn die Parteien nichts anderes vereinbart haben – nur
bei verschuldeter Nichterfüllung oder bei verschuldeter Schlechterfüllung zu
bezahlen. | |
|
|
|
bbl 1999/268: Der Käufer (Bkl)
eines Dachbodens hatte sich 1989 dem Verkäufer (Kl) gegenüber zur
Zahlung einer verschuldensunabhängigen Konventionalstrafe von täglich
1.000 S verpflichtet, wenn der von ihm geplante Dachbodenausbau nicht
bis 31.10.1991 fertiggestellt sei. Die Fertigstellung erfolgte am 31.3.1994.
Der OGH sprach dem Kläger – unter Anwendung des richterlichen Mäßigungsrechts
– zwei Drittel des vereinbarten Pönalebetrags zu, wenngleich durch
die Verzögerung der Bauführung niemandem ein materieller Schaden
entstanden war. Nach dem OGH soll die Konventionalstrafe nicht nur
den schwierigen Schadensnachweis ersetzen, sondern auch für den
nötigen Erfüllungsdruck sorgen. Der OGH hält es auch für gerechtfertigt,
durch eine Komventionalstrafe ständigem Ärger und Verdruss durch
die Bauführung entgegenzuwirken. | |
|
 | |
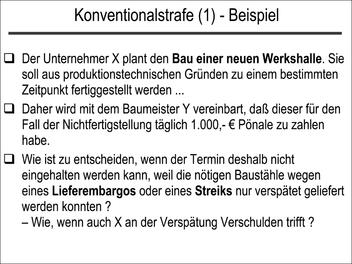 | Abbildung 15.4: Konventionalstrafe (1) |
|
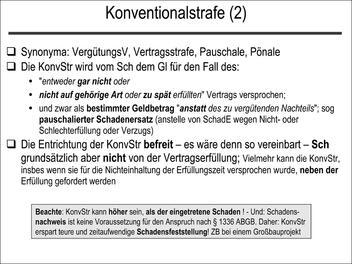 | Abbildung 15.5: Konventionalstrafe (2) |
|
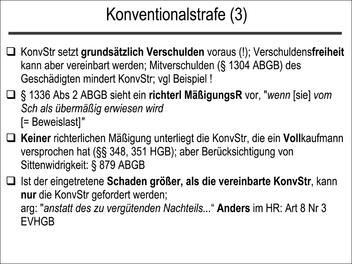 | Abbildung 15.6: Konventionalstrafe (3) |
|
| |
Wertsicherungen
sind ein altes und bewährtes Sicherungsmittel, mögen sich auch ihre
Formen im Laufe der Zeit stark verändert haben. Heute stehen verschiedene
Indexsicherungen im
Vordergrund, während früher auf verschiedene preislich stabile (Grund)Nahrungsmittel
– wie den Brot-, Mehl- oder Getreidepreis – Bezug genommen wurde.
– Ein Wertsicherungsbedürfnis besteht bei lang-
oder doch längerfristig angelegten Rechtsbeziehungen insbesondere
Dauerrechts- und Dauerschuldverhältnissen wie Bestandverträgen,
Darlehen, Krediten, Factoring, Franchising oder Leasing, Gutsübergabs-
oder Leibrentenverträgen. | Wertsicherungsbedürfnis |
| |
Wertsicherungen
spielen also insbesondere bei immer wieder zu entrichtenden – zB
Miet- oder Pachtzins – oder erst mittel- bis langfristig zurückzuzahlenden Geldschulden eine
Rolle. | Geldschulden |
Zur wichtigen Unterscheidung in
Geldbetrags-
und
Geldwertschulden
→ KAPITEL 7: Geldbetrags-
und
Geldwertschulden .
Zu erinnern ist daran, dass „normale” Geld(betrags)schulden nicht
aufzuwerten, also zum Nennbetrag zu erfüllen sind. | |
Der Zweck der (Wertsicherungs)Vereinbarung liegt
darin, den vereinbarten inneren (Geld)Wert auch für die Zukunft
zu erhalten. Wertsicherungsklauseln werden in Verträge aufgenommen,
um gegen Geldwertschwund / Kaufkraftverlust (Inflation) vorzusorgen.
– Dadurch wird das Inflationsrisiko vom Gläubiger auf den Schuldner verlagert. | Zweck |
Üblich
sind heute Indexklauseln; zB werden häufig der
Verbraucherpreis- oder Lebenshaltungskostenindex vereinbart; aber
auch der Großhandels- oder Baukostenindex. Ihre Verlautbarung erfolgt
in Zeitungen, Fachzeitschriften und diversen Homepages. |
Indexklauseln |
Tabelle: Beispiel
einer Wertsicherungsberechnung | |
Beispiel einer Wertsicherungsberechnung | Monat | Jahr | Indexzahl | Erhöhung in Prozent | Wertgesichterter Betrag | | Jänner | 1973 | 134,1 | 0,0 % | 8000.0 | | November | 1973 | 142,3 | 6,1 % | 8488.0 | | Juni | 1974 | 151,0 | 6,1 % | 9005.8 | | Februar | 1975 | 160,0 | 6,0 % | 9546.1 | | Jänner | 1976 | 169,9 | 6,2 % | 10138.0 | | November | 1976 | 178,5 | 5,1 % | 10655.0 | | Jänner | 1978 | 188,8 | 5,8 % | 11273.0 | | Juli | 1979 | 199,7 | 5,8 % | 11926.8 | | Mai | 1980 | 209,7 | 5,0 % | 12523.1 | | Februar | 1981 | 221,0 | 5,4 % | 13199.3 | | Jänner | 1982 | 233,2 | 5,5 % | 13925.3 | | Juli | 1983 | 245,9 | 5,4 % | 14677.3 | | März | 1984 | 258,5 | 5,1 % | 15425.8 | | Jänner | 1986 | 272,7 | 5,5 % | 16274.2 | | März | 1989 | 286,4 | 5,0 % | 17087.9 | | Juli | 1990 | 300,9 | 5,1 % | 17959.4 | | Februar | 1992 | 317,5 | 5,5 % | 18947.2 | | Juli | 1993 | 335,8 | 5,8 % | 20046.1 | | Juli | 1995 | 353,0 | 5,1 % | 21068.5 | | Februar | 2000 | 372,0 | 5,4 % | 22206.2 |
| |
Verbraucherpreisindex 66 (1966 = 100) – Ausgangsbasis:
Jänner 1973: 134.1 Punkte – Basiswert (des Mietzinses): 8000 Schilling
– 5.0 Prozent Klausel: Erhöhung gegenüber jeweiliger Ausgangsbasis | |
Wertsicherungsklauseln
müssen bestimmt oder doch bestimmbar vereinbart
werden. Die Rspr lehnt nach wie vor das Verbüchern von Wertsicherungsklauseln
uH auf § 14 Abs 1 Satz 1 GBG (Spezialitätsgrundsatz) ab. (?) Hypothekarforderungen
können daher bis heute nicht wertgesichert werden, eine Meinung,
die nicht überzeugt; eine Ausnahme besteht nur für Höchstbetragshypotheken → KAPITEL 2: Ausnahmen
vom Spezialitätsgrundsatz. | Bestimmtheitserfordernis |

|
Vgl EvBl 2000/53: OGH lässt offen,
ob nicht in derartigen Fällen eine Höchstbetragshypothek begründet werden
kann. | |
|
Zur konkreten Berechnung und möglichen Zweifelsfällen
vgl die folgenden Folien: | |
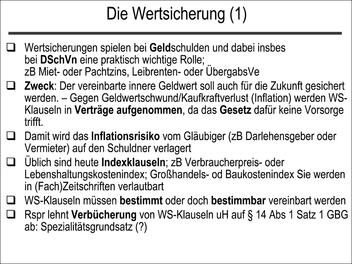 | Abbildung 15.7: Wertsicherung (1) |
|
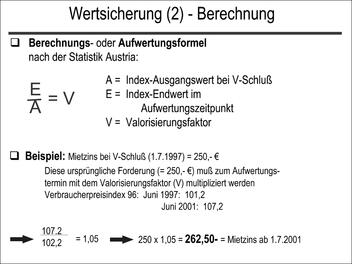 | Abbildung 15.8: Wertsicherung (2) – Berechnung |
|
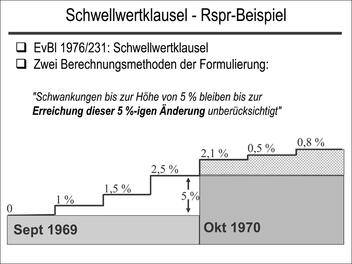 | Abbildung 15.9: Schwellwertklausel – Rspr-Beispiel (1) |
|
Definition: Nichtberücksichtigung
von Indexschwankungen bis zu einer bestimmten Höhe; zB bis 5 %. |
Schwellwertklausel: Vertragsauslegung |
 | |
Streitpunkt: Ist der monatliche
Leibrentenbetrag ab erstmaliger Überschreitung der 5 %- Schwelle
ständig der jeweiligen Indexbewegung anzupassen oder bleibt er solange
gleich, bis die Indexerhöhung neuerlich 5 % übersteigt? | |
Das Erstgericht gab dem Klagebegehren statt:
Weil sich „schon aus dem Wortlaut ergebe, daß die Wertsicherung voll
zum Zuge kommen solle, wenn die Wertschwankung 5 % ... überschreite”. | |
Das Berufungsgericht wies das Klagebegehren
ab: Weil der Vertragstext „nur dahin verstanden werden [könne], daß
auch wiederholte Schwankungen unterhalb der 5 %-Schwelle unberücksichtigt
bleiben sollen”. | |
Der OGH schloß sich der Rechtsmeinung des
Berufungsgerichts an – Argumente: „Die praktische Bedeutung der sog
Schwellwertklausel liegt ... darin, daß sie die Vertragspartner
von der Notwendigkeit ständiger Werterhöhungsberechnungen befreit
...” – Eine „fortlaufend wirkende Sprungklausel”
entspricht durchaus dem Parteiwillen, wenn bei Vertragsschluss ohnehin
mit der Erhöhung der Indexzahlen zu rechnen war. | |
| |
Kautionen dienen
der Sicherstellung eines Vertragsteils – zB des
Vermieters im Mietrecht, der dadurch gegen Mietzinsrückstände oder
Sachschäden am Bestandobjekt, die durch den Mieter verursacht wurden,
gesichert werden soll. Der Mieter hat den vereinbarten Betrag –
idR schon bei Vertragsabschluss – beim Vermieter zu hinterlegen. | |
Praktisch wichtig ist es, sich nicht nur
die Leistung des Kautionsbetrags bestätigen zu lassen, sondern für
sich auch den Zustand der Wohnung bei Bezug und Auszug – zB durch
Fotos, Notizen, Zeugen – zu dokumentieren. Dadurch kann bei Auflösung
des Vertrags Streit um die Kaution vermieden werden; denn dies verhindert,
dass ihnen als Mieter Schäden zugerechnet werden, die bereits beim
Bezug der Wohnung existierten. Ratsam erscheint es ferner den Zeitpunkt
/ -raum der Rückzahlung vertraglich festzulegen; zB: „binnen 1 Monats”
oder noch besser „Zug um Zug bei Schlüsselübergabe”. – Mit Kautionen
wird nämlich häufig Schindluder getrieben! | |
Streitig war lange, ob
die Kaution vom Vermieter angemessen zu
verzinsen ist, was die Rspr nunmehr verlangt; vgl JBl 1987,
248: Verzinsung + jährliche Rechnungslegung und OGH 8 Ob 622/89. | Verzinsung |
Von Bedeutung ist
die Kaution auch im Arbeitsrecht, wo sie der Sicherung
des Arbeitgebers gegen allfällige, ihm aus dem Arbeitsverhältnis
zustehende, Schadenersatzansprüche gegen den Arbeitnehmer dient.
Missbräuchen will das
KautionsschutzG, BGBl 1937/229 idgF
begegnen: Danach bleibt die Kaution im Eigentum des Arbeitnehmers
und ist zu verzinsen; Schriftform ist vorgeschrieben; Rückstellung
binnen 4 Wochen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses, wenn kein Ersatzanspruch
erhoben wird; dem Gesetz widersprechende Vereinbarungen sind nichtig
usw. | KautionsschutzG |
 | |
IV. Die
Bürgschaft: §§ 1346 ff ABGB | |
| |
Vgl dazu das diesem Kapitel vorangestellte Motto
des § 1373 ABGB. Daraus ist – nach Meinung der ABGB-Redaktoren –
die Nachrangigkeit der Bürgschaft als Sicherungsmittel gegenüber
dem Pfand zu entnehmen. | |
Während durch Pfandbestellung dingliche
Sicherheit erlangt wird – zB ein Ring oder eine Liegenschaft werden
verpfändet, gewährt die Bürgschaft bloß eine persönliche
Sicherheit. Dies dadurch, dass der Bürge dem Gläubiger persönlich
dafür einsteht, dass dieser die ihm vom Schuldner versprochene Leistung
erhält: Wenn schon nicht vom Schuldner selbst, dann wenigstens vom
Bürgen. – Das Rechtsband zwischen Gläubiger und Bürgen – sie schließen
den Bürgschaftsvertrag (!) – ist zwar nur ein schuldrechtliches;
es schafft aber dennoch hohe Sicherheit. Denn Bürge oder Bürgin
haften mit ihrem gesamten Vermögen; persönliche Haftung. (Nach dem
ABGB haftet aber auch der Pfandschuldner, der das Pfand bestellt,
neben dem Pfand persönlich → Persönliche,
dingliche und beschränkte Haftung:
Persönliche und dingliche Haftung.) Und als Bürge/in werden idR
Personen herangezogen, die über ein entsprechendes Vermögen verfügen,
sonst hätte es wenig Sinn, einen Bürgschaftsvertrag zu schließen. | |
| |
Im
Mittelalter entstand daher das Rechtssprichwort:
Bürgschaft ist besser als Pfand.
– Vgl allerdings die im Gegensatz zu dieser Wertung stehende Aussage
des § 1373 ABGB. – Der Volksmund meint aber auch:
Wer borgt – dies iSv: kreditiert
– ohne Bürgen und Pfand, dem sitzt ein Wurm im
Verstand. | |
Der Gläubiger
erlangt bei der Bürgschaft Sicherheit dadurch, dass ein – bisher
am Schuldverhältnis nicht beteiligter – Dritter sich für den Schuldner
verpflichtet; § 1343 ABGB. § 1344 ABGB ist zu entnehmen, dass die
Bürgschaft nur eine von mehreren persönlichen Sicherstellungsmöglichkeiten durch
Dritte ist; daneben nennt das Gesetz die privative Schuldübernahme
und den Schuldbeitritt; beide → KAPITEL 14: Der
Schuldnerwechsel. | Sicherheit des
Gläubigers |
§ 1346 Abs 1 ABGB umschreibt die Bürgschaft:
„Wer sich zur Befriedigung des Gläubigers auf den Fall verpflichtet, dass
der erste Schuldner die Verbindlichkeit nicht erfülle,
wird ein Bürge, und das zwischen ihm und dem Gläubiger getroffene
Übereinkommen ein Bürgschaftsvertrag genannt. Hier
bleibt der erste Schuldner noch immer der Hauptschuldner, und der
Bürge kommt nur als Nachschuldner hinzu.” | |
§ 1346
Abs 2 ABGB regelt die Bürgschaftsform, die insoferne
eine Besonderheit aufweist, als es sich bei ihr um eine einseitige
Formpflicht handelt; nur die Verpflichtungserklärung des Bürgen unterliegt
ihr. Das soll den Bürgen vor Übereilung schützen und dient beiden
Vertragsteilen als Beweismittel und damit auch ihrer Rechtssicherheit.
– Im Vergleich dazu ist die Pfandrechtsbegründung nicht formpflichtig,
aber der Pfandvertrag ist ein Realvertrag: § 1368 ABGB. | |
Die
Bürgschaft war schon dem griechischen und römischen Recht bekannt;
Stipulationsbürgschaft; sponsio, fidepromissio, fideiussio. Das
Eintreten eines Dritten in das Schuldverhältnis war im römischen
Recht aber noch nicht so einfach wie heute. Während § 1349 ABGB
bestimmt: „Fremde Verbindlichkeiten kann ohne Unterschied des Geschlechtes
jedermann auf sich nehmen, dem die freie Verwaltung seines Vermögens
zusteht”, war das römische Recht solchen Interzessionen gegenüber
– insbesondere solchen von Frauen – zurückhaltender. Das Senatusconsultum
Vellaeanum (~ 46 n.C.) untersagte Frauen die Interzession,
worunter neben der Übernahme einer Bürgschaft auch noch die Bestellung
eines Pfandes, der Schuldbeitritt, die Schuldübernahme und Geschäftsabschlüsse
im eigenen Namen aber im Interesse eines andern – sog Strohmanngeschäfte
– verstanden wurden. Das römische Recht gewährte der in Anspruch
genommenen Frau die exceptio Senatus Consulti Vellaeani. – Der Sinn
des Passus in
§ 1349 ABGB „ohne Unterschied des Geschlechtes”
ist heute nur verständlich, wenn der aufgezeigte rechtsgeschichtliche
Zusammenhang bekannt ist. | |
Zum Begriff Interzession: I. oder interzedieren,
lat intercedere, meint – dazwischentreten, vermitteln. Intercedere bedeutet
für jemanden eintreten, für ihn einspringen, rechtlich, sich für
ihn verbürgen. – Das bürgerliche Recht meint damit das Eingehen
rechtlicher Verbindlichkeiten für jemand anderen, also in fremdem
Interesse. Wobei dieses Eintreten dem Gläubiger größeren Schutz
gewähren, ihn also rechtssichern soll. | |
Eine Bürgschaft zu übernehmen, will gut überlegt sein! Denn
daraus kann viel Unglück entstehen. Manche Freundschaft, Ehe und
Beziehung sind daran zerbrochen. Die Bitte, zB für einen Kredit
zu bürgen, setzt immer wieder vor allem im Kreis der Verwandtschaft
nahestehende Personen unter Druck. Eine unüberlegte Unterschrift
hat aber schon viele Bürgen in den finanziellen Ruin geführt. Schon
die alten Griechen warnten davor, Bürgschaften zu übernehmen; „Übernimm
eine Bürgschaft und du bist ruiniert“. – Dazu kommt: Schon die einfache Bürgschaft ist
nach unserem Privatrecht streng ausgestaltet; der Schutz
des Bürgen nach dem Gesetz ist minimal.
Der Gläubiger muss den Schuldner nur erfolglos gemahnt, ihn also
nicht etwa geklagt oder gar gegen ihn Exekution geführt haben, um
auf den Bürgen greifen zu können! Die Subsidiarität der Bürgenhaftung besitzt
also keine nennenswerten praktischen Konsequenzen und bietet insbesondere
keinen wirklichen Schutz! | |
Milder, nämlich unserer Ausfalls- oder Schadlosbürgschaft
entsprechend, ist die einfache Bürgschaft nach dem dtBGB ausgestaltet → Arten
der Bürgschaft
| |
Dazu kommt, dass ein Bürge beim Eintritt von Zahlungsschwierigkeiten
des Schuldners nur begehren kann, dass der Schuldner dem Gläubiger
Sicherheit leiste, nicht aber, dass ihm (dem Bürgen) der Schuldner
eine Sicherstellung für seinen Rückgriffsanspruch einräume; SZ 27/125 (1954):
Bürgschaft in Form einer Wechselunterfertigung. | |
2. Riskante
Bürgschaften – Angehörigenbürgschaften | |
Zur
Frage unter welchen Voraussetzungen sog Angehörigenbürgschaften
oder überhaupt riskante Bürgschaften sittenwidrig sind vgl JBl 1998,
778 (Angehörigenbürgschaft mwH) und SZ 68/64 (1995) = JBl 1995,
651 (Mader): riskante Bürgschaft. | |
Zur
Angehörigenbürgschaft führte der OGH aus, dass Sittenwidrigkeit dann
anzunehmen sei, wenn folgende Voraussetzungen (kumulativ) vorliegen: | |
| •
Inhaltliche Missbilligung
des Interzessionsvertrags, | |
| • Missbilligung der Umstände seines Zustandekommens infolge
verdünnter Entscheidungsfreiheit des Interzedenten (= Bürgen), und
schließlich | |
| • die Kenntnis oder fahrlässige
Unkenntnis dieser Kriterien durch den Kreditgeber. | |
Die Sittenwidrigkeitsprüfung
einer Angehörigenbürgschaft orientiert sich wertungsmäßig zutreffend
am Wucherverbot des § 879 Abs 2 Z 4 ABGB ( → KAPITEL 11: Die
Beispiele des § 879 Abs 2 ABGB),
von dessen cleverer und handhabbarer Regelung bislang zu wenig Gebrauch
gemacht wurde. Der OGH betont daher auch, dass die die Inhaltskontrolle
auslösenden Umstände stets ein krasses Missverhältnis (Gschnitzer)
des Haftungsumfangs und der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit
des Interzedenten zur Voraussetzung hätten. Bei der Sittenwidrigkeitsprüfung
solcher Bürgschaften übernahm der OGH weitgehend die Grundsätze
der dtRspr; vgl die Hinweise in SZ 68/64 (1995). | |
Die Hereinnahme von Willburgs beweglichem
Systemdenken in die Rspr erscheint dagegen als überflüssige captatio benevolentiae
und der Sache nicht dienlich. | |
Abweichend von den für die allgemeine Angehörigenbürgschaft
gehandhabten Grundsätzen behandelt der OGH Bürgschaften zugunsten
von erwachsenen Geschwistern: | |

|
| |
|
|
|
OGH 11. 5. 2000, 8 Ob 253/99k, SZ 73/79 = EvBl 2000/197:
Der Bruder des Hauptschuldners wird von Gläubigerbank zu Bürgschaft
überredet. – OGH nimmt (noch vor Inkrafttreten des § 25 d KSchG)
erstmals zur Frage der Teilnichtigkeit solcher Bürgschaftsverträge bei
Sittenwidrigkeit wegen krassem Missverhältnis zwischen Haftungsumfang
und wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit des Bürgen Stellung. Er bejaht
diese, wenn eine Interessenabwägung ergibt, dass die reduzierte
Bürgschaft für den Gläubiger nicht sinnlos ist. OGH wies zurück
an die Vorinstanz. | |
|
 | |
3. Die
Bürgschaft als Sicherungsgeschäft | |
Die
Bürgschaft ist Sicherungsgeschäft. Als Rechtsinstitut dient sie
der Sicherung fremder Forderungen. Die Bürgschaft entsteht durch
Bürgschaftsvertrag zwischen Gläubiger und Bürgen. Der Bürge verpflichtet
sich darin nach § 1346 Abs 1 ABGB „zur Befriedigung des Gläubigers
auf den Fall, daß der Schuldner die Verbindlichkeit nicht erfülle”. | |
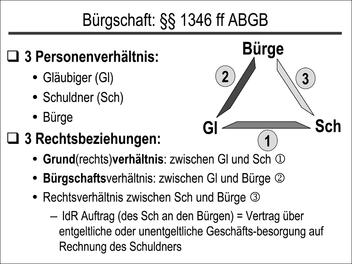 | Abbildung 15.10: Bürgschaft: §§ 1346 ff ABGB |
|
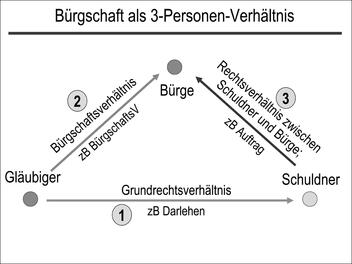 | Abbildung 15.11: Bürgschaft als 3-Parteien-Verhältnis |
|
Der Bürge haftet persönlich; dh mit seinem
ganzen Vermögen. Es könnte aber vereinbart werden, dass nur bis
zu einem Höchstbetrag, also betragsbeschränkt gehaftet wird; zB
bis 100.000 ı. | Haftung des
Bürgen: persönlich + subsidiär + akzessorisch |
Der
Bürge haftet subsidiär, also nachrangig. Gemeint
ist damit: nach dem Schuldner. Allein diese Nachrangigkeit ist im
ABGB – wie erwähnt – nur schwach ausgebildet. Nach § 1355 ABGB kann nämlich
der Bürge schon „dann belangt werden, wenn der Hauptschuldner auf
des Gläubigers gerichtliche oder außergerichtliche Einmahnung seine
Verbindlichkeit nicht erfüllt hat”. – Dh nichts anderes als: Der
Gläubiger braucht den Schuldner nur zu mahnen und kann dann umgehend –
dh: wenn er nicht am Tag nach dem Zugang der Mahnung gezahlt hat
– auf den Bürgen greifen. Der Gläubiger muss also nach ABGB (auch
bei der einfachen Bürgschaft) den Schuldner weder klagen oder gar
Exekution geführt haben! | |
Anders
das dtBGB, das in § 771 dem Bürgen die Einrede
der Vorausklage gewährt, also einen stärkeren Schutz des
Bürgen kennt. | |
Der Bürge haftet akzessorisch: Dh, dass
die Bürgschaftsschuld vom Bestand der Hauptschuld abhängig ist.
Erlischt die Hauptschuld, erlischt – auf Grund der dann nicht mehr
bestehenden Akzessorietät – auch die Bürgschaftsschuld. | |
| |
Was
geschieht, wenn der Bürge, vom Gläubiger in Anspruch genommen, zahlt?
Die Antwort enthält § 1358 ABGB, dessen Satz 1 bestimmt: |
Legalzession
des
§ 1358 ABGB |
”Wer eine fremde [!] Schuld bezahlt, für
die er persönlich oder mit bestimmten Vermögensstücken haftet, tritt
in die Rechte des Gläubigers und ist befugt, von dem Schuldner den
Ersatz der bezahlten Schuld zu fordern.” | |
Das bedeutet den Eintritt des Bürgen in die Gläubigerposition
von Gesetzes wegen, also automatisch. | |
Man vergleiche damit § 1422
ABGB: | §
1358 <-> § 1422 ABGB |
”Wer die Schuld eines anderen, für die er nicht
haftet..., bezahlt, kann ... vom Gläubiger die Abtretung
seiner Rechte verlangen.” | |
Hier
erhält man also die Gläubigerstellung nicht wie in § 1358 ABGB automatisch!
Die Abtretung muss verlangt werden ! – Nach § 1358
Satz 2 ABGB muss der befriedigte Gläubiger den zahlenden Bürgen
„alle vorhandenen Rechtsbehelfe und Sicherungsmittel” herausgeben;
zB Rechnungen, Verträge oder sonstige Aufzeichnungen. | |
Graphisch sieht der geschilderte Vorgang der Legalzession
folgendermaßen aus: | |
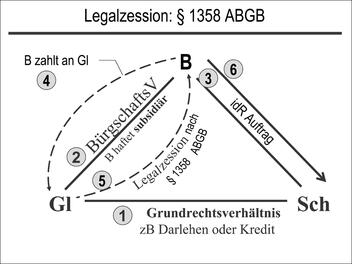 | Abbildung .11: Legalzession: § 1358 ABGB |
(1) Grundverhältnis zwischen Gläubiger und Schuldner;
zB auf Grund eines gegebenen Darlehns. |
(2) Zwischen Gläubiger und Bürgen wird ein Bürgschaftsvertrag
geschlossen. |
(3) In der Folge zahlt der Schuldner nicht. Die Haftung
des Bürgen wird ausgelöst / fällig. |
(4) Aus dem Bürgschaftsvertrag heraus resultiert die Verpflichtung
des Bürgen, im Bedarfsfall an den Gläubiger zu zahlen. |
(5) Die Rechte des (Alt)Gläubigers gehen kraft Gesetzes,
also automatisch auf den Bürgen über. Der Bürge wird neuer Gläubiger
des Schuldners. |
|

|
EvBl 2000/105: Zum Rückgriffsanspruch
des Interzedenten – Der Anspruch aus § 1358 ABGB besteht unabhängig
davon, ob die Interzession mit Willen des Schuldners erfolgt ist
oder nicht. Der Bürgschaftsvertrag wird zwischen dem Bürgen und
dem Gläubiger geschlossen. | |
|
| |
Gesetz
und Praxis kennen ganz unterschiedliche Bürgschaftsarten, die spezifischen
Zwecken dienen: | |
| • Einfache / normale
Bürgschaft | |
| • Bürge und Zahler | |
| • Handelsbürgschaft | |
| • Ausfalls- oder Schadlosbürgschaft | |
| • Mitbürgschaft | |
| • Bürgesbürgschaft, Nach- oder Afterbürgschaft | |
| • Entschädigungsbürgschaft | |
| • Zeitbürgschaft | |
| • Ausgleichsbürgschaft | |
| • Wechsel- und Scheckbürgschaft. | |
„Bürge und
Zahler”-Haftung: § 1357 ABGB | |
In der Praxis ist diese Form der Bürgen(haftung) die übliche
und von größter Wichtigkeit. Sie spielt eine bedeutendere Rolle
als die einfache Bürgschaft. – Hier haftet der Bürge: | |
| •
primär,
also nicht bloß subsidiär. Und dies nach Wahl des Gläubigers; §
1357 ABGB: | |
„Es hängt von der Willkür des Gläubigers
ab, ob er zuerst den Hauptschuldner oder den Bürgen oder beide zugleich belangen
wolle.” | |
| • ... aber auch akzessorisch,
was meint: Auch diese Form der Bürgschaft ist vom Weiterbestand der
gesicherten Forderung (also des Grundverhältnisses zwischen Gläubiger
und Schuldner) abhängig. | |
§ 349 HGB bestimmt,
dass ein Bürge, „für den die Bürgschaft ein Handelsgeschäft ist,
... als Bürge und Zahler nach § 1357 [ABGB]” haftet. – § 350 HGB
ergänzt: | |
„Auf eine Bürgschaft, die auf der Seite
des Bürgen ein Handelsgeschäft ist, sind die Formvorschriften des
§ 1346 Abs 2 [ABGB] nicht anzuwenden.” | |
Die
Verpflichtungserklärung des kaufmännischen Bürgen wird daher auch
mündlich gültig abgegeben. – § 351 HGB stellt klar, dass die Regeln
der Handelsbürgschaft nur für Vollkaufleute gelten. | |
Die Haftung nach bürgerlichem Recht ist
dagegen grundsätzlich, also wenn nichts anderes vereinbart wurde,
eine anteilige. | |
Nach § 1356 ABGB
verbürgt sich der Bürge „ausdrücklich nur für den Fall ..., daß
der Hauptschuldner zu zahlen unvermögend sei”. – Hier muss der Gläubiger
seinen Schuldner zuerst geklagt und (!) zusätzlich (vergeblich)
Exekution geführt haben, ehe er auf den Bürgen greifen kann. Nur was
auch dann vom Schuldner nicht hereinzubringen ist, kann vom Bürgen
verlangt werden! Bei dieser Bürgschaftsform ist der Schutz des Bürgen
wesentlich größer. | Ausfalls- oder
Schadlosbürgschaft |
Eine Ausnahme statuiert das Gesetz im Falle
des Konkurses oder des unbekannten Aufenthalts des Schuldners. – Diese
Form der ABGB-Bürgschaft entspricht § 771 dtBGB: Die deutsche Normal-Bürgschaft
entspricht also nach österreichischem Verständnis der Ausfallsbürgschaft! | |
| |
Sie haften
nach § 1359 Satz 1 ABGB nebeneinander; und zwar solidarisch. Dh
jeder Mitbürge haftet für die ganze Schuld; Motto: „Alle für einen,
einer für alle.” Diese gängige und knappe Formulierung stammt aus
dem ALR! – Ein Rückgriffsrecht des in Anspruch genommenen Mitbürgen besteht
nach § 1358 ABGB sowohl gegen den Schuldner, als auch gegen nicht
in Anspruch genommene Mitbürgen. | |
Dabei
übernimmt der Bürge die Haftung bloß für einen im Vorhinein bestimmten
Zeitraum. Nur innerhalb dieses Zeitraums kann ihn der Gläubiger
in Anspruch nehmen. Diese Bürgschaftsform kommt in der Praxis zB
zur Sicherung von Kontokorrentkrediten vor. | |
Die Bürgesbürgschaft wird
auch Nach- oder Afterbürgschaft genannt. Bei ihr verbürgt sich der Bürge
dem Gläubiger gegenüber für den Hauptbürgen. | |
Vgl damit die Rückversicherung im Vertragsversicherungsrecht! | |
Von der Bürgesbürgschaft ist die
Entschädigungsbürgschaft zu
unterscheiden. Der Entschädigungsbürge verspricht dem Bürgen, ihn
schadlos zu halten, falls dieser von Gläubiger auf Grund seiner
Bürgschaft in Anspruch genommen wird. | Bürgesbürgschaft
und Entschädigungsbürgschaft |
Sie dient der
Verbürgung für im Ausgleich oder in einer Zwangsvollstreckung übernommene
Verbindlichkeiten des Ausgleichsschuldners; vgl § 156a KO und §
54 AO. | |
Die
Art 30 ff WG kennen eine selbständige wechselrechtliche Bürgschaftsverpflichtung.
Nach ihr haftet der Wechselbürge als Bürge und Zahler, also nicht
nur subsidiär. Diese Bürgschaftsform setzt nur eine formgültige
Erklärung des (Wechsel)Hauptschuldners voraus; ansonsten ist die
Wechselbürgschaft nicht akzessorisch. | |
Inhaltlich dient diese Bürgschaftsform der
zusätzlichen Sicherung der Wechselschuld über den Aussteller, den Akzeptanten
oder allfällige Indossanten hinaus. Sie erfolgt durch eine schriftliche
Bürgschaftserklärung („per Aval”) auf der Wechselurkunde; Art 31
Abs 1 und 2 WG. Eine Unterschrift auf d er Vorderseite des Wechsels,
die nicht die des Ausstellers oder des Bezogenen ist, gilt als Aval;
Art 31 Abs 3 WG. | |
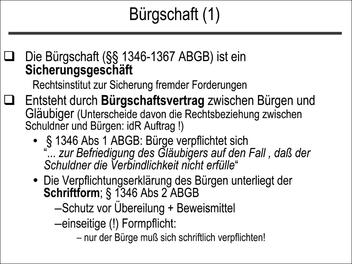 | Abbildung 15.12: Bürgschaft (1) |
|
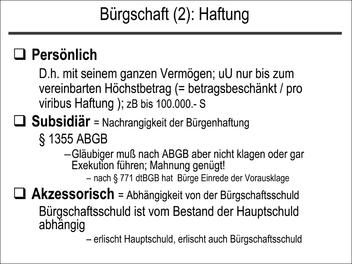 | Abbildung 15.13: Bürgschaft (2) |
|
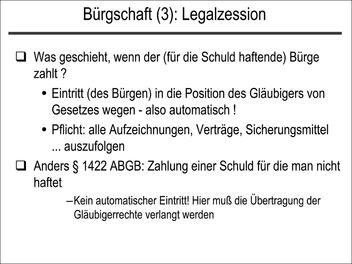 | Abbildung 15.14: Bürgschaft (3) |
|
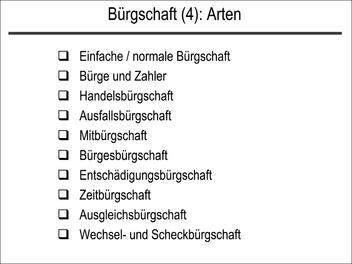 | Abbildung 15.15: Bürgschaft (4) |
|
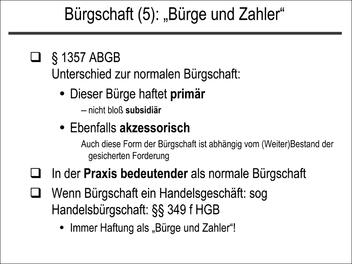 | Abbildung 15.16: Bürgschaft (5) |
|
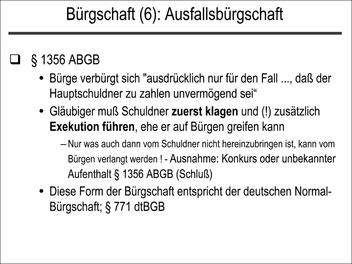 | Abbildung 15.17: Bürgschaft (6) |
|
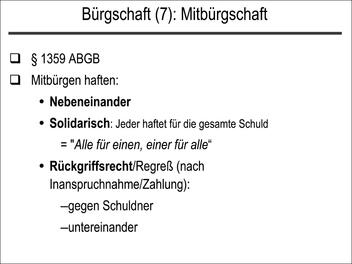 | Abbildung 15.18: Bürgschaft (7) |
|
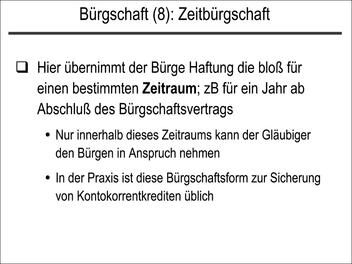 | Abbildung 15.19: Bürgschaft (8) |
|
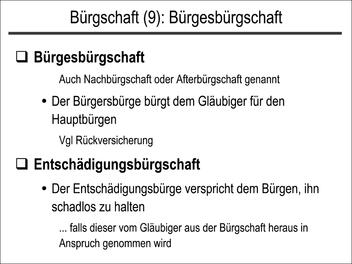 | Abbildung 15.20: Bürgschaft (9) |
|
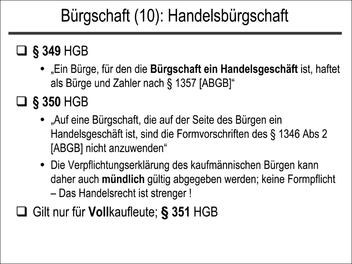 | Abbildung 15.21: Bürgschaft (10) |
|
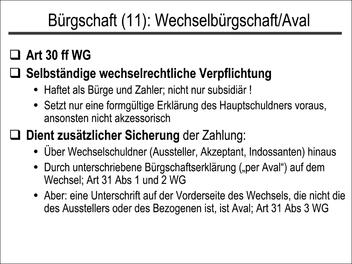 | Abbildung 15.22: Bürgschaft (11) |
|
| |
 Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis |
 B. Dingliche Sicherheiten B. Dingliche Sicherheiten |
| |

