Kapitel 14 | |
| |
 Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis |
 B. Der
Schuldnerwechsel B. Der
Schuldnerwechsel |
| |
|
 | |
I. Zession,
Gläubigerwechsel, Forderungsübergang | |
1. Wirtschaftliche
Bedeutung | |
Wir
haben in Kapitel 8 die Rechtsobjekte oder Sachen besprochen und
im Rahmen der Sacheinteilung gehört, dass Rechte,
also auch Forderungen, nach dem Verständnis des ABGB unkörperliche
Sachen sind; § 292 ABGB. Als Rechte beinhalten Forderungen
aber oft auch einen (übertragbaren) Vermögenswert; Beispiel: Kaufpreis-
oder Werklohnforderung eines Verkäufers oder Werkunternehmers gegen
seine Kundschaft. Durch die Übertragbarkeit von Forderungen vom
bisherigen (alten) auf einen neuen Gläubiger, wird der in der Forderung
steckende Geld- und Sicherungswert in den Wirtschaftsverkehr einbezogen. Offene
Forderungen / Außenstände sind für Kaufleute Kapital, das
sie sowohl zur Bezahlung eigener Schulden wie zur Besicherung allfälliger
von ihnen aufgenommener Kredite verwenden können. Die Zession oder
Forderungsabtretung ermöglicht beides. – Die Zession ist ein wichtiges
Rechtsinstitut des Wirtschaftslebens. | Wozu dienen (offene) Forderungen? |
Zessionen erfolgen entgeltlich oder unentgeltlich;
vgl § 1392 Satz 2 ABGB. | Entgeltliche
und
unentgeltliche Zessionen |
 | |
| |
Abgetreten
werden in der Rechtspraxis aber nicht nur Forderungsrechte aus Kauf-
oder Werkverträgen, sondern bspw auch Gewährleistungs- oder Schadenersatzansprüche.
Mit derart abgetretenen Forderungen kann dann der neue Gläubiger
(Zessionar) zB gegenüber bestimmten Personen aufrechnen oder seinerseits
Schadenersatzansprüche geltend machen, wo er das sonst nicht könnte. | Welche Forderungen werden abgetreten? |

|
So etwa wenn ein Leasinggeber die
ihm gegen den Lieferanten des Leasingobjekts zustehenden Gewährleistungsansprüche
an den Leasingnehmer abtritt, wodurch dieser in die Lage versetzt
wird, allfällig auftretende Mängel selbst geltend zu machen; zum
Leasing: → KAPITEL 5: Leasing: MietSlg 31.165. (Natürlich
ist dabei zu bedenken, ob eine solche Lösung für einen Leasingnehmer
die beste Lösung ist. Aber es kann sinnvoll sein.) | |
|
|
|
Oder: MietSlg 29.124 (OGH 22.6.1977):
Ein WE-Organisator tritt die ihm aus Architekten-,
Bau- und Werkverträgen gegen Professionisten zustehenden Rechte
(insbesondere Gewährleistungs- und Schadenersatzansprüche) an (alle
oder einzelne) Wohnungseigentümer ab. | |
|
| |
2. Die
Lehre von Titel und Modus bei der Zession | |
schuldrechtliches
VerfügungsgeschäftDie Zession wird als schuldrechtliches
Verfügungsgeschäft betrachtet, mittels dessen obligatorische
Rechte übertragen werden. – Allgemein zur Lehre von Titel und Modus → KAPITEL 2: Die
Lehre von Titel und Modus. | |
Darin liegt ein terminologischer Gewaltakt
und eine Systemwidrigkeit obendrein, denn die Lehre
von Titel und Modus dient an und für sich der Übertragung / dem
Erwerb dinglicher (Sachen)Rechte und nicht jener von Schuldrechten.
Der Versuch einer dogmatischen Rechtfertigung liegt darin, die Zession
als Verfügungsgeschäft – wenn auch nur als schuldrechtliches – zu
betrachten. – Es sei aber daran erinnert, dass die Lehre von Titel
und Modus von den Redaktoren des ABGB auch auf das Erbrecht angewandt
wurde, freilich nur deshalb, weil diese das Erbrecht für ein dingliches
Recht hielten und sie die absoluten noch nicht von den dinglichen
Rechten klar trennten → KAPITEL 17: Einweisung
in die Erbschaft ¿ Das Verlassenschaftsverfahren . | |
Wie andere dingliche Rechtsübertragungsakte verlangt auch
die Zession einen gültigen Titel zwischen Zedent
und Zessionar, also einen tauglichen Rechtsgrund, aus dem heraus
das Forderungsrecht an den neuen Gläubiger übertragen wird. – Das
ist idR ein Kauf, Tausch, Darlehen, ein Kredit, eine Schenkung,
treuhändisches Übertragen des Vollrechts ( → Arten
der Zession:
Inkassozession) oder ein Sicherungszweck; etwa bei der Sicherungszession.
Titel einer Zession kann aber auch das Gesetz (Legalzession) oder
ein Richterspruch sein → Die
Legalzession
| |
Wird eine Forderung verschenkt,
kommen die für die Schenkung geltenden Regeln zur Anwendung; dh:
Ohne wirkliche Übergabe (§ 943 ABGB → KAPITEL 3: ¿Wirkliche
Übergabe¿ iSd ABGB und NotZwG)
besteht Notariatsaktspflicht. – „Wirkliche Übergabe” wäre hier die
Verständigung des Schuldners oder das Ausstellen einer eigenen Urkunde
über die Zession, die den Gläubigerwechsel nach außen hin in Erscheinung
treten lässt; Publizität. | |

|
OGH 28. 11. 2000, 1 Ob 147/00z, JBl 2001, 313:
Für die wirkliche Übergabe bei einer schenkungsweisen Zession
einer Forderung (hier: Rückgabeanspruch eines Treugebers
gegen den Treuhänder) genügt die Verständigung des Treuhänders/Zessus
durch den Treugeber/Zedenten. Damit liegt eine formgültige Übergabe
durch Zeichen iSd §§ 943 iVm 427 ABGB vor; ein Notariatsakt nach
§ 1 Abs 1 lit d NotZwG ist nicht nötig. | |
|
Zur
Verwirrung trägt bei, dass im Zessionsvertrag neben dem Titel- oder
Grundgeschäft gleichzeitig ein Verfügungsgeschäft als
Modus steckt. Der Zessionsvertrag enthält also zB auf der einen Seite
– als Titelgeschäft – einen Forderungskauf oder eine Forderungsschenkung
und auf der anderen als Modus (der Übergabe beweglicher körperlicher
Sachen vergleichbar), den rechtlichen Übertragungsakt (für die Forderung)
als taugliche Erwerbungsart. Da diese beiden Rechtsakte zeitlich
und inhaltlich „zusammenrutschen”, werden sie oft nicht unterschieden.
Das ist aber beim Hand- oder Realkauf nicht viel anders → KAPITEL 2: Hand
¿ oder Realkauf. | |
Eine (vorgeschriebene) Form besteht für
Zessionen nicht. Das fördert natürlich die Ununterscheidbarkeit
von Titel und Modus zusätzlich. | |
| |

|
EvBl 1999/170: Abtretung
eines GmbH-Geschäftsanteils – Folgen eines Formmangels
(Notariatsakt). Der Österreichische Wasserwirtschaftsfonds”verkauft” Darlehensforderungen (,
die er zB an Städte oder Gemeinden vergeben hatte,) in der Höhe
von 60 Mrd öS an Kreditinstitute; vgl: Der Standard, 5.11.1996,
S. 19. Der „Kaufpreis” für die 60 Mrd beträgt aber nur zwischen
20 und 30 Mrd, die jedoch dem Verkäufer (= Republik Österreich)
von den Käufern umgehend zu zahlen sind. Das stellt für beide Seiten
einen Vorteil dar. Der Wasserwirtschaftsfonds erhält rasch Bargeld
(statt der Rückzahlungen aus den langfristigen und niedrig verzinsten
Darlehen), die Käufer erwerben Forderungen zu einem günstigen Preis;
zB Abschlag von 40-50%. | |
|
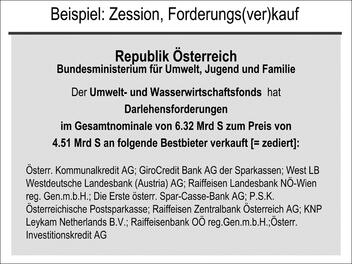 | Abbildung 14.1: Beispiel: Zession, Forderungs(ver)kauf |
|
3. Rechtliches
Grundmuster der Zession | |
Eine Zession erfolgt
nach § 1392 ABGB durch Vertrag zwischen Alt gläubiger
(= Überträger / Zedent) und Neu gläubiger (= Übernehmer
/ Zessionar). Betroffen davon ist eine dritte Person: der (übernommene) Schuldner /
Zessus. | |
Der
Schuldner steht zunächst nur mit dem Altgläubiger in rechtlicher
Beziehung und erhält nun durch die Zession anstelle des alten, einen
neuen Gläubiger. – Bei der Zession kommt es zu einer Änderung
der Rechtszuständigkeit in Bezug auf eine Forderung. Die
Zession ist nach § 1375 ABGB eine Novation → KAPITEL 7: Novation
oder Neuerungsvertrag. | Änderung der
Rechtszuständigkeit |
| |
§ 1392 ABGB | |
Wenn
eine Forderung von einer Person an die andere übertragen, und von
dieser angenommen wird; so entsteht die Umänderung des Rechtes mit
Hinzukunft eines neuen Gläubigers. Eine solche Handlung heißt Abtretung
(Zession), und kann mit, oder ohne Entgelt geschlossen werden. | |
| |
Der Zessionsvertrag wird
zwischen Altgläubiger / Zedent und Neugläubiger / Zessionar geschlossen;
2-Parteienbeziehung. – Das Zessionsverhältnis bezieht
darüber hinaus auch den (übernommenen) Schuldner / Zessus ein; 3-Parteienverhältnis. | |
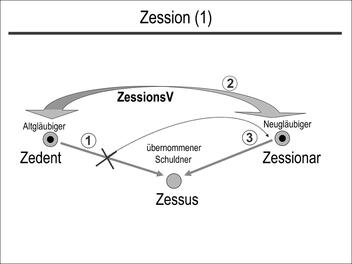 | Abbildung 14.2: Zession (1) |
|
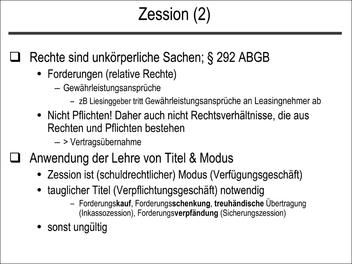 | Abbildung 14.3: Zession (2) |
|
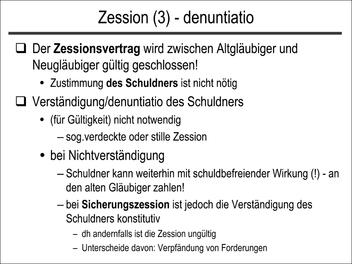 | Abbildung 14.4: Zession (3) |
|
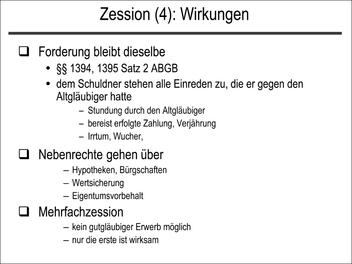 | Abbildung 14.5: Zession (4) |
|
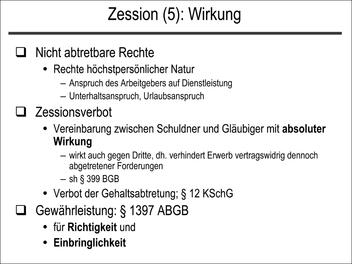 | Abbildung 14.6: Zession (5) |
|
Der Schuldner (des Altgläubigers) ist am Zessionsvertrag
nicht beteiligt. Er muss daher der Zession auch nicht zustimmen,
ja er muss nicht einmal verständigt werden, mag
dies auch idR ratsam sein. – Eine Verständigung /
denuntiatio des Schuldners empfiehlt sich, weil der Schuldner, „solange
ihm der Übernehmer [= Neugläubiger] nicht bekannt wird”, mit schuldbefreiender Wirkung (!)
an seinen bisherigen Gläubiger (= Altgläubiger / Zedent) zahlen
kann; §§ 1395 Satz 2 ABGB und § 1396 ABGB. | |
Bei Verständigung des
Schuldners wird von offener, sonst von verdeckter /
stiller Zession gesprochen → Stille
Abtretung
| |

|
EvBl 1999/30 (§§ 1395, 1396 ABGB): Folgen
einer unrichtigen Abtretungsverständigung – Die Abtretungsanzeige
ist Wissenserklärung → KAPITEL 5: Exkurs: Rechtsgeschäftsähnliche
Erklärungen .
Ist sie unrichtig, aber dem Zedenten zuzurechnen, so hat die Zahlung
des Schuldners an den (Schein)Zessionar schuldbefreiende Wirkung,
sofern nicht ein besonderer Anlass – etwa widersprüchliche Abtretungsanzeigen
oder ein schließlicher Widerspruch des Zedenten – eine (Nachforschungs)Obliegenheit
begründet. | |
|
| |
Die (übertragene) Forderung bleibt dieselbe;
§§ 1394, 1395 Satz 1 ABGB. Die Zession verändert die Rechtsstellung
des Schuldners nicht! (Eine Forderung kann daher nicht abgetreten
werden, wenn die Leistung an einen neuen Gläubiger nicht ohne Veränderung
ihres Inhalts erfolgen kann; so die ausdrückliche Regelung von §
399 dtBGB.) | Forderung
bleibt dieselbe Wirkungen der
Zession |
Das heißt: Dem Schuldner stehen gegen den neuen Gläubiger
alle Rechte und Einreden zu, die ihm auch gegen seinen bisherigen
Gläubiger (= Altgläubiger) zustanden; zB die Einrede der (bereits erfolgten)
Zahlung, einer zwischen ihm und dem Altgläubiger vereinbarten Stundung
(= Zahlungsaufschub → KAPITEL 7: Fälligkeit,
Mahnung, Stundung, Kreditierung),
des Wuchers, Irrtums, der Verjährung oder Aufrechnung (§§ 1438 ff
ABGB). – Nur deshalb ist es (noch) zu rechtfertigen und erscheint
dem Schuldner zusinnbar, dass er von der Zession nicht einmal verständigt
werden muss! | |
Allerdings: Ganz gleichgültig ist es doch
nicht, wer Gläubiger ist. Denn zwischen einem Freund oder Bekannten
und einer Bank besteht ein Unterschied, der sich meist erst bei
„Problemen” zeigt. Die gesetzliche Regelung indiziert demnach eine
Entpersönlichung der schuldrechtlichen Beziehung. | |
Merkregel:
Durch die Abtretung verlieren gesicherte Ansprüche ihre Sicherung
nicht; RdW 1987, 299 (VfGH). Die Meinungen darüber, ob Nebenrechte
eo ipso, also automatisch übergehen oder ob dafür gesonderte Übertragungsakte
nötig sind, sind aber nicht einheitlich. | Übergang von Neben- und Vorzugsrechten? |
| |

|
Mit der Zession
einer Kaufpreisforderung geht auch ein bestehender Eigentumsvorbehalt über; EvBl 1956/7. | |
|
|
|
Auch ein bestehendes gesetzliches
Pfandrecht geht mit Zession der Bestandzinsforderung auf
den Zessionar über; ZBl 1918/14. | |
|
|
|
Das gleiche gilt
für den Fakturengerichtsstand:
GlUNF
6293 (1913) oder eine Schiedsgerichtsvereinbarung; GlUNF 5796 (1912). | |
|
|
|
Auf den Zessionar
gehen auch steuerliche Vorzugsrechte über; GlU 10.979 (1886). | |
|
|
|
Mit Abtretung von
Bestandzinsforderungen geht auch eine vereinbarte Wertsicherung des
Mietzinses über; MietSlg 40.195 (1988). | |
|
Praktisch wichtig sind auch die in § 401 dtBGB ausdrücklich
geregelten Fälle: Mit der abgetretenen Forderung gehen auch Hypotheken,
die für sie bestehen sowie allenfalls bestellte Bürgschaften über.
Der neue Gläubiger kann auch ein mit der Forderung für den Fall
der Zwangsvollstreckung oder des Konkurses verbundenes Vorzugsrecht
(zB Aus- oder Absonderungsrechte)
geltend machen. | |
| |
Bei mehrfacher
Zession (ein und derselben Forderung) ist nur die erste rechtlich
wirksam, von welcher der Schuldner zuerst verständigt wurde; zB
SZ 54/104 (1981). – Darin liegt eine weitere Parallelität zum Sachenrecht;
vgl die §§ 430 und 440 ABGB → KAPITEL 8: Der
sog Doppelverkauf. | |
Ein gutgläubiger Erwerb (durch einen Dritten)
einer dem Zedenten nicht (mehr) zustehenden Forderung ist daher nicht
möglich; EvBl 1982/140. | |
Auch daran zeigt sich, dass die Parallelität
zum Sachenrecht eng begrenzt ist! | |
Also relative Rechte,
aber auch nicht alle! – Nicht abgetreten werden können dagegen Sachenrechte,
deren Übertragung eigenen Regeln folgt. Es ist für das ABGB auch
abzulehnen einzelne sachenrechtliche Ansprüche – zB nach § 366 oder
§ 523 ABGB – für abtretbar zu halten. Sachenrechte und daraus erfließende
Ansprüche haften an der Sache und können daher ohne die Sache nicht
übertragen werden. Das dtBGB kennt dagegen die Abtretung des Herausgabeanspruchs
einer Sache; zB § 440 (Kauf), § 870 (Besitzübertragung), § 931 dtBGB
(Übergabssurrogat) → KAPITEL 2: Übergabsarten
für bewegliche Sachen. | Nur Forderungsrechte sind
abtretbar |
Nicht abtretbar sind
auch personen- oder familienrechtliche Ansprüche, da sie höchstpersönlicher Natur
sind; vgl § 1393, Satz 1 ABGB. | Nicht
abtretbar sind ... |
Die Übertragung von Sachenrechten insbesondere
des (dinglichen Vollrechts) Eigentums an körperlichen Sachen folgt
zB den §§ 426 ff ABGB (bewegliche Sachen): Eigentum wird also nicht
durch Zession übertragen und erworben. – Mit Zession können auch
nur (!) Rechte, also Forderungen übertragen werden,
nicht dagegen Pflichten (Schulden), für deren Übertragung
eigene Regeln bestehen → Der
Schuldnerwechsel:
Schuldnerwechsel. – Auch (ganze) Rechts- oder Schuldverhältnisse,
die aus Rechten und Pflichten bestehen, können daher durch Zession
nicht übertragen werden; dazu → Die
Vertragsübernahme:
Vertragsübernahme. | |
 | |
| |
Das Rechtsinstitut der Zession hat im Laufe seiner Anwendung,
entsprechend den verschiedenen Zwecken, die mit ihm verfolgt werden,
unterschiedliche „Arten” oder „Formen” der Zesseion entwickelt,
auf die idF kurz eingegangen wird. | |
Die
Inkassozession: Sie wird auch „Abtretung zur Einziehung”
genannt. Dabei wird die Forderung (nur) zu dem Zweck an den Zessionar
übertragen, damit dieser die Forderung für den Zedenten einzieht.
Der Übernehmer / Zessionar der Forderung wird nur formell zum neuen
Gläubiger; materiell ist er bloß Inkassant für Rechnung des Überträgers
/ Zedenten. Dies ist ein Fall der Treuhand ( → KAPITEL 15: Die Treuhand):
Der nach wie vor „materiell” berechtigte Zedent, hat daher im Konkurs
des Zessionars ein Aussonderungsrecht. – Auch hier liegt erneut
eine Parallelität zum Sachenrecht vor! | |

|
EvBl 1983/26: Treuhand
beim Factoring. | |
|
Um
einem gewerbsmäßigen Missbrauch von Inkassozessionen durch Inkassobüros vorzubeugen, bestimmt | Inkassobüros |
| |
§ 247 GewO: | |
„Inkassoinstitute
| |
(1) Der Bewilligungspflicht unterliegt die Einziehung
fremder Forderungen. | |
(2) Die Gewerbetreibenden, die zur Ausübung
des Gewerbes der Inkassoinstitute berechtigt sind, sind nicht
berechtigt, Forderungen gerichtlich einzutreiben oder
sich Forderungen abtreten zu lassen, auch wenn die Abtretung nur
zu Zwecken der Einziehung erfolgen sollte. | |
(3) Die Gewerbetreibenden, die zur Ausübung
des Gewerbes der Inkassoinstitute berechtigt sind, sind zur Einziehung
einer fremden Forderung, die dem Ersatz eines Schadens ohne
Beziehung auf einen Vertrag (§ 1295 ABGB) dient,
nur berechtigt, wenn diese Forderung unbestritten ist.” | |
| |
Vgl auch die §§ 127 und 69 GewO | |
Forderungen
dürfen daher von Inkassobüros zwar eingemahnt, nicht aber eingeklagt
werden. | Keine Klagsbefugnis |
Zu beachten ist nunmehr die im Rahmen der neuen Verzugszinsenregelung
getroffene Neuformulierung des | |
| |
§ 1333 Abs 3 ABGB: | |
„Der Gläubiger kann außer den gesetzlichen Zinsen
auch den Ersatz anderer, vom Schuldner verschuldeter und ihm erwachsener
Schäden geltend machen, insbesondere die notwendigen Kosten
zweckentsprechender außergerichtlicher Betreibungs- oder Einbringungsmaßnahmen,
soweit diese in einem angemessenen Verhältnis zur betriebenen
Forderung stehen.” (Hervorhebung von mir) | |
| |
Es handelt sich danach aber um eine subjektive (also Verschulden
voraussetzende) Verzugsfolge. | |
In
Österreich werden jährlich etwa Forderungen von mehr als 630.000
Schuldnern mit einer Gesamtverbindlichkeit von mehr als 13,8 Mrd
S (~ 1 Mrd ı) von Inkassobüros für Unternehmen eingetrieben! (26
Mitgliedsbetriebe sind zum Österreichischen Inkassoverband / IVÖ
zusammengeschlossen. Dieser deckt über 50 % des Inkassomarkts ab.) Die
Inkassobüros brachten 1997 von den ihnen übergebenen Forderungen
etwa die Hälfte erfolgreich ein. Nicht eingebrachte Forderungen
werden in der Folge gerichtlich eingeklagt und exequiert → KAPITEL 19: Exekutionsverfahren: Exekution.
– Abgelehnt hat der EuGH (Rs C 3/95) den Versuch
der Inkassobüros, neben Rechtsanwälten die Klagebefugnis zu erhalten.
Die Inkassobüros hatten sich auf den Grundsatz des freien Dienstleistungsverkehrs
berufen; Art 59 ff EGV. Das Argument des EuGH: Jeder Mitgliedstaat
kann das Einklagen von Forderungen Fachleuten vorbehalten. – Untersagt
ist den Inkassobüros auch das Factoringgeschäft → Das
Factoring,
das nach dem BWG den Banken überlassen ist (Bankkonzession; § 1
Z 16 BWG). – Mit der VO „ Höchstsätze der Inkassoinstituten
gebührenden Vergütungen” (BGBl 1996/141) wurde nunmehr
auch der Verdienst dieses Gewerbesektors rechtlich geregelt. Die VO
wurde auf Grund § 69 Abs 2 Z 5 GewO erlassen. Die Vergütungen sind
an den Verbraucherpreisindex 1986 gekoppelt. – Seit der EO-Nov 1995
müssen sog Nebenforderungen wie Zinsen, Mahn- und Inkassokosten
in der gerichtlichen Klage separat aufgeschlüsselt werden. | Praktische Bedeutung |
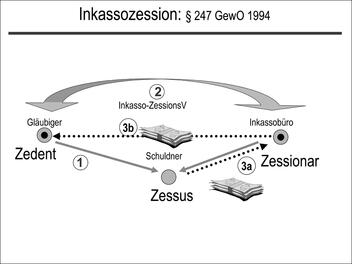 | Abbildung .6: Inkassozession |
(1) Gläubiger hat Forderung gegen Schuldner, will
sie aber nicht selbst einziehen
(2) Zedent (Gläubiger) überträgt sie daher an Inkassobüro (Zessionar)
mittels Inkasso-ZessionsV
(3) Inkassobüro (Zessionar) zieht nun die ihm treuhändisch zustehende
Forderung gegen den Schuldner (Zessus, debitor cessus) ein (a) –
und leitet die inkassierte Forderung an den Zedenten weiter (b) |
|
Stille Abtretung:
Hier wird der Schuldner
von der Abtretung nicht verständigt. Nach außen hin ( Außenverhältnis,
also dem Schuldner gegenüber) steht die Forderung weiterhin dem
Altgläubiger / Zedenten zu, obwohl dieser die Forderung im Innenverhältnis bereits
gültig an den Zessionar abgetreten hat. – Dies ist möglich, weil
– wie wir gehört haben – der Schuldner von der Zession nicht verständigt
werden muss → Schuldnerverständigung?
| |
Bei der stillen Abtretung liegt der Fall also umgekehrt
zur Inkassozession; sie macht den Überträger / Zedenten zum Inkassanten
(auf Rechnung) des Übernehmers / Zessionars. Materiell berechtigt
ist bereits der neue Gläubiger, der daher auch die Gefahr trägt. | |
Der Grund für
eine stille Zession kann darin liegen, dass ein Schuldner nicht
erfahren soll, dass der Zedent (zB wegen Liquiditätsschwierigkeiten)
seine Forderung abtreten musste. Auch ein bestehendes Abtretungsverbot
kann Anlass einer (dann freilich unwirksamen) stillen Zession sein. –
Die stille Zession bedarf natürlich der Vereinbarung zwischen Alt-
und Neugläubiger (Zessionsvertrag). | |
Die Vereinbarung zwischen Zedent und Zessionar
wird bei der stillen Abtretung auch als Ermächtigung gedeutet; Einziehungsermächtigung
(str). Richtiger erscheint es, Auftrag anzunehmen. | |
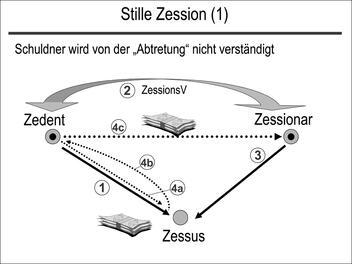 | Abbildung .6: Stille Zession |
(1) Zedent hat Forderung gegen Schuldner
(2) Zedent überträgt diese Forderung still (= ohne Verständigung
des Schuldners) an den Zessionar mittels Zessionsvertrag. |
(3) Diesem steht nun die Forderung gegen den Zessus (Schuldner)
zu. |
(4) Kraft Vereinbarung soll jedoch weiterhin nach außen
der Zedent als Gläubiger auftreten; daher: stille Zession.
– Wegen fehlender Verständigung leistet der Schuldner aber weiterhin
an den Zedenten schuldbefreiend.
– Zedent leitet (intern) das vom Schuldner an ihn Geleistete an
den Zessionar weiter. |
|
Die Sicherungszession:
Werden Forderungen nicht – wie im Normalfall – „verkauft” (also
entgeltlich übertragen; vgl § 1392 Satz 2 ABGB), sondern nur sicherungsweise
abgetreten, etwa deshalb, weil der Kaufmann bei einer Bank ein Darlehen
aufgenommen hat und die Bank dafür Sicherheit verlangt, so erfordert
dies für die Gültigkeit einer solchen Zession einen tauglichen Publizitätsakt.
Dies ist grundsätzlich die Verständigung des Schuldners
/ denuntiatio, die hier aber Gültigkeitsvoraussetzung oder
– wie das auch genannt wird – konstitutiv ist. Darin liegt ein Akt
der Publizität. Die Rechtsänderung muss nach außen hin
(insbesondere dem Schuldner gegenüber) erkennbar in Erscheinung
treten. Damit sollen Umgehungen und Schädigungen Dritter vermieden
werden; andernfalls könnten Forderungen zum Nachteil von Sicherungsgläubigern mehrfach
abgetreten werden! Der Publizitätsakt kann (nach
der Rspr) aber auch dadurch gesetzt werden, dass die sicherungsweise
abgetretene Forderung in den Geschäftsbüchern des abtretenden
Altgläubigers (sog OP-/ Offene Posten-Listen)
deutlich vermerkt wird; verbriefte Forderungen sind zu übergeben. | |
Die Rspr hat
in diese Fragen in der jüngeren Vergangenheit unnötige Unruhe und Rechtsunsicherheit hineingetragen,
weil sie zum Teil sogar die Denuntiatio für unzulässig angesehen
hat. Das sollte rasch durch eine einheitliche und widerspruchslose
Judikatur beseitigt werden, die zudem auf Einfachheit und Klarheit
zu achten hätte. | Rechtsunsicherheit |

|
SZ 70/228 (1997)Im Falle einer
mittels EDV geführten Buchhaltung ( Speicherbuchhaltung)
ist die notwendige Publizität der Sicherungszession nur (!) gegeben,
wenn der (Buch) Vermerk nicht
nur bei Kundenkonten, sondern auch in der Liste der offenen (Debitoren)Posten
aufscheint. | |
|
|
|
OGH 20. 6. 2000, 3 Ob 229/99v, SZ 73/99 = EvBl 2000/215:
Unternehmer zediert seiner Bank zur Sicherung eines Kredits eine
Werklohnforderung; Sicherungszession. Als sich
bei Fälligkeit des Werklohnes der Werkbesteller weigert zu zahlen,
zediert die Bank die Forderung zum Inkasso wieder an den Unternehmer
zurück; Inkassozession. Als der Unternehmer in (Zwangs)Ausgleich
geht, will sich die Bank nicht mit der Ausgleichsquote zufrieden
geben. – OGH: Zediert der Sicherungszessionar (hier: Bank) die Forderung nach
Eintritt des Sicherungsfalls an den Sicherungszedenten (hier: Werkunternehmer)
zum Inkasso zurück, so ist er als Treugeber in dessen Konkurs aussonderungsberechtigt. | |
|
Die pfandrechtlichen Publizitätsvorschriften
finden hier entsprechende Anwendung, obwohl Forderungen keine körperlichen,
sondern unkörperliche Sachen und zudem nur relative und keine dinglichen
Rechte sind. – Die Zession ist zwar kein Rechtsinstitut des Sachenrechts,
wird aber (wie wir gehört haben) als ein schuldrechtliches Verfügungsgeschäft
verstanden. Neben der Lehre von Titel und Modus, die auf die Zession
Anwendung findet, und dem bei der Sicherungszession erforderlichen
Publizitätsakt der Schuldnerverständigung, zeigt auch die von der
Rspr (zurecht) vertretene Dritt- oder absolute Wirkung des Zessionsverbots
( → Globalzession
und Abtretungsverbot), dass hier sachenrechtliche Prinzipien
auf schuldrechtliche Beziehungen angewandt werden. Vgl auch die
Lösung bei Mehrfachzessionen → Mehrfachzessionen Darin
liegt zwar – wie erwähnt – ein Systembruch, aber die Ausnahmen erscheinen
vertretbar. | |
Unterscheide:
Verpfändung einer Forderung | |
Zur Unterscheidung der Abtretung sicherheitshalber (wie
die Sicherungszession auch genannt wird), die das Vollrecht an einer
Forderung, freilich eingeschränkt durch die treuhändische Sicherungsabrede,
überträgt, von der Verpfändung einer Forderung,
die nur ein beschränktes Recht zu Sicherungszwecken begründet → Sicherungszession
| |
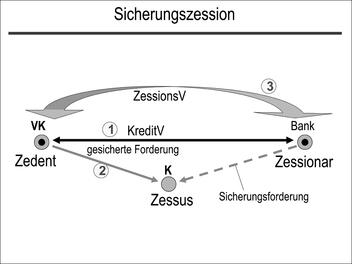 | Abbildung .6: Sicherungszession |
(1) VK nimmt zB Kredit bei einer Bank auf |
(2) VK/Zedent hat Kaufpreisforderung gegen K/ Zessus |
(3) Zedent/VK überträgt mit ZessionsV und Sicherungsabrede
seine Forderung zur Sicherung des ihm gewährten Kredits an Bank/Zessionar |
|
| Arten der Zession – Überblick |
| • Offene oder verdeckte
Zession | |
| • Inkassozession | |
| • Stille Zession | |
| •
Sicherungszession
<-> Verpfändung einer Forderung | |
| • Rechtsgeschäftliche / vertragliche <-> gesetzliche
/ Legalzession <-> richterliche Zession → Die
Legalzession
| |
| •
Globalzession → Globalzession
und Abtretungsverbot
| |
| • Mehrfachzession → Mehrfachzessionen
| |
| |
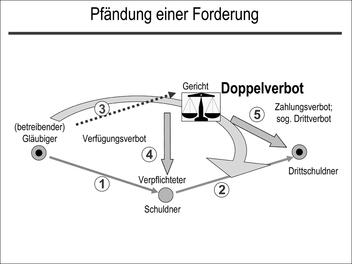 | Abbildung .6: Pfändung einer Forderung |
(1) Gläubiger hat Forderung gegen Schuldner |
(2) Schuldner hat seinerseits eine Forderung gegen Drittschuldner |
(3) Pfändung dieser Forderung durch den (betreibenden) Gläubiger
erfolgt durch gerichtliches Doppelverbot (§ 294 EO): |
(4) Verfügungsverbot an Verpflichteten |
(5) Zahlungsverbot an Drittschuldner; sog Drittverbot |
|
5. Globalzession
und Abtretungsverbot | |
Nicht immer wird nur
eine einzelne Forderung abgetreten. Manchmal wird auch eine Mehrheit
von Forderungen oder sogar alle Forderungen eines Gläubigers gegen
einen bestimmten Schuldner – und zwar bereits entstandene wie erst
(künftig) entstehende – an einen neuen Gläubiger (häufig eine Bank)
rechtsgeschäftlich abgetreten. | |
Man spricht dann von Global- oder Mantelzession.Voraussetzung
ihrer Rechtswirksamkeit ist es, dass die jeweils abgetretenen oder
in Zukunft (bei Entstehung neuer Forderungen) abzutretenden Forderungen inhaltlich hinreichend bestimmt sind.
Man spricht hier von der nötigen Individualisierung (= Feststellbarkeit)
der abgetretenen Forderungen. Sie wird bspw angenommen, wenn „alle”
Forderungen gegen einen Schuldner (etwa ein bestimmtes Unternehmen)
abgetreten werden. | |
Die Abtretung künftiger Forderungen ist gültig, aber durch
ihre (spätere) Entstehung bedingt; SZ 51/38 (1978). – In der Praxis
erfolgen Globalzessionen zugunsten von Kreditinstituten, denen gegenüber
der Abtretende verpflichtet ist. Häufig liegt Überschuldung vor.
Vorsicht erscheint daher geboten! | |
Auch im Zusammenhang mit Factoring ( → Das
Factoring)
spielen Globalzessionen eine praktische Rolle; vgl SZ 53/33 (1980). | |

|
OGH 30. 8. 2000, 6 Ob 174/00g, SZ 73/132:
Eine GmbH hat Kreditschulden von nahezu 5 Mio S bei der A-Bank.
Zur Besicherung wird eine Global- und Mantelzessionsvereinbarung geschlossen,
die jedoch aufgrund unzureichender Kenntlichmachung in der offenen
Postenliste (OP-Liste) der Kreditschuldnerin mangels Publizität
nicht zu einer Abtretung der Forderungen führt. Als die GmbH bei
der A-Bank keine weiteren Kredite mehr erhält, wendet sie sich an
die B-Bank, der sie die bereits erfolgte Globalzession zugunsten
der A-Bank mitteilen. Zur Besicherung des neuen Kredits wird auch
mit der B-Bank ein Global- und Mantelzessionsvertrag geschlossen
und im Laufe der Zeit werden ihr auch Forderungen im Wert von über
4 Mio S abgetreten. Nach dem Konkurs der GmbH klagt die A-Bank die
B-Bank auf Zahlung dieses Betrages. – OGH: Die Globalzession künftiger
Forderungen bedarf der Anbringung eines Generalvermerks in der offenen
Postenliste. Dieser muss den Zessionar und das Datum des Zessionsvertrags anführen.
Im konkreten Fall wurde nur der Buchstabe „Z” auf jede Seite der
OP-Liste gesetzt). Wenn trotz des Fehlens eines ausreichenden Buchvermerks
ein zweiter Zessionar vom Globalzessionsvertrag des ersten Kenntnis
hat (hier: Information durch den Zedenten selber), wird er wegen
des Eingreifens in fremde Forderungsrechte schadenersatzpflichtig.
– Überlege: Kann bei Vereinbarung einer Globalzession stillschweigend
ein Abtretungsverbot angenommen werden und wie könnte es begründet
werden? (§ 914 ABGB iVm mit ergänzender/hypothetischer Vertragsauslegung)
– Didaktisch vorbildliche Gliederung der E. | |
|
Es wurde
schon ausgeführt, dass nur Forderungsrechte, also relative Rechte
abgetreten werden können, nicht aber bspw Sachenrechte. – Es besteht
aber nach hA und Rspr die Möglichkeit, Forderungsrechte
unabtretbar zu machen. Dies geschieht durch Vereinbarung
zwischen Schuldner und Gläubiger (zB eines Kauf- oder Kreditvertrags);
sog Zessions- oder Abtretungsverbot / pactum de non cedendo. Dieses
im ABGB gesetzlich nicht geregelte, vielmehr von der Rspr in Anlehnung an
§ 399 dtBGB entwickelte Zessionsverbot besitzt – was vielfach (ua
von Banken) bekämpft wird – absolute Wirkung: Dh
das Verbot wirkt auch gegen Dritte. Und zwar gerade auch dann, wenn der
Dritte das Verbot (gutgläubig) gar nicht gekannt hat. Es gibt eben
keinen gutgläubigen Erwerb von Forderungen; vgl schon → Rechtliches
Grundmuster der Zession Diese
absolute Wirkung des Zessionsverbots verhindert also einen gutgläubigen
Forderungserwerb (vertragswidrig dennoch abgetretener Forderungen)
durch Dritte; vgl Kapitel-Motto (G. Hoop). Der Schuldner muss daher
auch dann nicht an einen (allfälligen) „Zessionar” zahlen, wenn
sein Gläubiger (Zedent) die Vereinbarung gebrochen und die Forderung
dennoch – also trotz bestehenden Abtretungsverbots – abgetreten
hat. | |

|
JBl 1986, 383: Der Schuldner kann
aber nachträglich der Abtretung zustimmen oder
auf die im zustehende Einwendung verzichten. | |
|
|
|
SZ 57/8 (1984): verstSenat: Abtretungsverbot.
Dagegen haben sich bspw: Iro, RdW 1984, 103; Wilhelm, JBl 1984,
304; Raber, JBl 1971, 441 und Koziol, JBl 1980, 113 geäußert. (Es
liegt aber ein Widerspruch darin, auf der einen Seite den Schutz
relativer Rechte ausdehnen zu wollen und auf der anderen Seite die absolute
Wirkung von Abtretungsverboten zu bekämpfen! Diese Meinungen sind
in sich nicht konsistent!) Zur Verletzung fremder Forderungsrechte → KAPITEL 11: Verletzung
fremder Forderungsrechte. | |
|
|
|
OGH 26. 1. 2000, 7 Ob 304/99b, SZ 73/19 = JBl 2000, 583:
Die Vinkulierung einer Lebensversicherung in Form
einer bloßen Zahlungssperre wirkt nach Meinung des OGH – anders
als das Abtretungsverbot – nicht absolut. | |
|
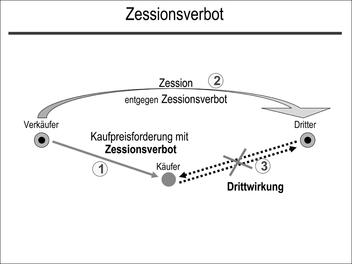 | Abbildung .6: Zessionsverbot |
(1) Beispiel: VK vereinbart mit K ein Zessionsverbot
bezüglich der Kaufpreisforderung |
(2) VK zediert Forderung entgegen Vereinbarung an Dritten |
(3) K/Schuldner muß nicht an Dritten zahlen und Dritter
kann nicht fordern: Drittwirkung des Verbots |
|
§ 12 KSchG
statuiert ein gesetzliches Abtretungsverbot für Löhne- und Gehälter
seitens eines Verbrauchers an einen Unternehmer „zur Sicherung oder
Befriedigung seiner noch nicht fälligenForderungen”
aus einem Verbrauchergeschäft. § 12 Abs 2 KSchG sanktioniert dieses
Verbot auf interessante Weise. | Verbot der
Gehaltsabtretung |
6. Gewährleistung
für zedierte Forderungen | |
Wer
eine Forderung verkauft, also entgeltlich überträgt, hat nach §
1397 ABGB für allfällige Mängel derselben Gewähr zu leisten. Wie
bei der entgeltlichen Veräußerung körperlicher Sachen für Sach-
und Rechtsmängel einzustehen ist (§§ 922 ff ABGB), wird auch bei
entgeltlicher Übertragung von Forderungen (als unkörperlichen Sachen)
für deren | |
| •
Richtigkeit (=
Nochbestehen der Forderung, ihre Klagbarkeit, Unbedingtheit und
Nichtbeeinträchtigung durch Einwendungen des Schuldners / Zessus)
und | Richtigkeit |
| •
Einbringlichkeit (=
Durchsetzbarkeit gegen den Zessus, allenfalls vermehrt um die Kostenhaftung
des Zedenten für die Durchsetzung) gehaftet. | Einbringlichkeit |
| |
| |
Neben der rechtsgeschäftlichen
Übertragung von Forderungen durch (Zessions)Vertrag gibt
es auch einen Forderungsübergang unmittelbar durch Gesetz (sog
Legalzession) oder durch Richterspruch. | |
 | |
Andere
berühmte Legalzessionsnormen sind zB: § 332 ASVG oder § 67 VersVG. | Berühmte Beispiele |
Überlege:
Versuchen Sie durch Lektüre den Unterschied zwischen § 1358 ABGB
(= cessio legis) und § 1422 ABGB (= notwendige Abtretung
/ cessio necessaria) zu ergründen → KAPITEL 15: Legalzession: § 1358 ABGB: § 1358 ABGB. | |
| |
 | |
Immer
mehr österreichische Unternehmen exportieren Waren ins nähere oder
fernere Ausland. Österreichs Wirtschaft exportierte im Jahr 2001
Waren im Werte von 74,5 Mrd ı (~ 1.025 Mrd Schilling), 1997 betrug
diese Zahl 715 Mrd und 1996 waren es noch 612,2 Mrd Schilling gewesen.
– Export erfordert aber neben wirtschaftsfachlichem, auch rechtliches
Wissen und dazu oft eine Eigenkapitalausstattung über die kleinere
und mittlere Unternehmungen nicht verfügen. Unser Rechtsinstitut
vermag hier Abhilfe zu schaffen. – Factoring ist heute für viele Betriebe
und Branchen zu einem wichtigen Finanzierungsinstrument geworden. | Finanzierungsinstrument |
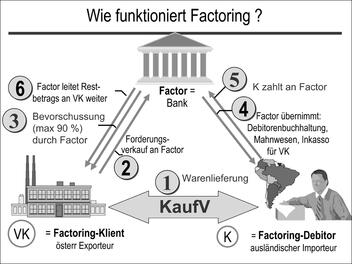 | Abbildung 14.7: Wie funktioniert Factoring? |
|
1. Echtes und unechtes
Factoring | |
Das
Factoring ist eine vertragliche Neuschöpfung des Wirtschaftslebens,
möglich geworden durch die im Schuldrecht geltende Vertragsfreiheit,
die auch Typenverschmelzungen zu einem neuen Ganzen zulässt. Typus-Elemente
des Factoring sind insbesondere: Zession / Forderungs(ver)kauf +
Geschäftsbesorgung / Auftrag + Kreditierung. | |
| |
Factoring dient heute vornehmlich: | |
| • der Refinanzierung (des
Exporteurs) im Exportgeschäft; | |
| • aber auch dem Erwerb von
rechtlichem und wirtschaftlichem Know-How und | |
| • es beinhaltet zudem gewisse Dienstleistungen durch
den Factor. | |
Der Exporteur verkauft
bspw seine Forderung aus seinem Exportgeschäft an den Factor, der
die Forderung „prüft” und bei Gutbefinden kauft; echtes
Factoring. Das bedeutet: Der Factor bevorschusst oder bezahlt
den Forderungsbetrag (Kaufpreis) an den Exporteur (wenn auch nicht
100%) – abzüglich eines Entgelts (für eigene Mühewaltung), sodass
dieser nicht solange auf sein Geld warten muss. Die Konkurrenz erzwingt
nämlich im Exportgeschäft ua „attraktive” Zahlungsziele (bis zu
120 Tagen) für die Kunden (= Importeure). Das ist für exportierende
Klein- oder Mittelbetriebe viel! Durch das Gewähren von Vorschüssen
auf den Kaufpreis (durch den Factor) erlangt der Kunde des Factors
(= Exporteur) erhöhte Liquidität. Das ist vor allem für Klein- und
Mittelbetriebe wichtig, deren Eigenkapitalausstattung häufig gering
ist. | Echtes Factoring Arten des Factoring |
Es kann aber auch sein, dass der Factor die
Exportforderung nicht kauft, sondern bloß als (Inkasso)Zessionar
eintreibt – unechtes Factoring – und dazu Mahnwesen
und Debitorenbuchhaltung übernimmt. Factoringinstitute verfügen
im Regelfall über ein entsprechendes rechtliches Know-How. In diesem
Fall verbleibt das Risiko der ganzen oder teilweisen Uneinbringlichkeit
der Forderung / Zahlungsunfähigkeit (Zahlungsausfallsrisiko) des
Schuldners anders als beim echten Factoring beim Exporteur. Die
Übernahme des Risikos der Uneinbringlichkeit von Forderungen bezeichnet
man als Delkredere (funktion). | Unechtes
Factoring |
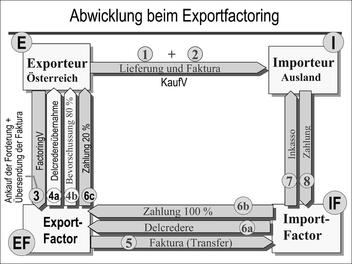 | Abbildung 14.7: Abwicklung beim Exportfactoring |
E(xporteur) liefert Waren an I(mporteur). |
Originalrechnungen von E werden mit dem Vermerk, daß I an
IF zu zahlen hat, an I gesandt. |
l Rechnungskopien werden an EF, den Vertragspartner des
E (Factoringvertrag) im Inland, übermittelt. |
Anhand dieser angekauften Forderungen 4a kann, wenn vertraglich
vereinbart, sofort eine Bevorschussung der Kaufpreiszahlung an den
Exporteur in Höhe von 80-90 % des Fakturenwerts erfolgen 4b. |
EF verkauft idF „seine” Forderung(en) weiter an IF. Aus
diesem Vorgang resultieren wichtige Vorteile für EF: Auslandsforderungen
werden zu Inlandsforderungen! Vorteile: bedeutende Probleme und
Risiken wie fremde Sprache, unbekannte Gesetzgebung, ungewohnte
Mahn- und Inkassopraxis sowie ungeläufige Handelsusancen werden
ausgeschaltet. |
IF übernimmt von EF Delcrederehaftung 6a und zahlt übernommene
Forderung zu 100 Prozent an EF 6b, worauf dieser die restlichen
20 % an E zahlt 6c; idF 7 und 8: s Skizze. |
|
| Export-Factoring – Echtes und unechtes |
| •
Echtes Factoring =
mit Übernahme des Delkredererisikos; auch F ohne Regress genannt.
Hier trifft die F-Bank eine unbedingte Zahlungsverpflichtung, selbst
wenn der Importeur nicht zahlen sollte. – Diese Form des F ist teurer,
überwiegt aber in der Praxis. | |
| •
Unechtes Factoring = ohne
Übernahme des Delkredererisikos; auch F mit Regress genannt. – Hier
hält sich F-Bank im Falle der Nichtzahlung seitens des Importeurs
am Exporteur schadlos/Regress. – Diese Form des F ist billiger und
es kann ein sehr hoher Anteil der angekauften Forderungen bevorschußt
werden. | |
| • Wie beim Dokumentenakkreditiv bedient sich
beim EF die Inlandsbank (=EF) häufig einer ausländischen Korrespondenzbank (=IF),
weil zB der österreichische EF kein ausreichendes Wissen über brasilianisches
Recht und Kundenbonität besitzt. In diesem Fall wird aus einem drei, ein
viergliedriges Factoring. Beteiligt sind dann: | |
| • Exporteur + Importeur sowie | |
| • Export-Factor (im Exportland) + Import-Factor
(im Importland). | |
Das Export-Factoring erfüllt 3 Funktionen: | |
| • Debitorenmanagement/Schuldenverwaltung | |
| • Bonitätskontrolle + Delkredereübernahme | |
| • Finanzierung/Kaufpreiszahlung. | |
Es erfolgt Arbeitsteilung zwischen Export-
und Import-Factor: Der Export-Factor übernimmt die Finanzierung,
der Import-Factor das Mahn- und Inkassowesen sowie die Risikoübernahme
im Ausland. | |
2. Factoring als
Dauerschuldverhältnis | |
Zu
beachten ist ferner, dass beim Factoring häufig ein länger dauerndes
Schuldverhältnis zwischen Factor und dem Kunden des Factors / Exporteur
entsteht (Dauerschuldverhältnis!), weil oft nicht nur eine Forderung
abgetreten wird, sondern immer wieder neue oder überhaupt alle Forderungen aus
einer Geschäftsbeziehung oder gar dem gesamten Geschäftsbetrieb:
Globalzession → Globalzession
und Abtretungsverbot
| |

|
SZ 53/33 (1980): Hier wurde dem
Schuldner vom Factor mitgeteilt, dass auf ihn alle
Forderungen aus einem Geschäftsbetrieb übertragen wurden. | |
|
3. Das Factoring
als Bankgeschäft | |
Das
Factoringgeschäft ist Bankgeschäft. § 1 Abs 1 Z 16 BWG spricht vom
„ ... Ankauf von Forderungen aus Warenlieferungen ... (Factoringgeschäft)”.
– Factor-Institute kontrahieren heute regelmäßig unter Zugrundelegung
von AGB; hier: AFB(Allgemeine Factoring-Bedingungen). | |
| |
Neben
dem bisher stärker betonten Auslands- oder Exportfactoring gibt
es auch das Inlandsfactoring, bei dem die Delkrederefunktion (des
Factors) aber kaum eine Rolle spielt. | |
5. Factoring als
Alarmsignal | |
Factoring-Vereinbarungen bedeuten vornehmlich dann, wenn
sie mit Globalzession einhergehen mitunter schwere Eingriffe
in die wirtschaftliche Handlungsfreiheit und Geschäftsgebarung von
Factorkunden. Der Kunde muss dem Factor bspw weitreichende
Informationsrechte einräumen, wie: | |
| • das
Recht zur Auskunftseinholung, | | | •
Akteneinsicht bei verschiedenen
Behörden, | | | • jederzeitige Einsicht in die Geschäftsunterlagen sowie
verschiedene Pflichten übernehmen: jährliche Bilanz-, Gewinn- und
Verlustrechnung vorlegen, | | | •
Vorausfinanzpläne zu erstellen
udgl. | |
| |
Der
Factor kann sich vom Abnehmer (= Warenkäufer) die ordnungsgemäße
Lieferung und die (von ihm) erworbene Forderung bestätigen lassen.
Häufig muss der Factor-Kunde / Klient, den Factor über Mängelrügen,
bestehende Gegenforderungen oder sonstige Fragen der Gültigkeit
des Grundgeschäfts (Liefervertrag) wie Wandlung, Rücktritt oder
Anfechtungen unterrichten. | |
Factoring-Vereinbarungen, insbesondere solche iVm Globalzessionen,
stellen daher uU auch ein wirtschaftliches Alarmsignal für Abnehmer
/ Käufer des Factoring-Kunden dar, das auf drohende Zahlungsunfähigkeit
(Insolvenz) oder doch gefährliche Vorstufen dazu hindeuten kann. | |
| |
 Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis |
 B. Der
Schuldnerwechsel B. Der
Schuldnerwechsel |
| |

