Kapitel 6 | |
| |
 Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis |
 B. Cic
– culpa in contrahendo B. Cic
– culpa in contrahendo |
| |
A. Allgemeine
Geschäftsbedingungen |
| |
1. Vom Individualvertrag
zum Massengeschäft | |
Verträge wurden früher
einzeln ausgehandelt. Heute dominiert das Massengeschäft. – Typische Branchen,
die AGB verwenden, sind daher bspw: Versicherungen, kommunale Versorgungsbetriebe
(Strom, Wasser, Gas, Verkehr), Banken, Vermögensberatungen, Speditionen,
der Auto-, Elektro(geräte)- und Möbelhandel, Versandhäuser, Realitätenvermittler,
Wäschereien, Putzereien, Reisebüros, Theater, Kinos usw; aber auch
Post, Bahn und Schilifte. – Zu Funktion und Wandel des Vertrags → KAPITEL 5: Zu
Funktion und Wandel des Vertrags. | |
2. Was spricht
für die Verwendung von AGB? | |
AGB
dienen als Mittel einer rechtlich-wirtschaftlichen Rationalisierung:
Wenn im Geschäftsleben immer wieder inhaltlich weitgehend idente
Verträge geschlossen werden, ist es naheliegend, den Vertragsinhalt
zu standardisieren und damit Zeit zu sparen; denn Zeit ist für den
Kaufmann Geld. AGB, als vorformulierte und typisierte Vertragsinhalte,
stellen demnach einen Akt kaufmännisch-rechtlicher Rationalisierung
dar. | Rationalisierung |
AGB stellen
eine Hilfe beim Vertragsschluss dar,
denn: | Hilfe beim Vertragsschluss |
| • der Geschäftsabschluss
wird durch sie vereinfacht, | |
| • sie ersparen Zeit und Geld, und | |
| • erlauben es, berechtigte eigene Interessen
zu berücksichtigen und | |
| • sind in der Lage Kunden gleichmäßig zu behandeln. | |
Während die Abschlussfreiheit auch bei
der Verwendung von AGB gewahrt wird, besteht die Gefahr, dass bei
typisierten Vertragsschlüssen unter Zugrundelegung von AGB die Inhaltsfreiheit (zu
Lasten des schwächeren Teils) auf der Strecke bleibt. Dazu gleich
mehr. | Gefahren der
AGB-Verwendung |
| |
Gefahren der AGB-Verwendung: Aber auch
andere Beweggründe spielen mitunter beim Erstellen von AGB eine
Rolle; zB das Bestreben, für sich selbst rechtlich möglichst vorteilhafte Verträge
zu formulieren, ohne gleichzeitig ebenso berechtigte Interessen
der „anderen Seite” zu berücksichtigen; denn durch AGB wird oft
das (sonst geltende) nachgiebige Gesetzesrecht (sog Dispositivrecht → KAPITEL 1: Die
Staats- und Rechtsfunktionen und → KAPITEL 7: Nachgiebiges
und zwingendes Recht),
das sich durch ausgewogene Lösungen für beide Seiten auszeichnet
(Gerechtigkeitsgewähr), verdrängt. – Unternehmer versuchen daher
immer wieder, ihre wirtschaftlich stärkere Stellung auch dazu einzusetzen,
um zB Verbraucher rechtlich (durch AGB) zu benachteiligen; etwa
Gewährleistungsansprüche einzuschränken oder auszuschließen, drastische
Verzugsfolgen zu statuieren oder fragwürdige Verfallsklauseln durchzusetzen;
vgl das idF wiedergegebene Beispiel von SZ 2/11 (1920). | |
Mit der Verwendung von AGB besitzen Unternehmen ein Mittel,
ihr Geschäftsrisiko auf Vertragspartner zu überwälzen.
Häufig geschah dies auf der Rückseite von Formularen in extremem Kleindruck
(„das ominöse Kleingedruckte”!) und/oder es wurde bei der (Druck)Farbe
gespart (hellblau)! – Dies alles hat in den 60er und frühen 70er
Jahren – nicht nur bei uns – dazu geführt, den Problemkreis „AGB”
intensiv zu diskutieren. | |

|
SZ 2/11 (1920): Die in dem Übernahmsschein
(Marke) einer Wäscherei (Putzerei, Färberei) enthaltene Bestimmung,
dass die übergebenen Gegenstände bei Nichtabholung binnen 3 Monaten
zugunsten der Unternehmung verfallen, ist gemäß § 879 ABGB ungültig
/ sittenwidrig und als nicht beigesetzt anzusehen. | |
|
|
|
OGH 27. 4. 2001, 1 Ob 27/01d (verst Senat), JBl 2001, 593:
Verbraucher erhebt keine Einsprüche gegen vierteljährliche
Kontoauszüge samt Rechtsbelehrung. – OGH: Das Saldoanerkenntnis nach AGBKr hat
im Regelfall nur deklarative Wirkung. Konstitutiv wirkt es nur bei
konkreter Streitbereinigungsabsicht, dh wenn im konkreten Fall ein
ernstlicher Streit oder Zweifel beigelegt werden soll. | |
|
Das Ergebnis in Österreich
sind die Regelungen der §§ 864a und 879 Abs 3 ABGB – eingeführt parallel
zum KSchG 1979 – sowie einige weitere Bestimmungen im Rahmen des
KSchG; insbesondere § 6 KSchG (unzulässige Vertragsbestandteile),
aber auch § 8 KSchG (Gewährleistung) oder § 14 KSchG (Gerichtsstand)
uam. Dazu kommen die §§ 28 und 29 KSchG: sog Verbandsklage etc.
Das KSchG als Ganzes verdankt seine Entstehung diesen neuen bewussteren
Strömungen im Rechtsdenken, das in seinen Ursprüngen aus den USA
(Ralph Nader) nach Europa kam. | Reaktionen
des Gesetzgebers auf Missstände |
Anhand der AGB-Problematik kam in Österreich
der Konsumentenschutz in Diskussion und das KSchG 1979 ist das Ergebnis → KAPITEL 2: Verbraucherrecht ¿ Konsumentenschutz.
In Deutschland wurde 1976 ein eigenes AGB-G(esetz) beschlossen,
das 2001 im Rahmen der Schuldrechtsreform in das dtBGB integriert
wurde; §§ 305 ff dtBGB. | |
AGB werden im Normalfall von (Einzel)Unternehmern erstellt
und gelten dann auch nur für Vertragsschlüsse dieser Unternehmen;
und zwar im Verhältnis von Unternehmer und Verbraucher wie zwischen
Unternehmern ( → Voraussetzungen
und Verwendung von AGB?). – Aber es gibt auch Branchen-AGB;
zB für den Kreditsektor (.........), Spediteure (AöSp), (Privat)Versicherungen
oder die Allgemeinen Reisebedingungen; dazu → KAPITEL 12: Der
(Pauschal)Reiseveranstaltungsvertrag:
PauschalreiseveranstaltungsV. | Wer
verwendet AGB? |
| |
3. Was wird in
AGB geregelt? | |
Typische
Regelungen in AGB betreffen: – Erfüllungszeit und -ort, – Fälligkeit
und Mahnung, – Lieferfristen und vor allem auch – Zahlungsmodalitäten
wie Zahlungsziele oder Skonti, – Gläubiger- und Schuldnerverzug
(zB bankmäßige, also höhere vertragliche als die niederen gesetzlichen Verzugszinsen,
erweiterte vertragliche Rücktrittsrechte / Storno etc), – Gewährleistungs-
und/oder Schadenersatzansprüche (insbesondere auch konkrete Regeln
zur Handhabung der Mängelrüge nach § 377 HGB → KAPITEL 7: Kaufmännische
Rügepflicht),
– den Eigentumsvorbehalt, – Konventionalstrafen (§ 1336 ABGB), –
Kostenvoranschläge (§ 1170a ABGB) oder – sog Freizeichnungsklauseln ( → KAPITEL 9: Verschulden
(culpa)),
– Zurückbehaltungsrechte (§ 471 ABGB) und – Aufrechnung- (sverbote). | |
4. Voraussetzungen
und Verwendung von AGB? | |
Die Verwendung von AGB braucht in Österreich
grundsätzlich – weder im Voraus (ex ante) noch im
Nachhinein (ex post) – eine staatliche Genehmigung;
Ausnahme: AGB von Versicherungen mussten lange von der Versicherungsaufsichtsbehörde
(= BMfF) genehmigt werden. Nunmehr gilt dafür eine EU-Richtlinie.
Die AGB der Kreditunternehmungen müssen dem BMfF angezeigt und im
Kassenraum ausgehängt werden; § 35 Abs 1 Z 2 BWG. | |
AGB
finden nicht nur zwischen Unternehmern und Verbrauchern Anwendung,
sondern auch unter Kaufleuten; zB Ein- und Verkaufsbedingungen.
– AGB werden häufig unter Beiziehung von Rechtsberatern formuliert.
Leider nicht immer auf hohem Niveau und rechtlich einwandfrei, also
zB KSchG-konform; vgl → AGB-Muster:
Link. Es ist kein Qualitätszeichen für einen Rechtsanwalt (und natürlich
auch nicht für den jeweiligen Unternehmer), wenn AGB scharf und
einseitig formuliert werden. Kaufmännische Überlegungen erfordern
vielmehr ein angemessenes Berücksichtigen von Kundeninteressen.
AGB haben zu beachten, dass sie auf (nicht immer geschäftsgewandte) „Kunden”
Anwendung finden sollen. | AGB finden auch „unter“ Kaufleuten Anwendung |
 | |
Sinnvoll für die geplante längerfristige Zusammenarbeit
von Unternehmern ist es, einen Rahmenvertrag zu
schließen. Er vermag auch das eben aufgezeigte Problem ( → Vorvertrag
<-> Rahmenverträge)
eines Dissenses zwischen Geschäftspartnern auszuschließen. | |
II. Geltungsgrund
und Inhaltskontrolle | |
1. Zwei grundsätzliche
Fragestellungen | |
Die AGB-Problematik wird gerne auf zwei Problemkreise verteilt:
Die Frage nach dem „Geltungsgrund” von AGB und
die nach ihrer „Inhaltskontrolle”. | |
| •
Wie werden
AGB gültig vereinbart, dh wie werden sie Vertragsinhalt? – Das ist
die Frage nach dem sog Geltungsgrund. | |
| • Und: Können bereits vereinbarte – also Vertragsinhalt
gewordene – AGB, die einen Teil benachteiligen, worauf man uU erst
später kommt, nachträglich noch kontrolliert und korrigiert werden, und
von wem? – Das ist die Frage nach der sog Inhaltskontrolle von
AGB. | |
2. Der
Geltungsgrund von AGB | |
Mit Nachdruck
muss darauf hingewiesen werden, dass AGB von beiden Vertragsteilen
vereinbart werden müssen und nicht etwa von einem Vertragsteil
dem andern einseitig diktiert, also aufgezwungen werden können.
– Alles was Vertragsinhalt werden soll, bedarf der Zustimmung beider
Vertragspartner; Konsensprinzip. Konsens benötigt übereinstimmende
Willenserklärungen. | Konsensprinzip |
Nicht damit zu verwechseln ist die –
häufig anzutreffende – unterschiedliche Wirtschafts- oder Marktmacht
der Verhandlungspartner. Natürlich ist die wirtschaftliche Machtstellung
eines Weltkonzerns und eines Verbrauchers sehr verschieden. Aber
auch für solche Fälle gilt, dass ein Verbraucher den AGB seines
Vertragspartners zustimmen muss und grundsätzlich im konkreten Fall
die – wenigstens theoretische – Chance besitzt, bestehende AGB abzuändern.
Nur das entspricht der Vertragsfreiheit und der damit einhergehenden
Rechtsgleichheit. – Häufig besteht aber bei ungleicher wirtschaftlicher
Machtstellung der Vertragspartner die Möglichkeit von Verbrauchern
bloß darin, einen Vertrag – unter Zugrundelegung der vom Unternehmer
erstellten AGB – abzuschließen oder darauf zu verzichten. | Unterschiedliche Wirtschafts-
oder Marktmacht |
Auch die Vereinbarung von AGB zwischen
den Parteien kann ausdrücklich oder schlüssig (iSd
§ 863 ABGB) erfolgen; zB Offertstellung mit beigelegten AGB. – Für
Kaufleute ist auch § 346 HGB zu beachten: Unter Kaufleuten gelten
danach AGB stillschweigend auch dann als vereinbart, wenn ein diesbezüglicher Handelsbrauch besteht,
selbst wenn ein Vertragsteil ihn nicht kennt; zB AÖSp. | §
863 ABGB + § 346 HGB |
Vertragspartnern muss schon im Rahmen
des Vertragsschlusses – also bei der Konsensbildung – Gelegenheit geboten
werden, in AGB, die Vertragsbestandteil werden sollen, Einsicht
zu nehmen. Das kann auf verschiedene Weise geschehen; zB
dadurch, dass ein Vertragspartner den andern auf das Bestehen von
AGB – mündlich oder schriftlich – aufmerksam macht oder sie zusendet.
Der Hinweis muss aber deutlich sein. | Möglichkeit der
Einsichtsichtnahme |
Hinweise auf der Rückseite eines Bestellscheins
reichen ebenso wenig aus, wie schwer lesbare Hinweise im Kleinstdruck,
wenn auch auf der Vorderseite. | |
Nachträgliches
Verweisen auf AGB, zB auf einem Lieferschein oder
gar erst auf einer Rechnung, reicht nicht aus,
weil die vertragliche Vereinbarung schon vorher getroffen wurde
und ein nachträglich einseitiges Abgehen davon unzulässig ist; pacta
sunt servanda. – Freilich kommt diese Unsitte in der Praxis nicht
selten vor; sei es aus Unwissen, Schlamperei oder Absicht. | Lieferschein oder Rechnung |

|
RdW 1985, 244:
Hinweis auf AGB im Lieferschein wirkungslos – Ohne
Vorliegen besonderer Umstände kann der Hinweis auf AGB des Ausstellers
in Lieferscheinen, Rechnungen oder Gegenscheinen nicht als Anbot
zur Abänderung des bereits abgeschlossenen Vertrags angesehen werden,
da diese ihrer kaufmännischen Funktion nach nicht dazu bestimmt
sind: OGH 9.10.1984, 2 Ob 606/84. | |
|
|
|
Zur Frage, wann
AGB Vertragsinhalt werden: HS X/XI 26 mwH
(1980) – Urlaubsbuchung beim
Club Mediterranée. | |
|
|
|
Vgl auch das Beispiel
in → KAPITEL 8: Eigentumsvorbehalt
als Warensicherungsmittel: SZ 55/134 (1982) – Eigentumsvorbehalt. | |
|
| |
Auch dann, wenn ein Vertrag unter
Zugrundelegen von AGB geschlossen wurde und die konkreten AGB einen
Vertragsteil – zB einen Verbraucher – (gröblich) benachteiligen,
ist noch nicht „aller Tage Abend”. Es besteht die Möglichkeit einer
nachgeschalteten, also einer ex post-Kontrolle durch
die Gerichte. | Möglichkeit der
ex post-Kontrolle |
Die Gerichte prüfen, ob: | |
| •
eine konkrete AGB-Klausel
gegen ein ausdrückliches
Gesetzesgebot verstößt: zB gegen § 864a ABGB (Ungewöhnlichkeits-Klausel),
§ 879 Abs 3 ABGB (gröbliche Benachteiligung) oder gegen Bestimmungen
des KSchG; etwa § 6. | |
| • oder allgemein gegen die guten Sitten (§
879 Abs 1 ABGB). | |
Kurz: AGB dürfen weder gesetz-,
noch sittenwidrig sein; vgl die Rspr-Beispiele → AGB
– Judikaturbeispiele –
Zum Akzeptieren problematischer AGB durch Verbraucher, aber auch
Kaufleute kommt es vor allem dann, wenn diese von der Möglichkeit
der Einsichtnahme in AGB, obwohl sie bestanden hätte, nicht Gebrauch
gemacht haben. Es wird „blindlings” unterschrieben. | AGB dürfen weder gesetz-, noch sittenwidrig
sein |
„Für den Verbraucher
sind besonders solche Vertragsbestimmungen [iSd § 879 ABGB] jedenfalls
nicht verbindlich, ...”: | Unzulässige
Vertragsbestandteile: § 6 Abs 1 KSchG |
| • Etwa unbestimmte
oder überlange Antragsbindung des Verbrauchers | |
| • Überstrenge Zugangserfordernisse | |
| • Ausschluß von Schadenersatz für vorsätzliche
und grob fahrlässige Schädigung | |
| • Beweislastverträge | |
| • Unangemessen kurze Verfallszeiten für überlassene
Sachen | |
| • § 6 Abs 2 KSchG: „sofern ... sie [nicht] im
einzelnen ausgehandelt” [Als nicht im einzelnen „ausgehandelt” iSd
§ 6 Abs 2 KSchG gelten Klauseln /Vertragsbestimmungen vor allem
dann, wenn sie nur in AGB oder Vertragsformblätter aufgenommen und
nicht im einzelnen erörtert wurden.] wurden, gilt das gleiche auch
für folgende Klauseln: | |
| • Ungerechtfertigtes Rücktrittsrecht des Unternehmers | |
| • Vertragsüberbürdung an ungenannte Dritte | |
| • Einseitige Leistungsänderungen | |
| • Ausschluß von Schadenersatz für Schäden an
übernommenen Sachen | |
Wird
eine Klausel oder ein Vertragspassus für gesetz- oder sittenwidrig
erklärt, ist dieser ungültig und wird aus dem Vertrag entfernt.
Der Rest des Vertrags bleibt aber bestehen; sog Teilnichtigkeit oder Restgültigkeit. | Teilnichtigkeit |
Die gerichtliche
ex post-Kontrolle erfolgt entweder als: | Arten der Kontrolle |
| •
Individualkontrolle durch
(Unterlassungs)Klage des Betroffenen nach § 28 Abs 1 KSchG, oder | |
| • Kollektivkontrolle durch Verbandsklage nach
den §§ 28a, 29 KSchG. | |
Klagslegitimiert für eine Verbandsklage sind
nach § 29 KSchG bspw: der Verein für Konsumenteninformation, der ÖGB,
die Bundesarbeitskammer, der Österreichische Seniorenrat oder die
Wirtschaftskammer Österreich. | |
| •
Neu geschaffen
wurde 1997 (BGBl I 6) die Möglichkeit der Abmahnung durch
eine gemäß § 29 KSchG klageberechtigte Institution. – Dadurch kann
ein Prozess vermieden werden, wenn der abgemahnte Unternehmer „binnen
angemessener Frist eine mit angemessener Konventionalstrafe (§ 1336
ABGB) besicherte Unterlassungserklärung abgibt”. | |
 | |

|
OGH 29. 5. 2000, 2 Ob 133/99v, SZ 73/107:
Vom Konto eines Lehrlings werden via Bankomat zweimal 5.000 S abgehoben.
Er behauptet, es liege ein Missbrauch vor und verlangt Gutschrift
in der entsprechenden Höhe. Die Bank hält dem ihre AGB entgegen,
die einen Haftungsausschluss normieren. Es kommt zu einer Verbandsklage;
§ 29 KSchG. – OGH: Der Haftungsausschluss von Banken für technischen Missbrauch
von Bankomatkarten (ohne Verschulden des Kunden) ist im
Gegensatz zum Haftungsausschluss für Missbrauch wegen Verlustes
gemäß § 879 Abs 3 ABGB nichtig. Sofern der richtige PIN-Code verwendet
wurde, spricht der Beweis des ersten Anscheins (prima facie Beweis)
für eine Nutzung der Karte durch den Karteninhaber selbst oder für
eine Verletzung der Geheimhaltungspflicht; dieser Anscheinsbeweis
kann jedoch durch den Karteninhaber dadurch erschüttert werden,
dass er die ernsthafte Möglichkeit eines atypichen Geschehensablaufs
beweist (was dem Lehrling im konkreten Fall gelungen ist). | |
|
III. Verschiedenes
zu AGB | |
1. Wie sind AGB
auszulegen? | |
AGB sind wie Verträge auszulegen
und nicht wie Gesetze; also nach den §§ 914, 915 iVm § 869 ABGB
und nicht nach den §§ 6, 7 ABGB → KAPITEL 11: Gesetzesauslegung:
§§ 6, 7 ABGB.
– Streitig war das insbesondere bei Versicherungsbedingungen, was
kein Zufall war. Denn Versicherungsbedingungen zeichnen sich seit
jeher nicht durch allzu große Verständlichkeit aus. Daher besitzt
die Unklarheitenregel des § 915 ABGB Bedeutung → KAPITEL 11: Die
Unklarheitenregeln der §§ 915, 869 ABGB.
Da die Unklarheitenregel aber nur im Rahmen der Vertragsauslegung
zur Anwendung gelangt, kam diesem Streit Bedeutung zu; denn die
Vorschriften zur Gesetzesauslegung kennen diese Regel nicht! | AGB sind wie
Verträge auszulegen |
2. Abgehen von
AGB im Einzelvertrag? | |
Der Einzelvertrag
kann wiederum von (erstellten) AGB abgehen. Wie erwähnt, ist das
aus tatsächlichen Gründen (Marktmacht etc) aber oft nicht möglich,
weil der „stärkere” Vertragspartner dazu
nicht bereit ist. Konsumenten stehen daher immer wieder vor der
Alternative, einen Vertragsschluss zu den vorgegebenen Bedingungen
zu akzeptieren oder darauf zu verzichten. – Aber man kann und sollte
es durchaus „versuchen” und das Argument, dass das nicht geht, ist
falsch. Es kommt nur auf das Wollen an! | Recht des Stärkeren? |
| |
In einem Rahmenvertrag
regeln beide Vertragspartner die „Geschäftsbedingungen”
für künftige Vertragsschlüsse zwischen ihnen; zB zwischen Generalimporteur
und seinen Abnehmern, zwischen Groß- und Einzelhändler oder einem
Zulieferbetrieb – etwa in der Kfz-Branche – und einem Produktionsbetrieb;
zB Autohersteller. | |
Der Rahmenvertrag verpflichtet selbst
noch zu keiner Leistung oder Abnahme und ist auch nicht Vorvertrag
(iSd § 936 ABGB): Zur Abgrenzung → Vorvertrag
<-> Rahmenverträge Wenn
aber künftig Verträge zwischen beiden Parteien geschlossen werden,
sollen sie zu den im Rahmenvertrag niedergelegten Bedingungen geschehen.
Das privatautonome Vereinbaren eines Rahmenvertrags eröffnet bei
den Parteien die Möglichkeit optimaler Berücksichtigung der eigenen
Interessen und wirtschaftlicher Bedürfnisse bei gleichzeitiger Rationalisierung
für künftige Vertragsschlüsse. Geregelt werden kann darin
alles, was auch sonst in AGB oder Verträgen geregelt werden kann. | Gemeinsam
erstellte AGB für künftige
Vertragsschlüsse |
Man kann
also sagen: Im Rahmenvertrag formulieren die Vertragsparteien gemeinsame
AGB für die gemeinsame geschäftliche Zukunft. – Anders als im Normalfall
werden hier also AGB nicht nur von einem, sondern
von beiden Vertragsteilen gemeinsam erstellt. Daher
kann von einem vereinbarten Rahmenvertrag auch nicht einseitig abgegangen
werden. | Kein einseitiges Abgehen |
| |
Eine
den AGB (und den Rahmenverträgen) vergleichbare Rationalisierungs-
und Vereinheitlichungsfunktion üben auch die sog Önormen aus,
die besonders für Werkverträge und hier wiederum für das Bauvertragsrecht
von praktischer Bedeutung sind. Näheres → KAPITEL 12: ÖNormen
und Haftrücklass. | |
| |
| |
IV. AGB
– Judikaturbeispiele | |
| Zu § 864a ABGB: „Bestimmungen
ungewöhnlichen Inhaltes“ |

|
SZ 62/99
(1989) – Kreditvertrag:
„Die in ein umfangreiches Vertragsformular aufgenommene Klausel, ein Bürge,
der die Haftung für einen zeitlich und der Höhe nach begrenzten
Kredit übernimmt, hafte auch aus allen darüber hinaus mit dem Kreditgeber
abgeschlossenen oder künftig abzuschließenden Kreditverträgen, ist
ungewöhnlich iSd § 864 a ABGB und wird daher nicht Vertragsbestandteil.” | |
|
|
|
Oder: EvBl 1985/148 (VISA-Kreditkarte:
Eine Frau tätigt mit einer Zusatzkarte Einkäufe gegen den Willen
des Hauptkarteninhabers / Ehemann): „Enthalten Geschäftsbedingungen
über Kreditkarten eine Bestimmung, wonach die Wirksamkeit der jederzeit
möglichen Kündigung des Vertrages bezüglich der Zusatzkarte von
der Rücksendung dieser Karte abhängt, so gilt der Vertrag ohne die
die Rücksendung der Karte betreffende Bestimmung, wenn der Kreditkartennehmer
bei Vertragsabschluss [ungenau] dahin informiert worden ist, dass
die Zusatzkarte mit der Zeichnungsberechtigung für ein Konto vergleichbar
sei. Die Bank ist in einem solchen Fall verpflichtet, dem Begehren
‘auf Sperrung der Kreditberechtigung für die Zusatzkarte’ im Rahmen
des ihr Möglichen und Zumutbaren sogleich Rechnung zu tragen.” (Lesenswert) | |
|
|
|
SZ 56/62 (1983) (Kraftfahrzeug-Leasingvertrag):
Die Bestimmung, dass der Leasinggeber den Vertrag fristlos aufkündigen
kann, wenn der Leasingnehmer länger als 30 Tage mit zwei aufeinanderfolgenden Mieten
ganz oder teilweise in Rückstand gerät und der Leasingnehmer in
diesem Fall 50% des noch aushaftenden Restmietzinses als Konventionalstrafe
zu bezahlen hat, ist nicht ungewöhnlich iSd § 864a ABGB. | |
|
|
|
SZ 60/52 (1987) – Welser
Messe: Lässt sich der Verwender von AGB (hier erlässt ein
Messeveranstalter eine Messeordnung) eine den Umständen nach zu
erwartende Dispositionsfreiheit über die von ihm zu erbringende
Leistung (hier Zuweisung der Ausstellungsplätze) einräumen, kann
darin allein noch nicht eine ungewöhnliche Bestimmung gesehen werden. | |
|
|
|
EvBl
1992/109: „Die Vereinbarung einer Stornogebühr als
Gegenleistung für die Einräumung des Rechtes auf Rücktritt vom Vertrag
durch den Vertragspartner ist bei Kauf- und Werkverträgen erfahrungsgemäß
durchaus üblich. Eine solche Klausel in den Verkaufs- und Lieferbedingungen
des Vertragspartners ist daher grundsätzlich selbst für unerfahrene
Vertragspartner nicht überraschend. Die Vereinbarung einer Stornogebühr
in der Höhe des Schadens, den der Vertragspartner tatsächlich erlitten
hat, ist jedenfalls in diesem Umfang [auch] keine gröblich benachteiligende
Vertragsbestimmung iSd § 879 Abs 3 ABGB.” – Zum Storno → KAPITEL 15: Reugeld:
§§ 909 ff ABGB und § 7 KSchG. | |
|
|
|
Vgl neben der eben
erwähnten E EvBl 1992/109 noch folgende En. | |
|
|
|
SZ 57/41 (1984): „Eine
gröblich benachteiligende Klausel in einem Vertragsformblatt über
einen Leasingvertrag liegt darin, dass der Leasinggeber bei
schuldhafter Zerstörung des Leasinggutes durch einen Dritten den
vom Dritten ihm geleisteten bzw den zu erwartenden Schadenersatzbetrag
bei Berechnung der restlichen Leasingraten nicht berücksichtigen
muss.” | |
|
|
|
SZ 63/187 (1990):
„Punkt 13 Abs 1 dritter Satz der AGB der österreichischen
Kreditunternehmungen, wonach die Kreditunternehmung berechtigt
ist, Aufträge auf Grund der Kontonummer durchzuführen, und der Verpflichtung
enthoben ist, die Übereinstimmung zwischen Kontonummer und Empfängernamen
zu prüfen, benachteiligt den im Überweisungsauftrag ausgewiesenen
Zahlungsempfänger gröblich und ist deshalb nichtig. Da dem Überweisungsempfänger
die Hauptleistung zugute kommen soll, ist er in den Schutzbereich
der vertraglichen Beziehungen zwischen dem Überweisenden und der
Bank einbezogen.” | |
|
| |
Lesen Sie dieses Dokument aufmerksam durch.
Sie wissen dann, wie AGB aussehen. Viel bessere Qualität ist auch sonst
kaum zu erwarten. Die Formulierung dieser – unveränderten! – AGB
ist mitunter nicht nur sprachlich unschön, sondern auch unklar und
mancher Passus verstößt gegen gesetzliche Vorschriften, insbesondere
das KSchG. Nicht alle AGB-Punkte sind also unproblematisch. Lesen
Sie daher dieses AGB-Muster mit kritischen Augen! | |
Der Kauf- bzw Liefervertrag kommt erst
durch die schriftliche Auftragsbestätigung unsererseits zustande. Mündliche
Nebenabsprachen sind unverbindlich. Mit der Erteilung des Auftrages
anerkennt der Käufer die nachstehenden Geschäftsbedingungen als
Vertragsbestandteile an. Vertragsbestandteile des Bestellers bzw
des Käufers haben nur Gültigkeit, wenn sie von uns ausdrücklich
oder schriftlich anerkannt werden. | |
Unsere Angebote sind freibleibend. Die
dem Angebot beigefügten Unterlagen, Zeichnungen usw sind für spätere Ausführungen
nicht verbindlich. [?] | |
Der Besteller bzw Käufer anerkennt die
von uns vorgeschriebenen Zahlungskonditionen als verbindlich. Die Aufrechnung
oder Zurückbehaltung wegen irgendwelcher Gegenforderungen, insbesondere
Gewährleistungsansprüche, ist unzulässig. [?] | |
Wir sind stets bestrebt, die vereinbarten
Lieferzeiten nach bestem Wissen und Gewissen pünktlich einzuhalten.
Wird die Lieferung durch Umstände, die wir nicht verschuldet haben,
insbesondere durch Nichteinhaltung der Termine seitens unserer Vorlieferanten,
durch Ereignisse höherer Gewalt, Verkehrsstörungen usw ganz oder
teilweise verzögert, so verlängert sich unsere Lieferzeit um die
Zeit der Behinderung. | |
Schadenersatzansprüche wegen verzögerter
Lieferung sind bei leichter Fahrlässigkeit unsererseits ausgeschlossen. | |
Der von uns zeitgerecht angekündigte
Liefertermin gilt als vereinbart, wenn der Kunde diesem Termin nicht
bis acht Tage davor schriftlich widersprochen hat. Ist der Besteller
zum Lieferzeitpunkt nicht anwesend oder hat er für die Durchführung
der Lieferung nicht die entsprechenden Maßnahmen getroffen, gilt
die Leistung bzw das Werk als vom Besteller übernommen bzw angenommen.
Mit diesem Zeitpunkt gehen alle Risiken und Kosten, wie zB Bankspesen,
Lagerkosten, zu den angemessenen Preisen (Speditionstarif) zu Lasten
des Bestellers. Dies gilt auch bei Teillieferung. | |
Durch Handelsvertreter oder Bevollmächtigte
unserer Unternehmung vermittelte Geschäfte gelten vorbehaltlich
der Genehmigung durch unser Unternehmen. Wir behalten uns vor, Aufträge
ganz oder teilweise ohne Begründung abzulehnen. | |
Alle Liefer-, Zahlungs- oder sonstigen
Vereinbarungen müssen auf dem Auftrag festgehalten werden. Mündliche Vereinbarungen,
die auf dem Auftrag nicht festgehalten sind, haben keine Gültigkeit. | |
Sofort erkennbare Mängel müssen unverzüglich
angezeigt werden. [!] Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsfristen. | |
Handelsüblich oder technisch nicht vermeidbare,
geringfügige Abweichungen berechtigen nicht zur Mängelrüge. Bei
berechtigten Beanstandungen steht es uns zu, innerhalb angemessener
Frist durch unseren Servicedienst den Mangel zu beheben. Geringfügige
Abweichungen bei Naturmaterialien wie Holz und Leder und Abweichungen
bei Farbtönen stellen keinen Mangel dar. Eine erhobene Mängelrüge
berechtigt den Besteller nicht zur Zurückbehaltung des Entgeltes;
der Besteller verzichtet ausdrücklich auf dieses Recht. | |
Schadenersatzansprüche jedweder Art
sind ausgeschlossen. [?] | |
Bei Zahlungsverzug ist der Käufer bzw
Abnehmer verpflichtet, bankmäßige Verzugszinsen zu bezahlen und
die durch die Betreibung der überfälligen Schuld, direkt oder im
Wege einer hiezu in Anspruch genommenen Stelle, entstandenen Kosten
zu ersetzen. [?] | |
Die gelieferten Waren bleiben bis zur
vollständigen Zahlung unserer sämtl aus dem Kaufvertrag bestehenden
Forderungen unser alleiniges Eigentum. | |
Für die Dauer unseres Eigentumsvorbehaltes
verpflichtet sich der Käufer, die gelieferte Ware pflegl und schonend zu
behandeln und uns von einem allfälligen Zugriff Dritter unverzüglich
per Einschreiben zu verständigen. | |
Gerät der Besteller bzw Käufer in Zahlungsverzug
bzw verschlechtert sich seine Kreditwürdigkeit erheblich, oder macht
er von der gelieferten Ware einen erheblich nachteiligen Gebrauch,
sind wir berechtigt, die bei uns in Vorbehaltseigentum stehenden
Waren zurückzunehmen, ohne daß dies einem Rücktritt vom Vertrag
gleichzusetzen ist. | |
Der Besteller verpflichtet sich, bei
Auftragserteilung eine Anzahlung in Höhe von 30% des Auftragsvolumens
zu leisten; der Restbetrag ist spätestens bei Übernahme der Ware
zur Zahlung fällig. | |
Alle Lieferungen erfolgen jeweils nur
zu Tagespreisen. Abzüge laut Konditionen im Auftrag werden nur bei
fristgerechter Zahlungsabfertigung anerkannt. Soweit Wechsel in
Zahlung genommen werden, trägt der Käufer sämtl Bank-, Diskont-
und Einziehungsspesen. Die Gutschrift erfolgt unter Vorbehalt des
Einganges. | |
Verpackungskosten werden branchenüblich
verrechnet. | |
Auch formlose Bestellungen bzw Nachlieferungen
unterliegen diesen Lieferbedingungen, die nur durch eventuell umseitig
angeführte Sondervereinbarungen abgeändert werden können. | |
Bei Lieferung von Möbeln und Einbauküchen
sind im Preis jeweils nur die Normkosten enthalten. Alle Arbeiten
und Leistungen, die über das Aufstellen und Montieren der Möbel
hinausgehen, wie zB Abbauen des alten Bestandes, Änderungen, zusätzliches
Einbauen und ähnliche Arbeiten mehr, müssen von uns separat verrechnet
werden. Lieferungen, bei denen man nicht bis nach Hause fahren kann
sowie alle Arbeiten, die über das normale Arbeitsmaß beim Aufstellen
der Möbel hinausgehen, werden nach der anfallenden Stundenleistung
separat in Rechnung gestellt. | |
Der Käufer bestätigt uns gegenüber durch
Unterfertigung des Montagenachweises die ordnungsgemäße Durchführung
der Einbauarbeiten und die endgültige Übernahme der Ware. | |
Kostenvoranschläge sind grundsätzlich
unverbindlich. Die Erstellung eines Kostenvoranschlages verpflichtet
den Auftragnehmer nicht zur Annahme eines Auftrages auf Durchführung
der im Kostenvoranschlag verzeichneten Leistungen. Kostenvoranschläge
sind grundsätzlich entgeltlich, jedoch wird bei Erzielung eines
Auftrages im Umfang des Kostenvoranschlages bezahltes Entgelt gutgeschrieben.
[?] | |
Entwürfe, Skizzen, Zeichnungen, Planungen
und sonstige Unterlagen stellen unser geistiges Eigentum dar. Sie dürfen
ohne unsere schriftliche Ermächtigung weder kopiert, noch dritten
Personen zugänglich gemacht werden. Diese Unterlagen sind auf unser
Verlangen unverzüglich zurückzugeben. | |
Tritt der Besteller vom Vertrag zurück,
so wird unabhängig von einem etwaigen Verschulden des Bestellers
eine Stornogebühr in der Höhe von 25% des Einzelauftragsvolumens
vereinbart. Darüber hinaus haftet der Besteller dem Lieferanten
für sämtl Kosten, insbesondere der Vorbereitungsarbeiten, Kosten
der Anbotserteilung und dergleichen mehr. [?] | |
Sobald einzelne Produkte der Bestellung
sich in Produktion befinden, ist ein Rücktrittsrecht oder Recht
auf Änderung seitens des Bestellers, aus welchen Gründen auch immer,
ausgeschlossen, und verpflichtet sich der Besteller zur Abnahme
und Bezahlung dieser Werkstücke. [?] | |
Wird Nichtigkeit oder Rechtsungültigkeit
einzelner Bestimmungen festgestellt, so wird dadurch die Rechtswirksamkeit
der übrigen Liefer- und Zahlungsbedingungen nicht berührt. | |
Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung
sowie Gerichtsstand ist – sofern das Gesetz nichts anderes zwingend vorsieht
– Innsbruck. | |
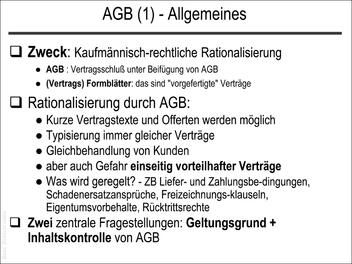 | Abbildung 6.1: Zur Wiederholung: AGB (1) |
|
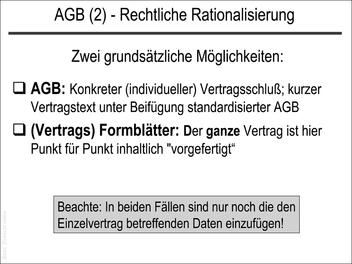 | Abbildung 6.2: Zur Wiederholung: AGB (2) |
|
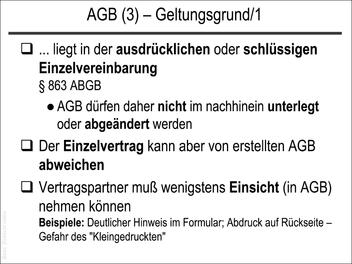 | Abbildung 6.3: Zur Wiederholung: AGB (3) |
|
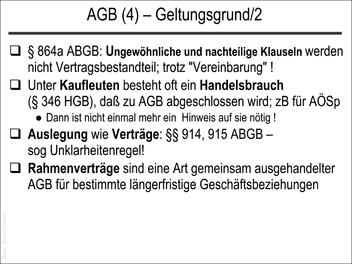 | Abbildung 6.4: Zur Wiederholung: AGB (4) |
|
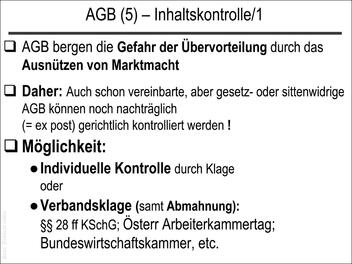 | Abbildung 6.5: Zur Wiederholung: AGB (5) |
|
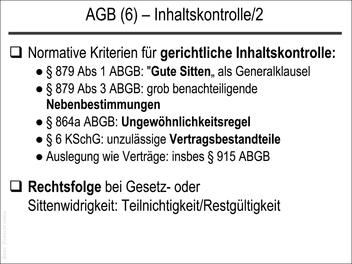 | Abbildung 6.6: Zur Wiederholung: AGB (6) |
|
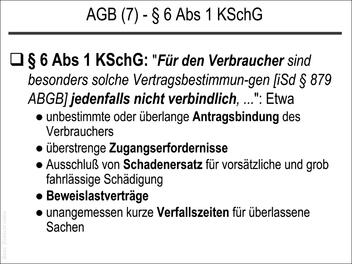 | Abbildung 6.7: Zur Wiederholung: AGB (7) |
|
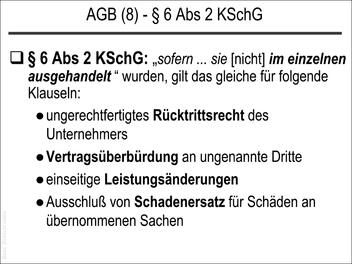 | Abbildung 6.8: Zur Wiederholung: AGB (8) |
|
| |
 Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis |
 B. Cic
– culpa in contrahendo B. Cic
– culpa in contrahendo |
| |

