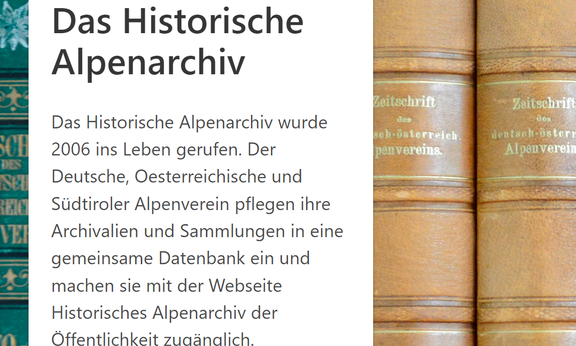Projekte
Projekte, Stipendien und sonstige Drittmittel 2024
Projekte
- Hajnal, Ivo; Kienpointner, Manfred: AKS. Academy of Korean Studies.
Academy of Korean Studies
Korea Foundation
Leopold-Franzens-Universität Innsbruck - Büro der Rektorin
01.10.2014 - 30.09.2024 - Ozerov, Pavel: IMTHim. Interactional information management: A bottom-up approach based on Trans-Himalayan (Sino-Tibetan) languages.
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG), Einzelförderung
01.03.2023 - 30.09.2025 - Pamer, Tobias Karl; Gruber-Tokic, Elisabeth: ViTA. Vernetzung im Tiroler Alpenraum. Digitale Georeferenzierung und Auswertung der Tiroler Grundherrschaften.
Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW), Go!digital
01.03.2023 - 28.02.2025 - Posch, Claudia; Hiebel, Gerald; Rampl, Gerhard: INVENTARIA. The Making of Inventories as Social Practice - Deciphering the Semantic Worlds of Castle Inventories in the Historical Tyrol.
Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF), Einzelprojekt
01.10.2022 - 30.09.2025 - Terbul, Tamara; Rampl, Gerhard: CoCo. Corean Alpine Corpus.
OeAD-GsmbH (Österreichische Austauschdienst) - Austrian Agency for International Cooperation in Education and Research, Technologiestipendien Südostasien
01.10.2022 - 30.09.2024
Stipendien
- Posch, Claudia; Gruber-Tokic, Elisabeth; Hiebel, Gerald; Irschara, Karoline; Peralta Friedburg, Milena; Rampl, Gerhard: DACH2024. Digital Approaches to Cultural Heritage: Perspectives and Challenges.
Leopold-Franzens-Universität Innsbruck - International Relations Office, Staff Incoming
10.09.2024 - 20.09.2024
Projekte, Stipendien und sonstige Drittmittel 2023
Projekte
- Hajnal, Ivo; Kienpointner, Manfred: AKS. Academy of Korean Studies.
Academy of Korean Studies
Korea Foundation
Leopold-Franzens-Universität Innsbruck - Büro der Rektorin
01.10.2014 - 30.09.2024 - Kegyesné Szekeres, Erika; Zipser, Katharina: MakuWi. Marken als Kulturträger. Die kulturvermittelnde Rolle von österreichischen und ungarischen Produkten ¿ eine kontrastive sprachpragmatische Untersuchung, Teil 2 mit wissenschaftlichem Schwerpunkt.
OeAD-GsmbH (Österreichische Austauschdienst) - Austrian Agency for International Cooperation in Education and Research, Wissenschaftlich-Technische Zusammenarbeit (WTZ)
01.09.2022 - 31.08.2023 - Ozerov, Pavel: IMTHim. Interactional information management: A bottom-up approach based on Trans-Himalayan (Sino-Tibetan) languages.
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG), Einzelförderung
01.03.2023 - 30.09.2025 - Pamer, Tobias Karl; Gruber-Tokic, Elisabeth: ViTA. Vernetzung im Tiroler Alpenraum. Digitale Georeferenzierung und Auswertung der Tiroler Grundherrschaften.
Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW), Go!digital
01.03.2023 - 28.02.2025 - Posch, Claudia; Hiebel, Gerald; Rampl, Gerhard: INVENTARIA. The Making of Inventories as Social Practice - Deciphering the Semantic Worlds of Castle Inventories in the Historical Tyrol.
Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF), Einzelprojekt
01.10.2022 - 30.09.2025 - Terbul, Tamara; Rampl, Gerhard: CoCo. Corean Alpine Corpus.
OeAD-GsmbH (Österreichische Austauschdienst) - Austrian Agency for International Cooperation in Education and Research, Technologiestipendien Südostasien
01.10.2022 - 30.09.2024 - Zipser, Katharina; Kegyesné Szekeres, Erika: Corona-Diskurs. Der Corona-Diskurs in Österreich und Ungarn. Linguistische Annäherungen im interkulturellen Kontext.
OeAD-GsmbH (Österreichische Austauschdienst) - Austrian Agency for International Cooperation in Education and Research, Wissenschaftlich-Technische Zusammenarbeit (WTZ)
01.09.2022 - 31.12.2023
Projekte, Stipendien und sonstige Drittmittel 2022
Projekte
- Gruber, Elisabeth; Hiebel, Gerald; Larl, Bettina: TMMMT. Text Mining Medieval Mining Texts.
Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW), Go!digital
01.02.2019 - 31.01.2022 - Gruber-Tokic, Elisabeth: DATA:Stollen. Digitale Aufbereitung, Transkription & Annotation: Stollenverzeichnis Georg Reitler 1666.
Leopold-Franzens-Universität Innsbruck - Vizerektorat für Forschung, Überbrückungsfinanzierung
01.02.2022 - 31.07.2022 - Hajnal, Ivo; Kienpointner, Manfred: AKS. Academy of Korean Studies.
Academy of Korean Studies
Korea Foundation
Leopold-Franzens-Universität Innsbruck - Büro der Rektorin
01.10.2014 - 30.09.2024 - Kegyesné Szekeres, Erika; Zipser, Katharina: MakuWi. Marken als Kulturträger. Die kulturvermittelnde Rolle von österreichischen und ungarischen Produkten ¿ eine kontrastive sprachpragmatische Untersuchung, Teil 2 mit wissenschaftlichem Schwerpunkt.
OeAD-GsmbH (Österreichische Austauschdienst) - Austrian Agency for International Cooperation in Education and Research, Wissenschaftlich-Technische Zusammenarbeit (WTZ)
01.09.2022 - 31.08.2023 - Kegyesné Szekeres, Erika; Zipser, Katharina: MaKu. Marken als Kulturträger. Die kulturvermittelnde Rolle von österreichischen und ungarischen Produkten - eine kontrastive sprachpragmatische Untersuchung.
01.09.2021 - 31.08.2022 - Posch, Claudia; Hiebel, Gerald; Rampl, Gerhard: INVENTARIA. The Making of Inventories as Social Practice - Deciphering the Semantic Worlds of Castle Inventories in the Historical Tyrol.
Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF), Einzelprojekt
01.10.2022 - 30.09.2025 - Posch, Claudia; Irschara, Karoline: MedCorpInn. Retrospective Intersectional Corpuslinguistic Analysis of Radiology Reports of Innsbruck Medical University.
Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW), Go!digital
01.06.2019 - 31.05.2022 - Rampl, Gerhard; Posch, Claudia: GRAT. GRenzüberschreitendes Alpenvereins-Textarchiv.
Alpenverein Südtirol (AVS)
Deutscher Alpenverein e.V. (DAV)
Österreichischer Alpenverein (ÖAV)
01.12.2019 - 31.12.2022 - Terbul, Tamara; Rampl, Gerhard: CoCo. Corean Alpine Corpus.
OeAD-GsmbH (Österreichische Austauschdienst) - Austrian Agency for International Cooperation in Education and Research, Technologiestipendien Südostasien
01.10.2022 - 30.09.2024 - Zipser, Katharina; Kegyesné Szekeres, Erika: Corona-Diskurs. Der Corona-Diskurs in Österreich und Ungarn. Linguistische Annäherungen im interkulturellen Kontext.
OeAD-GsmbH (Österreichische Austauschdienst) - Austrian Agency for International Cooperation in Education and Research, Wissenschaftlich-Technische Zusammenarbeit (WTZ)
01.09.2022 - 31.12.2023
Projekte, Stipendien und sonstige Drittmittel 2021
Projekte
- Gruber, Elisabeth; Hiebel, Gerald; Larl, Bettina: TMMMT. Text Mining Medieval Mining Texts.
Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW), Go!digital
01.02.2019 - 31.01.2022 - Hajnal, Ivo; Kienpointner, Manfred: AKS. Academy of Korean Studies.
Academy of Korean Studies
Korea Foundation
Leopold-Franzens-Universität Innsbruck - Büro der Rektorin
01.10.2014 - 30.09.2024 - Kegyesné Szekeres, Erika; Zipser, Katharina: MaKu. Marken als Kulturträger. Die kulturvermittelnde Rolle von österreichischen und ungarischen Produkten - eine kontrastive sprachpragmatische Untersuchung.
01.09.2021 - 31.08.2022 - Posch, Claudia; Irschara, Karoline: MedCorpInn. Retrospective Intersectional Corpuslinguistic Analysis of Radiology Reports of Innsbruck Medical University.
Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW), Go!digital
01.06.2019 - 31.05.2022 - Rampl, Gerhard; Posch, Claudia: GRAT. GRenzüberschreitendes Alpenvereins-Textarchiv.
Alpenverein Südtirol (AVS)
Deutscher Alpenverein e.V. (DAV)
Österreichischer Alpenverein (ÖAV)
01.12.2019 - 31.12.2022
Projekte, Stipendien und sonstige Drittmittel 2020
Projekte
- Gruber, Elisabeth; Hiebel, Gerald; Larl, Bettina: TMMMT. Text Mining Medieval Mining Texts.
Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW), Go!digital
01.02.2019 - 31.01.2022 - Hajnal, Ivo; Kienpointner, Manfred: AKS. Academy of Korean Studies.
Academy of Korean Studies
Korea Foundation
Leopold-Franzens-Universität Innsbruck - Büro der Rektorin
01.10.2014 - 30.09.2024 - Hiebel, Gerald; Rampl, Gerhard; Posch, Claudia: Sem4MountHist. Semantics for Mountaineering History.
Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW), Go!digital
01.02.2017 - 31.01.2020 - Posch, Claudia; Irschara, Karoline: MedCorpInn. Retrospective Intersectional Corpuslinguistic Analysis of Radiology Reports of Innsbruck Medical University.
Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW), Go!digital
01.06.2019 - 31.05.2022 - Rampl, Gerhard; Hiebel, Gerald; Posch, Claudia: DONSE. Daten neu verknüpfen: ontologische und semantische Transformationen der Inventare-Datenbank 'RaumOrdnungen' für das gemeinsame INVENTARIA-FWF-Projekt und zur Vorbereitung für den Ingest in das dhPLUS -Repository.
Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW), CLARIN-AT und DARIAH-AT
01.01.2020 - 31.12.2020 - Rampl, Gerhard; Posch, Claudia: GRAT. GRenzüberschreitendes Alpenvereins-Textarchiv.
Alpenverein Südtirol (AVS)
Deutscher Alpenverein e.V. (DAV)
Österreichischer Alpenverein (ÖAV)
01.12.2019 - 31.12.2022
Stipendien
- Blassnigg, Julian: OrtPi. Ortschaftsnamen des Pinzgaus - Herkunft und Bedeutung.
Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW), DOC (Doktorandenprogramm)
01.01.2018 - 30.07.2020
Projekte, Stipendien und sonstige Drittmittel 2019
Projekte
- Gruber, Elisabeth; Hiebel, Gerald; Larl, Bettina: TMMMT. Text Mining Medieval Mining Texts.
Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW), Go!digital
01.02.2019 - 31.01.2022 - Hajnal, Ivo; Kienpointner, Manfred: AKS. Academy of Korean Studies.
Academy of Korean Studies
Korea Foundation
Leopold-Franzens-Universität Innsbruck - Büro der Rektorin
01.10.2014 - 30.09.2024 - Hiebel, Gerald; Rampl, Gerhard; Posch, Claudia: Sem4MountHist. Semantics for Mountaineering History.
Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW), Go!digital
01.02.2017 - 31.01.2020 - Posch, Claudia; Irschara, Karoline: MedCorpInn. Retrospective Intersectional Corpuslinguistic Analysis of Radiology Reports of Innsbruck Medical University.
Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW), Go!digital
01.06.2019 - 31.05.2022 - Rampl, Gerhard; Posch, Claudia: GRAT. GRenzüberschreitendes Alpenvereins-Textarchiv.
Alpenverein Südtirol (AVS)
Deutscher Alpenverein e.V. (DAV)
Österreichischer Alpenverein (ÖAV)
01.12.2019 - 31.12.2022
Stipendien
- Blassnigg, Julian: OrtPi. Ortschaftsnamen des Pinzgaus - Herkunft und Bedeutung.
Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW), DOC (Doktorandenprogramm)
01.01.2018 - 30.07.2020
Projekte, Stipendien und sonstige Drittmittel 2018
Projekte
- Hajnal, Ivo; Kienpointner, Manfred: AKS. Academy of Korean Studies.
Academy of Korean Studies
Korea Foundation
Leopold-Franzens-Universität Innsbruck - Büro der Rektorin
01.10.2014 - 30.09.2024 - Hiebel, Gerald; Rampl, Gerhard; Posch, Claudia: Sem4MountHist. Semantics for Mountaineering History.
Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW), Go!digital
01.02.2017 - 31.01.2020 - Kienpointner, Manfred: VVVG. Vorschläge zur Verbesserung der Verständlichkeit der Gerichtssprache.
Bundesministerium für Justiz (BMJ)
01.06.2017 - 31.05.2018 - Larl, Bettina: D:V-TB. Deutsch: verortet Korpuslinguistische Analyse georeferenzierter Twitter-Beiträge aus dem Deutschen Sprachraum.
Tiroler Wissenschaftsförderung (TWF), Nachwuchsförderung
01.04.2017 - 30.09.2018 - Zipser, Katharina; Posch, Claudia; Kienpointner, Manfred; Mussner, Marlene: LWBÖE. Lernerwörterbuch Österreichisch - Englisch.
Alphabet Wörterbuchverlag Gmbh
01.02.2017 - 31.12.2018
Stipendien
- Blassnigg, Julian: OrtPi. Ortschaftsnamen des Pinzgaus - Herkunft und Bedeutung.
Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW), DOC (Doktorandenprogramm)
01.01.2018 - 30.07.2020 - Larl, Bettina: DEVE. Korpuslinguistische Analyse georeferenzierter Twitter-Beiträge aus dem deutschen Sprachraum.
Leopold-Franzens-Universität Innsbruck - Vizerektorat für Forschung, Doktoratsstipendien aus der Nachwuchsförderung der LFU
01.05.2017 - 31.07.2018
Projekte, Stipendien und sonstige Drittmittel 2017
Projekte
- Anreiter, Peter; Mertelseder, Bernhard; Rampl, Gerhard: FluB. Flurnamendokumentation im Bundesland Tirol.
Leitstelle Tirol Gesellschaft mbH
Leopold-Franzens-Universität Innsbruck - Vizerektorat für Forschung
01.12.2009 - 31.10.2017 - Hajnal, Ivo; Kienpointner, Manfred: AKS. Academy of Korean Studies.
Academy of Korean Studies
Korea Foundation
Leopold-Franzens-Universität Innsbruck - Büro der Rektorin
01.10.2014 - 30.09.2024 - Hiebel, Gerald; Rampl, Gerhard; Posch, Claudia: Sem4MountHist. Semantics for Mountaineering History.
Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW), Go!digital
01.02.2017 - 31.01.2020 - Kienpointner, Manfred: VVVG. Vorschläge zur Verbesserung der Verständlichkeit der Gerichtssprache.
Bundesministerium für Justiz (BMJ)
01.06.2017 - 31.05.2018 - Larl, Bettina: D:V-TB. Deutsch: verortet Korpuslinguistische Analyse georeferenzierter Twitter-Beiträge aus dem Deutschen Sprachraum.
Tiroler Wissenschaftsförderung (TWF), Nachwuchsförderung
01.04.2017 - 30.09.2018 - Posch, Claudia; Rampl, Gerhard: Alpenwort. Korpus der Zeitschrift des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins.
Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW), Go!digital
15.10.2014 - 14.10.2017 - Zipser, Katharina; Posch, Claudia; Kienpointner, Manfred; Mussner, Marlene: LWBÖE. Lernerwörterbuch Österreichisch - Englisch.
Alphabet Wörterbuchverlag Gmbh
01.02.2017 - 31.12.2018
Stipendien
- Blassnigg, Julian: OPI. Die Ortsnamen des Pinzgaus. Herkunft und Bedeutung.
Leopold-Franzens-Universität Innsbruck - Vizerektorat für Forschung, Doktoratsstipendien aus der Nachwuchsförderung der LFU
01.02.2017 - 31.07.2017 - Larl, Bettina: DEVE. Korpuslinguistische Analyse georeferenzierter Twitter-Beiträge aus dem deutschen Sprachraum.
Leopold-Franzens-Universität Innsbruck - Vizerektorat für Forschung, Doktoratsstipendien aus der Nachwuchsförderung der LFU
01.05.2017 - 31.07.2018
Projekte, Stipendien und sonstige Drittmittel 2016
Projekte
- Anreiter, Peter; Mertelseder, Bernhard; Rampl, Gerhard: FluB. Flurnamendokumentation im Bundesland Tirol.
Leitstelle Tirol Gesellschaft mbH
Leopold-Franzens-Universität Innsbruck - Vizerektorat für Forschung
01.12.2009 - 31.10.2017 - Gruber, Elisabeth: O.U.T.B. Vergleichende Untersuchung zu den onymischen Umfeldern der Tiroler Bergbauareale.
Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW), DOC (Doktorandenprogramm)
01.03.2014 - 29.02.2016 - Gruber, Elisabeth: OUTB. Onymische Umfelder der Tiroler Bergbauareale.
Tiroler Wissenschaftsförderung (TWF), Nachwuchsförderung
02.01.2014 - 31.05.2016 - Hajnal, Ivo; Kienpointner, Manfred: AKS. Academy of Korean Studies.
Academy of Korean Studies
Korea Foundation
Leopold-Franzens-Universität Innsbruck - Büro der Rektorin
01.10.2014 - 30.09.2024 - Posch, Claudia: KoDis. Berg & Frau. Die Korpuslinguistik als ein Werkzeug zur feministischen Diskursanalyse.
Leopold-Franzens-Universität Innsbruck - Vizerektorat für Forschung, Nachwuchsfördermittel aus der Nachwuchsförderung der LFU
01.09.2014 - 31.08.2016 - Posch, Claudia; Rampl, Gerhard: Alpenwort. Korpus der Zeitschrift des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins.
Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW), Go!digital
15.10.2014 - 14.10.2017 - Windhaber, Irina: WIMuG. Wandelerscheinungen in der Innsbrucker Mundart über drei Generationen.
Tiroler Wissenschaftsförderung (TWF), Nachwuchsförderung
01.01.2015 - 31.05.2016
Projekte, Stipendien und sonstige Drittmittel 2015
Projekte
- Anreiter, Peter; Mertelseder, Bernhard; Rampl, Gerhard: FluB. Flurnamendokumentation im Bundesland Tirol.
Leitstelle Tirol Gesellschaft mbH
Leopold-Franzens-Universität Innsbruck - Vizerektorat für Forschung
01.12.2009 - 31.10.2017 - Gruber, Elisabeth: O.U.T.B. Vergleichende Untersuchung zu den onymischen Umfeldern der Tiroler Bergbauareale.
Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW), DOC (Doktorandenprogramm)
01.03.2014 - 29.02.2016 - Gruber, Elisabeth: OUTB. Onymische Umfelder der Tiroler Bergbauareale.
Tiroler Wissenschaftsförderung (TWF), Nachwuchsförderung
02.01.2014 - 31.05.2016 - Gründhammer, Veronika: MEKO. Medienkommunikation im Netz. Zwischen Massen- und Individualkommunikation.
Tiroler Wissenschaftsförderung (TWF)
02.01.2014 - 10.02.2015 - Hajnal, Ivo; Kienpointner, Manfred: AKS. Academy of Korean Studies.
Academy of Korean Studies
Korea Foundation
Leopold-Franzens-Universität Innsbruck - Büro der Rektorin
01.10.2014 - 30.09.2024 - Posch, Claudia: KoDis. Berg & Frau. Die Korpuslinguistik als ein Werkzeug zur feministischen Diskursanalyse.
Leopold-Franzens-Universität Innsbruck - Vizerektorat für Forschung, Nachwuchsfördermittel aus der Nachwuchsförderung der LFU
01.09.2014 - 31.08.2016 - Posch, Claudia; Rampl, Gerhard: Alpenwort. Korpus der Zeitschrift des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins.
Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW), Go!digital
15.10.2014 - 14.10.2017 - Windhaber, Irina: WIMuG. Wandelerscheinungen in der Innsbrucker Mundart über drei Generationen.
Tiroler Wissenschaftsförderung (TWF), Nachwuchsförderung
01.01.2015 - 31.05.2016
Projekte, Stipendien und sonstige Drittmittel 2014
Projekte
- Anreiter, Peter; Mertelseder, Bernhard; Rampl, Gerhard: FluB. Flurnamendokumentation im Bundesland Tirol.
Leitstelle Tirol Gesellschaft mbH
Leopold-Franzens-Universität Innsbruck - Vizerektorat für Forschung
01.12.2009 - 31.10.2017 - Ertl, Sarah: ASTROTURF. Sozio-kulturelle Auswirkungen von Astroturf und die Einflussnahme auf das Naturverhältnis der Individuen. Eine medientheoretische Analyse.
Tiroler Wissenschaftsförderung (TWF), Nachwuchsförderung
01.04.2012 - 31.08.2014 - Feistmantl, Daniela: HOFa. Onymische Beziehungen zwischen Hof-, Orts- und Familiennamen im Wipptal.
Tiroler Wissenschaftsförderung (TWF), Nachwuchsförderung
01.04.2013 - 31.01.2014 - Gruber, Elisabeth: O.U.T.B. Vergleichende Untersuchung zu den onymischen Umfeldern der Tiroler Bergbauareale.
Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW), DOC (Doktorandenprogramm)
01.03.2014 - 29.02.2016 - Gruber, Elisabeth: OUTB. Onymische Umfelder der Tiroler Bergbauareale.
Tiroler Wissenschaftsförderung (TWF), Nachwuchsförderung
02.01.2014 - 31.05.2016 - Gründhammer, Veronika: MEKO. Medienkommunikation im Netz. Zwischen Massen- und Individualkommunikation.
Tiroler Wissenschaftsförderung (TWF)
02.01.2014 - 10.02.2015 - Hajnal, Ivo; Kienpointner, Manfred: AKS. Academy of Korean Studies.
Academy of Korean Studies
Korea Foundation
Leopold-Franzens-Universität Innsbruck - Büro der Rektorin
01.10.2014 - 30.09.2024 - Kienpointner, Manfred: KLSS. Kontrastive Linguistik und Sprachtypologie mit Schwerpunkt auf Deutsch-Japanisch.
Österreichische Forschungsgemeinschaft (ÖFG), Internationale Kommunikation
01.04.2014 - 31.08.2014 - Posch, Claudia: KoDis. Berg & Frau. Die Korpuslinguistik als ein Werkzeug zur feministischen Diskursanalyse.
Leopold-Franzens-Universität Innsbruck - Vizerektorat für Forschung, Nachwuchsfördermittel aus der Nachwuchsförderung der LFU
01.09.2014 - 31.08.2016 - Posch, Claudia: From Adriana to Yannick. Gender-aspects in Austria¿s naming practices.
Österreichische Forschungsgemeinschaft (ÖFG), Internationale Kommunikation
01.06.2014 - 08.07.2014 - Posch, Claudia; Rampl, Gerhard: Alpenwort. Korpus der Zeitschrift des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins.
Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW), Go!digital
15.10.2014 - 14.10.2017
Stipendien
- Feistmantl, Daniela: Etymologische und redaktionelle Abschlussbearbeitung der onomastischen Projekte WippDigital und HOFa.
Leopold-Franzens-Universität Innsbruck - Vizerektorat für Forschung, Forschungsstipendien an österreichische Graduierte (Beihilfen für Zwecke der Wissenschaft)
01.02.2014 - 31.07.2014 - Rankl, Dagmar: ÖFFME. Öffentlichzkeitsarbeit im Medienwandel - das Kommunikationsverhalten auf den Facebook-Seiten der staatlichen Bahnunternehmen in der Region D-A-CH. Eine komparatistische Analyse.
Leopold-Franzens-Universität Innsbruck - Vizerektorat für Forschung, Doktoratsstipendien aus der Nachwuchsförderung der LFU
01.08.2013 - 31.10.2014
Projekte, Stipendien und sonstige Drittmittel 2013
Projekte
- Anreiter, Peter; Mertelseder, Bernhard; Rampl, Gerhard: FluB. Flurnamendokumentation im Bundesland Tirol.
Leitstelle Tirol Gesellschaft mbH
Leopold-Franzens-Universität Innsbruck - Vizerektorat für Forschung
01.12.2009 - 31.10.2017 - Ertl, Sarah: ASTROTURF. Sozio-kulturelle Auswirkungen von Astroturf und die Einflussnahme auf das Naturverhältnis der Individuen. Eine medientheoretische Analyse.
Tiroler Wissenschaftsförderung (TWF), Nachwuchsförderung
01.04.2012 - 31.08.2014 - Feistmantl, Daniela: HOFa. Onymische Beziehungen zwischen Hof-, Orts- und Familiennamen im Wipptal.
Tiroler Wissenschaftsförderung (TWF), Nachwuchsförderung
01.04.2013 - 31.01.2014 - Posch, Claudia: SPRTEL. Gib dem Kind einen Namen! Vornamengebung in einer globalisierten Welt - das Innsbrucker Sprachtelefon.
Tiroler Wissenschaftsförderung (TWF), Nachwuchsförderung
01.01.2013 - 31.12.2013
Stipendien
- Gruber, Elisabeth: Vergleichende Untersuchung zu den onymischen Umfeldern der Tiroler Bergbauareale.
Leopold-Franzens-Universität Innsbruck - Vizerektorat für Forschung, Doktoratsstipendien aus der Nachwuchsförderung der LFU
01.07.2012 - 31.12.2013 - Jezek, Magdalena Maria: Frühdiagnostik von Sprachentwicklungsstörungen mit Fokus auf bilinguale Kinder.
Leopold-Franzens-Universität Innsbruck - Vizerektorat für Forschung, Doktoratsstipendien aus der Nachwuchsförderung der LFU
01.03.2012 - 31.08.2013 - King, Stefanie: CLEC. Cloud Economy.
Leopold-Franzens-Universität Innsbruck - Vizerektorat für Forschung, Doktoratsstipendien aus der Nachwuchsförderung der LFU
Leopold-Franzens-Universität Innsbruck - Vizerektorat für Forschung, Forschungsstipendien an österreichische Graduierte (Beihilfen für Zwecke der Wissenschaft)
01.03.2012 - 31.08.2013 - Rankl, Dagmar: ÖFFME. Öffentlichzkeitsarbeit im Medienwandel - das Kommunikationsverhalten auf den Facebook-Seiten der staatlichen Bahnunternehmen in der Region D-A-CH. Eine komparatistische Analyse.
Leopold-Franzens-Universität Innsbruck - Vizerektorat für Forschung, Doktoratsstipendien aus der Nachwuchsförderung der LFU
01.08.2013 - 31.10.2014 - Windhaber, Irina: WIMG. Wandelerscheinungen in der Innsbrucker Mundart über drei Generationen.
Leopold-Franzens-Universität Innsbruck - Vizerektorat für Forschung, Doktoratsstipendien aus der Nachwuchsförderung der LFU
01.10.2012 - 30.09.2013
Projekte, Stipendien und sonstige Drittmittel 2012
Projekte
- Anreiter, Peter; Mertelseder, Bernhard; Rampl, Gerhard: FluB. Flurnamendokumentation im Bundesland Tirol.
Leitstelle Tirol Gesellschaft mbH
Leopold-Franzens-Universität Innsbruck - Vizerektorat für Forschung
01.12.2009 - 31.10.2017 - Anreiter, Peter; Moser, Johann: HiMAT. Onomastics in Mining.
Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF), Spezialforschungsbereich (SFB) - Teilprojekt
01.03.2007 - 29.02.2012 (Weblink) - Ertl, Sarah: ASTROTURF. Sozio-kulturelle Auswirkungen von Astroturf und die Einflussnahme auf das Naturverhältnis der Individuen. Eine medientheoretische Analyse.
Tiroler Wissenschaftsförderung (TWF), Nachwuchsförderung
01.04.2012 - 31.08.2014
Stipendien
- Ertl, Sarah: WUW. Soziopolitischer Aktivismus, öffentliche Berichterstattung und Wahrnehmung von Umweltkatastrophen im Web-Zeitalter.
Leopold-Franzens-Universität Innsbruck - Vizerektorat für Forschung, Doktoratsstipendien aus der Nachwuchsförderung der LFU
01.10.2010 - 31.03.2012 - Gruber, Elisabeth: Vergleichende Untersuchung zu den onymischen Umfeldern der Tiroler Bergbauareale.
Leopold-Franzens-Universität Innsbruck - Vizerektorat für Forschung, Doktoratsstipendien aus der Nachwuchsförderung der LFU
01.07.2012 - 31.12.2013 - Jezek, Magdalena Maria: Frühdiagnostik von Sprachentwicklungsstörungen mit Fokus auf bilinguale Kinder.
Leopold-Franzens-Universität Innsbruck - Vizerektorat für Forschung, Doktoratsstipendien aus der Nachwuchsförderung der LFU
01.03.2012 - 31.08.2013 - King, Stefanie: CLEC. Cloud Economy.
Leopold-Franzens-Universität Innsbruck - Vizerektorat für Forschung, Doktoratsstipendien aus der Nachwuchsförderung der LFU
Leopold-Franzens-Universität Innsbruck - Vizerektorat für Forschung, Forschungsstipendien an österreichische Graduierte (Beihilfen für Zwecke der Wissenschaft)
01.03.2012 - 31.08.2013 - Windhaber, Irina: WIMG. Wandelerscheinungen in der Innsbrucker Mundart über drei Generationen.
Leopold-Franzens-Universität Innsbruck - Vizerektorat für Forschung, Doktoratsstipendien aus der Nachwuchsförderung der LFU
01.10.2012 - 30.09.2013
Projekte, Stipendien und sonstige Drittmittel 2011
Projekte
- Anreiter, Peter; Mertelseder, Bernhard; Rampl, Gerhard: FluB. Flurnamendokumentation im Bundesland Tirol.
Leitstelle Tirol Gesellschaft mbH
Leopold-Franzens-Universität Innsbruck - Vizerektorat für Forschung
01.12.2009 - 31.10.2017 - Anreiter, Peter; Moser, Johann: HiMAT. Onomastics in Mining.
Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF), Spezialforschungsbereich (SFB) - Teilprojekt
01.03.2007 - 29.02.2012 (Weblink)
Stipendien
- Ertl, Sarah: WUW. Soziopolitischer Aktivismus, öffentliche Berichterstattung und Wahrnehmung von Umweltkatastrophen im Web-Zeitalter.
Leopold-Franzens-Universität Innsbruck - Vizerektorat für Forschung, Doktoratsstipendien aus der Nachwuchsförderung der LFU
01.10.2010 - 31.03.2012
Projekte, Stipendien und sonstige Drittmittel 2010
Projekte
- Anreiter, Peter; Mertelseder, Bernhard; Rampl, Gerhard: FluB. Flurnamendokumentation im Bundesland Tirol.
Leitstelle Tirol Gesellschaft mbH
Leopold-Franzens-Universität Innsbruck - Vizerektorat für Forschung
01.12.2009 - 31.10.2017 - Anreiter, Peter; Moser, Johann: HiMAT. Onomastics in Mining.
Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF), Spezialforschungsbereich (SFB) - Teilprojekt
01.03.2007 - 29.02.2012 (Weblink) - Kienpointner, Manfred: Latein - Deutsch kontrastiv.
Leopold-Franzens-Universität Innsbruck - Vizerektorat für Forschung, Jubiläumsfonds
03.09.2009 - 31.01.2010
Stipendien
- Ertl, Sarah: WUW. Soziopolitischer Aktivismus, öffentliche Berichterstattung und Wahrnehmung von Umweltkatastrophen im Web-Zeitalter.
Leopold-Franzens-Universität Innsbruck - Vizerektorat für Forschung, Doktoratsstipendien aus der Nachwuchsförderung der LFU
01.10.2010 - 31.03.2012 - Hohenauer-Todd, Theresa: Sprachpolitische Gerechtigkeit. Sprachpolitische Gerechtigkeit? Ein europäischer Vergleich nationaler Sprachtests als Teil der Integration in den Ländern Österreich, Frankreich, England, Spanien und Tschechische Republik.
Leopold-Franzens-Universität Innsbruck - Vizerektorat für Forschung, Doktoratsstipendien aus der Nachwuchsförderung der LFU
01.12.2008 - 31.05.2010 - Merth, Laura: Namenkunde Absam. Flurnamen und Siedlungsnamen der Gemeinde Absam.
Leopold-Franzens-Universität Innsbruck - Vizerektorat für Forschung, Doktoratsstipendien aus der Nachwuchsförderung der LFU
01.09.2009 - 31.07.2010 - Zipser, Katharina: Sprachwandel und Spracherwerb. Sprachwandel und Spracherwerb - Lassen sich moderne Auffassungen zu Sprachwandel und Spracherwerb in Einklang bringen?
Leopold-Franzens-Universität Innsbruck - Vizerektorat für Forschung, Doktoratsstipendien aus der Nachwuchsförderung der LFU
01.02.2009 - 31.01.2010
Projekte, Stipendien und sonstige Drittmittel 2009
Projekte
- Anreiter, Peter; Mertelseder, Bernhard; Rampl, Gerhard: FluB. Flurnamendokumentation im Bundesland Tirol.
Leitstelle Tirol Gesellschaft mbH
Leopold-Franzens-Universität Innsbruck - Vizerektorat für Forschung
01.12.2009 - 31.10.2017 - Anreiter, Peter; Moser, Johann: HiMAT. Onomastics in Mining.
Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF), Spezialforschungsbereich (SFB) - Teilprojekt
01.03.2007 - 29.02.2012 (Weblink) - Kienpointner, Manfred: Latein - Deutsch kontrastiv.
Leopold-Franzens-Universität Innsbruck - Vizerektorat für Forschung, Jubiläumsfonds
03.09.2009 - 31.01.2010 - Rampl, Gerhard: Kulturhistorische Namen-Dokumentation der Alm- und Bergnamen von Innsbruck.
Tiroler Wissenschaftsförderung (TWF)
01.03.2008 - 31.03.2009
Stipendien
- Hohenauer-Todd, Theresa: Sprachpolitische Gerechtigkeit. Sprachpolitische Gerechtigkeit? Ein europäischer Vergleich nationaler Sprachtests als Teil der Integration in den Ländern Österreich, Frankreich, England, Spanien und Tschechische Republik.
Leopold-Franzens-Universität Innsbruck - Vizerektorat für Forschung, Doktoratsstipendien aus der Nachwuchsförderung der LFU
01.12.2008 - 31.05.2010 - Merth, Laura: Namenkunde Absam. Flurnamen und Siedlungsnamen der Gemeinde Absam.
Leopold-Franzens-Universität Innsbruck - Vizerektorat für Forschung, Doktoratsstipendien aus der Nachwuchsförderung der LFU
01.09.2009 - 31.07.2010 - Zipser, Katharina: Sprachwandel und Spracherwerb. Sprachwandel und Spracherwerb - Lassen sich moderne Auffassungen zu Sprachwandel und Spracherwerb in Einklang bringen?
Leopold-Franzens-Universität Innsbruck - Vizerektorat für Forschung, Doktoratsstipendien aus der Nachwuchsförderung der LFU
01.02.2009 - 31.01.2010
Projekte, Stipendien und sonstige Drittmittel 2008
Projekte
- Anreiter, Peter; Moser, Johann: HiMAT. Onomastics in Mining.
Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF), Spezialforschungsbereich (SFB) - Teilprojekt
01.03.2007 - 29.02.2012 (Weblink) - Rampl, Gerhard: Kulturhistorische Namen-Dokumentation der Alm- und Bergnamen von Innsbruck.
Tiroler Wissenschaftsförderung (TWF)
01.03.2008 - 31.03.2009
Stipendien
- Hohenauer-Todd, Theresa: Sprachpolitische Gerechtigkeit. Sprachpolitische Gerechtigkeit? Ein europäischer Vergleich nationaler Sprachtests als Teil der Integration in den Ländern Österreich, Frankreich, England, Spanien und Tschechische Republik.
Leopold-Franzens-Universität Innsbruck - Vizerektorat für Forschung, Doktoratsstipendien aus der Nachwuchsförderung der LFU
01.12.2008 - 31.05.2010
Projekte, Stipendien und sonstige Drittmittel 2007
Projekte
- Anreiter, Peter; Moser, Johann: HiMAT. Onomastics in Mining.
Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF), Spezialforschungsbereich (SFB) - Teilprojekt
01.03.2007 - 29.02.2012 (Weblink) - Kang, Shinhyoung: Korean Studies.
Samsung Electronics Austria GmbH
01.04.2007 - 30.09.2007
Projektwebsites
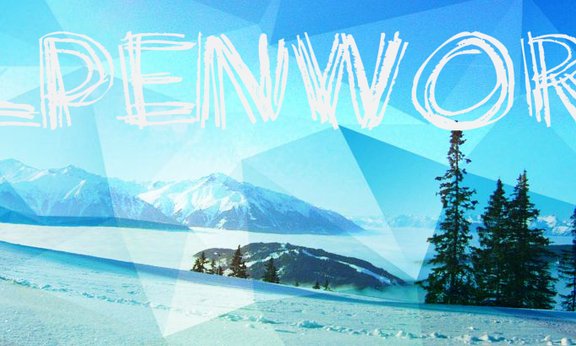
Alpenwort – ein linguistisch annotiertes Korpus
Das Projekt Alpenwort hat die Jahrgänge 1869 – 1998 Zeitschrift des Alpenvereins digitalisiert und mit linguistischer Annotation versehen...

T.M.M.M.T. - Text Mining Medieval Mining Texts
Das Projekt T.M.M.M.T. hat zwei historische Bergbauhandschriften digitalisiert und Informationen zu Namen extrahiert
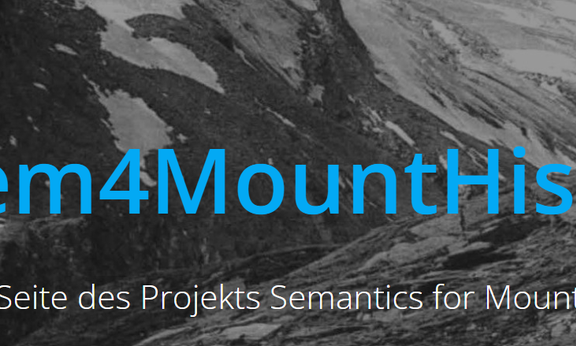
Semantics for Mountaineering History
Das Projekt Semantics for Moutaineering History (Sem4Hist, SEMOHI) hat zum Ziel das Korpus Alpenwort semantisch anzureichern.

Stille Wortgefechte.
A Corpus-Assisted Discourse Analysis of the writings of Jewish Women in Austrian Journalism between 1868 and 1938.
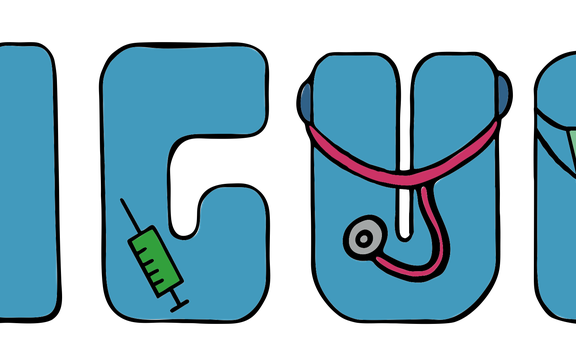
MedCorpInn
Retrospective Intersectional Corpuslinguistic Analysis of Radiology Reports of Innsbruck Medical University.

Flurnamen in Tirol
Ungefähr 120.000 Flurnamen wurden in den 279 Gemeinden Tirols erhoben und in einem geographischen Informationssystem verortet. Nicht zuletzt aufgrund dieser Dokumentation wurden die Flurnamen im Jahr 2018 in das nationale UNESCO-Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes Österreichs aufgenommen.

HiMAT
Das Forschungszentrum HiMAT (History of Mining Activities in Tyrol and adjacent areas – impact on environment and human societies) setzt sich mit den Auswirkungen des Bergbaus auf die Kulturen und die Umwelt im Alpenraum vom Neolithikum bis in die Neuzeit auseinander.

New Zealand Alpine Journal Archive
New Zealand’s alpine heritage at your fingertips - read and search site.

Interaktionales Informationsmanagement: eine empirische, sprachübergreifende Studie transhimalayischer (sino-tibetischer) Sprachen
Im Verlauf eines Diskurses signalisieren verschiedenste linguistische Mittel den spezifischen Beitrag einer Informationseinheit zum Gesamttext. In vorherrschenden Ansätzen zur Informationsstruktur werden diese Mittel deduktiv analysiert, mithilfe vermeintlich universeller Faktoren. Im Gegensatz dazu zielt dieses Projekt darauf ab, Informationsstruktur von einer fundamental empirischen, multifaktoriellen Perspektive aus neu zu erklären.