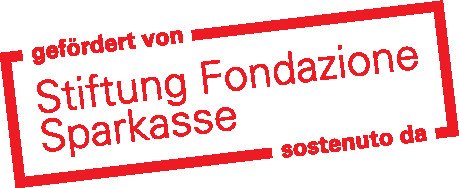Laufzeit: 01. April 2023 bis 31. Mai 2025
Zielsetzung:
Hintergrund des Projektes ist, dass eine wissenschaftliche Aufarbeitung des Themas sexualisierter Gewalt im nahen sozialen Umfeld bislang für Südtirol noch nicht vorliegt. Die Thematik scheint nach wie vor stark tabuisiert und kommt in der öffentlichen Wahrnehmung kaum vor. Eine explorative qualitative Studie soll diese Leerstelle füllen. Ziel der Studie ist es, Entstehungsbedingungen für sexualisierte Gewalt in Südtirol sozialwissenschaftlich zu ergründen, Kulturen und Praktiken des (Ver)Schweigens zu erforschen sowie Grundlagen für die Prävention und Wege der Aufarbeitung zu erarbeiten. Anhand von qualitativen Interviews sollen einerseits gesellschaftliche und institutionell-strukturelle Bedingungen für sexualisierte Gewalt im nahen sozialen Umfeld sowie für das Schweigen darüber erforscht werden. Andererseits soll ein Beitrag dazu geleistet werden, sichtbar zu machen, wie aus der Perspektive der Betroffenen/ Überlebenden eine gelingende Aufarbeitung gestaltet werden kann. Theoretisch verortet ist die Studie in der feministischen sozialwissenschaftlichen Gewaltforschung.
Forschungszugang und Methodik:
Bei der Studie handelt es sich um eine explorative, qualitative Studie. Es wird angestrebt, 30 Betroffene zu befragen, wobei die unterschiedlichen Sprachgruppen Südtirols ausreichend zu berücksichtigen sind. Der Fokus der Studie liegt auf sexuellem Missbrauch im nahen sozialen Umfeld. Dabei soll eine möglichst große Bandbreite an Fällen in der Studie inkludiert werden, d.h. dass aktuelle ebenso wie weit zurückliegende Fälle in den Fokus gerückt und unterschiedliche Settings, in denen der Missbrauch stattgefunden hat, berücksichtigt werden. Da es sich um eine explorative Studie handelt, werden auch weitere, im Laufe der Forschung auftauchende Aspekte und Kriterien bei der Fallauswahl berücksichtigt.
Die Betroffenen werden in der Studie als Expert*innen interviewt, die Aufschlüsse über Entstehungsbedingungen ebenso wie über Wege der Prävention und Aufarbeitung geben können.
Als Ergebnis soll auf der Basis der teilnarrativen Interviews eine Typologie erarbeitet werden, um zu erkennen, unter welchen persönlichen, sozialen, sozio-ökonomischen, kulturellen, räumlichen sowie strukturellen Bedingungen sich sexualisierte Missbrauchskonstellationen und Strukturen des Schweigens zeigen. Zudem soll aus der Sicht der Betroffenen erarbeitet werden, wie eine nachhaltige gesellschaftliche Aufarbeitung gestaltet werden muss.
Rahmen der Studie:
Das Projekt wird vom Land Südtirol, von der Stiftung Südtiroler Sparkasse und der Universität Innsbruck finanziert (Forschungsförderung) und hat eine Laufzeit von 2 Jahren. Das Projektteam besteht aus den beiden Projektleiterinnen Prof. Dr. Gundula Ludwig und Dr. Julia Ganterer sowie der Projektmitarbeiterin Mag. Laura Volgger. Angesiedelt ist die Studie am Center Interdisziplinäre Geschlechterforschung Innsbruck (CGI).
Beirat:
Mag.a dott.ssa Johanna Brunner (Leiterin des Amtes für Ehe und Familie der Diözese Bozen-Brixen)
Dr. Cinzia Cappelletti (Ehem. Leitung der Familienberatungsstelle Lilith in Meran)
Mag. Petra Flieger (Freie Wissenschaftlerin, Innsbruck)
Dr. Veronika Hofinger (Universität Innsbruck)
Georg Lembergh (Fotograf und Filmemacher)
Prof. Dr. Michaela Ralser (Universität Innsbruck)
Dr. Heidi Siller (Universität Klagenfurt)
Martha Verdorfer (Lehrer*in, Historiker*in und Referent*in in der Erwachsenenbildung)
Ass.Prof. Dr. Caroline Voithofer (Universität Innsbruck)

Projektteam
Mag.a Laura Volgger
Projektmitarbeiter*in (sie/ihr)
Center Interdisziplinäre Geschlechterforschung Innsbruck (CGI)
Universität Innsbruck, Ágnes-Heller-Haus, Innrain 52a | 5. Stock | Raum: 05N010
Dr.*in Julia Ganterer, MA
Co-Projektleitung
Center Interdisziplinäre Geschlechterforschung Innsbruck (CGI)
Universität Innsbruck, Ágnes-Heller-Haus, Innrain 52a | 5. Stock | Raum: 05N010
Univ.-Prof.in Dr.in Gundula Ludwig
Projektleitung (sie/ihr)
Leiterin des Center Interdisziplinäre Geschlechterforschung Innsbruck (CGI)
Universität Innsbruck, Ágnes-Heller-Haus, Innrain 52a | 5. Stock | Raum: 05L010
Medienberichte
Studie zu sexualisierter Gewalt in Südtirol
09.05.2023
In den kommenden zwei Jahren wird unter der Leitung des Center Interdisziplinäre Geschlechterforschung CGI der Uni Innsbruck erstmals eine qualitative Studie zu sexualisierter Gewalt in Südtirol unter Berücksichtigung der drei Sprachgruppen durchgeführt. Ziel ist, die Entstehungsbedingungen für sexualisierte Gewalt in Südtirol zu erforschen sowie Kulturen und Praktiken des (Ver-)Schweigens zu untersuchen. Die Ergebnisse sollen auch als Grundlage für die Prävention und Wege der Aufarbeitung dienen.
Veröffentlichung der Fördergelder
Auszahlende Stelle: Stiftung Südtiroler Sparkasse
Betrag: 20.000,00€
Inkassodatum: 22.12.2023
Begründung: Rate 2023
Auszahlende Stelle: Amt für Kinder- und Jugendschutz und soziale Inklusion / AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL
Betrag: 19.701,58 €
Inkassodatum: 03.07.2023
Begründung: Vorschuss Beitrag 2023
Auszahlende Stelle: Universität Innsbruck
Betrag: 27.777,94€
Inkassodatum: 15.12.2022
Begründung: Projektförderung gesamt 2023-2025