Virtuelle Ausstellung
Lehrforschungsformat am Fach Empirische Kulturwissenschaft
Eine Gruppe von 20 BA-Studierenden der Empirischen Kulturwissenschaft an der Universität Innsbruck widmete sich im Wintersemester 2024/25 der Frage, wie Menschen und Tiere in Vergangenheit und Gegenwart zusammenleben, welche tierlichen Spuren sich dazu in musealen Beständen finden lassen und wie unterschiedliche Aspekte einer Mensch-Tier-Geschichte im alpinen Raum anhand ausgewählter Dinge erzählt werden können.
Die hier gezeigten musealen Objekte verweisen auf Tiere und den menschlichen Umgang mit ihnen, aber auch auf die historischen und kulturellen Umstände, in denen sie entstanden, verwendet und aufbewahrt wurden. So lassen Hornlöffel beispielsweise auf eine im 19. Jahrhundert blühende Rinderindustrie in Sterzing schließen. Wolfszähne und Natternketten hingegen verdeutlichen populäre Glaubensvorstellungen und den alltagsweltlichen Umgang mit Kinderkrankheiten. Ein Schaukelpferd aus Gröden verweist auf Kinderarbeit um 1900 und damalige Vorstellungen von Kindheit und Erziehung.
Die Studierenden arbeiteten an dieser virtuellen Ausstellung im Rahmen der Lehrveranstaltung „PS Materielle Kultur und ihre Vermittlung: Tiere im Museum. Eine kulturwissenschaftliche Spurensuche“ am Fach Empirische Kulturwissenschaft. Gemeinsam mit der Lehrveranstaltungsleitung Dr.in Nadja Neuner-Schatz und selbstständig besuchten sie verschiedene museale Kontexte, wählten Objekte aus, recherchierten in den Beständen der Museen und zu wissenschaftlicher Literatur.
Die Lehrveranstaltung wurde in Kooperation mit einer Reihe von regionalen Museen durchgeführt: Tiroler Volkskunstmuseum, Lechmuseum Lech/Zürs, Museum Weiherburg/Alpenzoo und Ötztaler Museen. Die Abbildungen wurden dankenswerterweise großzügig zur Verfügung gestellt.
Mehr zum BA-Studium Europäische Ethnologie
Tiere im Museum

Ausstellungsobjekt Tiroler Volkskunstmuseum
Der Wolfszahn
Das hier gezeigte Objekt ist Teil der Ausstellung „Prekäres Leben“ im Tiroler Volkskunstmuseum Innsbruck. Der tierliche Zahn ist in Silber gefasst und verziert. Er wird in der musealen Objektbeschreibung als sogenannter Wolfszahn angeführt und als Zahnlutscher beschrieben. Vor mehr als 200 Jahren soll er ein Hilfsmittel zum Zahnen bei Kleinkindern gewesen sein. Heute finden sich derartige Objekte oft in volkskundlichen Sammlungen und Museen. Was erzählt aber ein sogenannter „Wolfszahn“ über dessen Gebrauch oder den medizinhistorischen Kontext im alpinen Raum des 18. Jahrhunderts? Das Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens von 1938 vermerkt, das Zahnen bei Kindern sei auch „wölfen“ genannt worden. Der erste kindliche Milchzahn sei in Süddeutschland dann auch als „Wolfszahn“ bekannt gewesen. Zur Verwendung des „Wolfszahnes“, wie er hier abgebildet ist, wusste das Handwörterbuch zu berichten: „Man reibt dem zahnenden Kinde das Zahnfleisch mit einem Wolfszahn, ritzt es mit einem Zahn eines Wolfes, der erlegt wurde als Schnee lag, läßt es auf einen Wolfszahn beißen“ (Hoffman-Krayer, 782).
Das Zahnen – also der Durchbruch der ersten Milchzähne, das bei Kindern ungefähr im Alter von vier bis acht Monaten einsetzt, verursacht oft starke Schmerzen, Unruhe, Fieber und Schlafprobleme. Diese Phase zu unterstützen, wurden früher wie heute verschiedene Hilfs- oder Arzneimittel verwendet. Es sollten dabei die Schmerzen gelindert, aber auch die Heilung der frühkindlichen Begleiterkrankungen unterstützt werden. Aber nicht nur Wolfszähne sollten das Zahnen der Kinder erleichtern: Je nach Region wurden auch Schweins-, Hasen- oder Mäusezähne sowie andere Körperteile verschiedener Tiere gebraucht. Oftmals wurden die Tierzähne auch als Anhänger an Ketten getragen (Andree-Eysn, 143). Halsketten mit Anhängern und Amuletten dienten als Mittel zur Abwehr von Unheil, aber auch von Schmerzen oder Erkrankungen. Unterschiedliche Quellen beschreiben verschiedenste Arten der Förderung von Zahnwachstum und Schmerzlinderung mithilfe von Zahnhalsbändern, die verziert mit Anhängern und Amuletten um den Hals des Kindes gelegt wurden oder heute noch werden (vgl. Gabka, 108). Es ist anzunehmen, dass auch der hier vorliegende Wolfszahn an einer Kette getragen wurde. Darauf deutet die kleine Öse am oberen Ende der Silberfassung hin.

Abbildung 1: Fraisenkette Sammlung Dommuseum Salzburg
Der vorliegende Wolfszahn stammt ursprünglich aus Sterzing im heutigen Südtirol und wird auf das 18. Jahrhundert datiert. Die Herkunft ähnlicher Objekte beispielweise im Germanischen Nationalmuseum Nürnberg und zeitgenössische Beschreibungen über ihre Nutzung legen nahe, dass derartige Wolfszähne vor allem im deutschsprachigen Alpenraum und im Süddeutschen Raum bekannt waren.

Abbildung 2: Ausstellungsobjekt im Germanischen Nationalmuseum Nürnberg
Wolfsfiguren
Wieso kommen Tierzähne und vor allem Wolfszähne zum Einsatz, um bei Zahnungsbeschwerden eines Kindes hilfreich zu sein? Die Figur des Wolfes ist heute aus Haus- und Kindermärchen, wie Der Wolf und die sieben Geißlein oder Rotkäppchen der Gebrüder Grimm bekannt. „Der Wolf“ ist Teil verschiedenster Erzählungen, Mythen und Märchen. Er wird beschrieben als „wild, reißend und bissig, blutgierig, so daß er aus reiner Mordlust ohne Hunger reißt, verwegen, unbezähmbar, grimmig und kampfbegierig“ (Hoffmann-Krayer, 730). In diesen Erzählungen werden Wolfsfiguren stets als Gefahr für Menschen und Tiere dargestellt. Sie verbreiten Angst und Schrecken und stehen für das Böse (vgl. Schenda, 391). In älteren mythologischen Erzählungen nimmt die Figur des Wolfes jedoch auch noch andere Rollen ein. So zum Beispiel als beschützende und begleitende Gestalt in der Gründungssage von Rom, in der die menschlichen Brüder Romulus und Remus dem Mythos nach von einer Wölfin – Lupa Romana – gesäugt wurden.

Abbildung 3: Romulus und Remus Darstellung: Kapitolinische Wölfin
Ein jüngeres Beispiel wäre aber auch Rudyard Kiplings „Dschungelbuch“ (1894), in der das Menschenkind „Mowgli“ von der Wölfin „Raksha“ aufgenommen und großgezogen wird.
Die Wahrnehmung des Wolfes durch den Menschen hat sich im Laufe der Geschichte erheblich verändert. Während der Wolf in der Antike oft positiv oder neutral konnotiert war und auch Stärke oder Schutz verkörperte, verschlechterte sich sein Ansehen ab dem Mittelalter zunehmend. In dieser Zeit begannen die Menschen, insbesondere in Europa, Wölfe zunehmend als Bedrohung und dann auch als Verkörperung des Bösen wahrzunehmen. Dies spiegelte sich auch in Märchen und Geschichten wider. Der Wahrnehmungs- und Bedeutungswandel kann unter anderem auf die wachsende Bedeutung der Landwirtschaft und die damit verbundenen Konflikte zwischen Menschen und Wölfen zurückgeführt werden (vgl. Zimen, 267-269). In dieser Zeit dehnte sich die menschliche Landnutzung aus, man spricht vom mittelalterlichen Landesausbau als „gezieltes, herrschaftliches Programm der Kolonisation“ (Schreg, 53). Die erzählte Figur des Wolfes dient seither als fiktionales oder mediales „Objekt“ und Ziel der „Projektionen menschlicher Ängste“. So geht beispielsweise der schwedische Tierverhaltensforscher und Wolfsexperte Erik Zimen (1941–2003) davon aus, dass Menschen heute in einer „völlig irrationalen Beziehung zu einer Tierart [Wolf] und ihrem Lebensraum [dem Wald] „stehen“. Seine naturwissenschaftliche Interpretation ist, dass sich darin „wohl uralte von unseren Urahnen ererbte Ängste“ manifestieren (Zimen, 274-275). Der historische Bedeutungswandel deutet aber eher auf ein kulturelles Phänomen hin.
Jedenfalls gelten Wölfe seither als gefürchtete Tiere und deren Zähne einzusetzen, hat mit dem Prinzip similia similibus – Ähnliches werde durch Ähnliches geheilt, zu tun (vgl. Baldinger, 123). Es entspricht aber auch dem „früher üblichen Glauben, daß der Seelenstoff übertragbar sei“. Daraus folgerten die Menschen, dass „ein Teil oder Teile eines Körpers, z.B. das Fell oder die Zähne eines Tieres mit dessen Seelenstoff ‚imprägniert‘ seien. Bringt man […] den eigenen Körper mit solchen in Kontakt, so fügt man die Kraft des toten Tieres seiner eigenen hinzu. Dies war ursprünglich die Bedeutung der Wolfszähne für die Zahnung des Kindes“ (Gabka, 134). Der Wolf verkörperte lebendig eine furchteinflößende Bestie, während er im Tod zum Symbol von Stärke und Macht wurde. Dies könnte als eine Form der Resonanz verstanden werden: Indem die Menschen ein Stück des Wolfes tragen, streben sie danach, sich einen Teil seiner Eigenschaften – des Wilden, Animalischen und zugleich Starken – anzueignen. Dadurch versuchen sie, jene Kräfte zu wecken, die dem Wolf zugeschrieben werden, sei es in sich selbst oder in den zu heilenden, zahnenden Kindern.
Der Wolfszahn im Kontext der Medizingeschichte
Das Objekt des Wolfszahnes, das einem Kind zur Unterstützung beim Zahnen um den Hals gehängt wurde, fand vor allem in ländlichen Regionen Verwendung, wo die medizinische Versorgung oftmals unzureichend war (vgl. Hammer-Luza, 329). Heute erscheint „der Amulettgebrauch zu den am weitesten verbreiteten Formen medizinischen Aberglaubens“ zu gehören und einer längst vergangenen Zeit zu entsprechen (Gabka, 106). Aber im 18. und frühen 19. Jahrhundert spielten neben ansässigen oder wandernden Wundärzten – ein damals rein männlicher Beruf, auch sogenannte Volksmediziner, Apotheker und Geistliche sowie Hebammen und Heilerinnen eine tragende Rolle in der medizinischen Versorgung der Bevölkerung (vgl. Hammer-Luza, 329). Das dabei zur Anwendung kommende historische „volksmedizinische Wissen“ war „neben der Sammlung von Erfahrung untrennbar mit Magie und Aberglauben verbunden“. Viele der damaligen „Heilmittel und Behandlungsmethoden, die aus heutiger Sicht magisch determiniert scheinen“, wurden in der frühen „Schulmedizin des 19. Jahrhunderts noch nicht angezweifelt“. Sie „stellten anerkannte Bestandteile der gelehrten ärztlichen Praxis dar“ (Hammer-Luza, 333-334). Erst gegenwärtig und mit der Etablierung der Medizin als naturwissenschaftliche Disziplin wird die „Volksmedizin“ zunehmend als Gegensatz zur „Schulmedizin“ gesehen (vgl. Ehrlich, 117). Aber in der früheren Praxis versprachen auch ungewöhnliche Dinge und Objekte Heilung. Und weil damals insbesondere den Zähnen große Aufmerksamkeit zuteilwurde, um den allgemeinen Gesundheitszustand der betreffenden Person anzuzeigen, gab es auch viele Utensilien sie zu heilen. Wer schwache Zähne hatte, dem wurde auch ein schwacher oder kränklicher Körper attestiert. Das gesunde Wachstum der Zähne war demnach ein wichtiger Faktor (vgl. Baldinger, 118). Amulette und Tierzahn-Anhänger wurden dann wohl auch bei anderen Zahnleiden, wie Zahnschmerzen oder Zahnverlust und nicht nur bei Kindern, sondern auch Erwachsenen eingesetzt (vgl. Baldinger, 126). Gerade für die damals wie heute kritischen Zeiten von Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und Kleinkindalter scheint es viele Schutzangebote und präventive, wie akute (magische) Hilfsmittel zur Abwehr oder Beeinflussung möglicher übernatürlicher Mächte gegeben zu haben. Der Wolfszahn kann hier in das „weite Feld der magia naturalis, der schützenden Amulette, heilenden Steine, der dämonen- und krankheitsabwehrenden Segen und Beschwörungen“ und mithin zu den „Objekte[n] alternativer Medizin, der Talismane und Breverl sowie anderer Schutzmittel“ (Daxelmüller, 56-57) gezählt werden. So fand er wohl auch Verwendung in der (land-)ärztlichen Praxis (vgl. Labouvie, 272). Die Verzierungen und die Fassung aus Silber beim hier gezeigten Wolfszahn aus dem Tiroler Volkskunstmuseum lassen jedenfalls vermuten, dass er aus wohlhabenderen Verhältnissen stammt. Dort zählten Wolfszähne, Amulette und Schutzketten zur sogenannten „Hausapotheke“ (vgl. Grabner, 44).
Aberglaube und Wolfszahn
Die Amulette, Wolfszähne und anderen Objekte der damaligen „Volksmedizin“ zeigen an, dass der Alltag der Menschen im 18. und noch im 19. Jahrhundert von historischen Vorstellungen geprägt war, die wir heute häufig als Aberglauben und Magie bezeichnen. Die Wirksamkeit des Wolfszahnes ist nach heutigen Maßstäben nicht wissenschaftlich belegbar. Zwar verschafft das Massieren und Kauen oder Lutschen während des Zahnens Linderung, doch dafür wären auch andere Gegenstände geeignet. Aber die „Grenze zwischen Glauben und Erfahrung“, auch zwischen „den Bereichen, die man als Glaube und Aberglaube“ trennt, scheint fließend und historisch variabel zu sein (Wagner, 1). Heute ist der Begriff Aberglaube vorwiegend negativ behaftet, deutet auf Irr-Glauben und den Glauben an naturgesetzlich nicht erklärbare Dinge oder Kräfte hin (vgl. Weber, 2). Auch wird Aberglaube mit Magie und Zauberei in Verbindung gebracht (vgl. Daxelmüller, 55). Aber für die Menschen damals scheinen die Amulette, Fraisenketten und magischen Objekte eine große Rolle gespielt zu haben. Frühere Volkskundler:innen wie Marie Andree-Eysn (1847–1929) suchten sich ihre Wirkung zu erklären: „Fragt man schließlich, wie es kommt, daß fort und fort, durch Jahrtausende die Amulette sich erhalten haben, so hat man nur die Antwort, daß der Glaube an sie wohl eine Suggestion hervorruft, die schützend und heilend einzuwirken vermag. Wird durch irgend etwas eine günstige Wirkung hervorgerufen, so wird des Amuletts gedacht, im ungünstigen aber, daß es nicht im „richtigen Glauben“ getragen wurde“ (Andree-Eysn, 146). Für diese Art der Heilwirkung spielt die Symbolik des Wolfes (und seines Zahnes) eine wichtige Rolle, weil Bilder oder Symboliken im engen Zusammenhang mit magischen Vorstellungen stehen: „Der Mensch fasst seine Umwelt zusammen, um den Überblick über deren Komplexität behalten zu können. Dafür schafft und benutzt er Bilder; sie spiegeln die von ihm wahrgenommene Realität wider“ (Daxelmüller, 41). Dem zugrunde liegt ein Weltbild, in dem Menschen, Tiere und Natur in einem engen Zusammenhang stehen und alles miteinander verbunden ist (vgl. Rieken, 136).
Kindheit und die Rolle des Kindes im 18. Jahrhundert
Die Zeit des 18. Jahrhunderts, die Zeit, aus der der Wolfszahn stammen soll, war in vielerlei Hinsicht wohl eine Zeit des Umbruchs und der Veränderung. Gerade zum Ende des Jahrhunderts dringt das Zeitalter der Aufklärung – ausgehend von den Städten - auch nach und nach in die ländlicheren Gegenden vor. Nicht nur in der Medizin gab es kontroverse Meinungen hinsichtlich der Wirksamkeit und Verwendung von volksmedizinischen Objekten wie dem Wolfszahn. Auch die Sozialstruktur veränderte sich, es bildete sich allmählich das städtische Bürgertum zu einer treibenden politischen Kraft aus und damit kamen neue Ideal für das gesellschaftliche wie private Zusammenleben auf. Allmählich wurde die Kindheit als besondere Lebensphase wahrgenommen: „In den traditionellen Hauswirtschaften nahmen Kinder keine Sonderstellung ein. Ihr ‚Wert‘ bestimmte sich nach dem gleichen Maßstab wie der aller anderen Mitglieder der Hausgemeinschaft: nach ihrem Nutzen als Arbeitskraft“ (Peikert, 116). Vermittelt im Ideal einer bürgerlichen Familie mit strengen Geschlechterrollenbildern wurde den Kindern immer mehr Aufmerksamkeit der Mutter zuteil. Eine Fülle von Ratgebern über die Behandlung und Erziehung von Kindern dokumentiert die öffentliche Debatte darüber (vgl. Peikert, 116-118). Auch die „richtige“ Pflege von (Klein-)Kindern, um deren gesundes Heranwachsen zu befördern, war nun von größerer Bedeutung (vgl. Peikert, 124-125). „Noch für das 18. Jahrhundert kann aus den Daten geschlossen werden, daß ein Drittel bis ein Fünftel der zahlreichen Neugeborenen nicht einmal ihr erstes Lebensjahr vollendeten“ und der „Grund dafür war Not, mangelnde Hygiene und medizinische Unkenntnis sowie als Folge davon ein ungeheurer Aberglaube“ (Weber-Kellermann, 25-26). Die ländliche Bevölkerung war also angewiesen auf etwaige Volksmediziner, die vielleicht auch den Gebrauch magischer Hilfsmittel[IMW1] empfohlen. „Das Prekäre Leben“ – der Titel der Ausstellung, in der auch der Wolfszahn zu sehen ist – „rückt das Sorgenvolle, Schutzsuchende, Belastende oder Beklemmende, das in Objekte hineingelegt wurde, in den Mittelpunkt“. Diese großen und kleinen, abgegriffenen und kostbaren Dinge, sind die „materiellen Relikte dieser Angst- und Schutzkultur“. Sie „transportieren heute wohl nur mehr eine graue Ahnung jener Ängste und Sorgen, denen sie einst entgegentreten sollten und denen sie ihre eigentliche Entstehung verdanken“ erklärt Karl Berger, Leiter der Tiroler Volkskunstmuseums (Berger, 496). So lässt auch der in Silber gefasste, kleinteilig verzierte, angekratzte, gelblich-braun verfärbte, sichelförmige Wolfszahn, die Sorge um den Schutz von Kleinkindern erahnen. In welchem tierlichen Mund er aber wohl gewachsen war, aus welchem Tierkörper – lebendig oder tot – er entfernt wurde und wie die Lebensumstände des davon betroffenen Tieres waren, davon ist nichts mehr zu erfahren.
Literatur
Baldinger, Max: Aberglaube und Volksmedizin in der Zahnheilkunde. In: Grabner, Elfriede (Hg.) Volksmedizin. Probleme und Forschungsgeschichte, Darmstadt 1967.
Berger, Karl: Musealisierte Sorgen. In: Kreissl, Eva (Hg.): Kulturtechnik Aberglaube. Zwischen Aufklärung und Spiritualität. Strategien zur Rationalisierung des Zufalls, Bielefeld 2013, S. 487- 504.
Daxelmüller, Christoph: Aberglaube. Überlegungen zur Macht der Bilder. In: Kreissl, Eva (Hg.): Kulturtechnik Aberglaube. Zwischen Aufklärung und Spiritualität. Strategien zur Rationalisierung des Zufalls, Bielefeld 2013, S. 41-82.
Ehrlich, Anna: Ärzte, Bader, Scharlatane. Die Geschichte der Heilkunst in Österreich, Wien 2007.
Gabka, Joachim: Die erste Zahnung in der Geschichte des Aberglaubens, der Volksmedizin und Medizin. Ein Beitrag zur Transformation eines Krankheitsbildes, Berlin 1971.
Germanisches Nationalmuseum Nürnberg, Sammlung: https://objektkatalog.gnm.de/wisski/navigate/82310/view (Stand 14.1.2025)
Grabner, Elfriede: Die kleine „Hausapotheke". Himmlische und irdische „Arzneimittel" zur Heilung irdischer Leiden. In: Amulette, Medaillen und Andachtsbildchen, Salzburg 2010.
Hammer-Luza, Elke: Perlmilch, Krötenfuß und Menschenfett. In: Kreissl, Eva (Hg.): Kulturtechnik Aberglaube. Zwischen Aufklärung und Spiritualität. Strategien zur Rationalisierung des Zufalls, Bielefeld 2013, 327-358.
Hoffman-Krayer, Eduard/Bächthold-Stäubli, Hanns (Hg.): Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens (Bd. 9), Berlin 1938.
Labouvie, Eva: „Gauckeleyen“ und „ungeziemende abergläubische Seegensprüchereyen“. Magische Praktiken um Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. In: Kreissl, Eva (Hg.): Kulturtechnik Aberglaube. Zwischen Aufklärung und Spiritualität. Strategien zur Rationalisierung des Zufalls, Bielefeld 2013, S. 271-297.
Peikert, Ingrid: Zur Geschichte der Kindheit im 18. und 19. Jahrhundert. Einige Entwicklungstendenzen. In: Reif, Heinz (Hg.): Die Familie in der Geschichte, Göttingen, 1982.
Rieken, Bernd: Aberglaube in der psychotherapeutischen Praxis. Aus Sicht der Psychoanalyse, Ethnologie und volkskundlichen Erzählung. In: Kreissl, Eva (Hg.): Kulturtechnik Aberglaube. Zwischen Aufklärung und Spiritualität. Strategien zur Rationalisierung des Zufalls, Bielefeld 2013, S. 125- 144.
Schenda, Rudolf: Das ABC der Tiere. Märchen, Mythen und Geschichten, München 1995.
Schreg, Rainer: Kolonisation und Landnahme von Marginal- und Ungunsträumen.
Mythen, Paradigmen und Ideologien und ihre Auswirkungen auf moderne Vorstellungen zum mittelalterlichen Landesausbau. Online unter: https://fis.uni-bamberg.de/server/api/core/bitstreams/5c070a0d-21bb-4663-becf-8981152bfa39/content
Zimen, Erik: Der Wolf. Mythos und Verhalten, Wien/München 1978.
Weber-Kellermann, Ingeborg: Die Kindheit. Eine Kulturgeschichte, Frankfurt am Main, 1979.

Ausstellungsobjekt Tiroler Volkskunstmuseum
Das Schaukelpferd aus Gröden
In der Ausstellung Das pralle Jahr im Volkskunstmuseum Innsbruck findet sich ein besonderes Objekt. Es ist ein Schaukelpferd, das im 19. Jahrhundert aus Zirbenholz gefertigt und bunt bemalt wurde, um als Spielzeug verkauft zu werden. Es ist ein Gegenstand, wie er typischerweise in Gröden in Südtirol geschnitzt und hergestellt wurde. Seine Geschichte verbindet Vergangenheit und Gegenwart. Sie erzählt von Kinderspielen in bürgerlichen Wohnzimmern und Kinderarbeit in den armen Stuben der Alpentäler.
Mitte des 18. Jahrhunderts begann sich in Gröden der Handel mit Holzschnitzereien zu intensivieren (Demetz 1987:15-17). Neben der Holzbildhauerei vor allem für Kirchen und sakrale Bauten, wurde auch der Handel mit Holzschnitzereien immer wichtiger. Es entstand eine vorindustrielle Art der Serienproduktion, die im sogenannten Verlagssystem organisiert war. Schnitzer*innen arbeiteten zu Hause und produzierten meistens dieselben Figuren, während Händler*innen den Verkauf übernahmen. Dieses System bot größere Verkaufschancen und weniger finanzielle Risiken, machte die Schnitzer*innen jedoch von den Händler*innen abhängig (Demetz 1987:20). Ganze Haushalte und auch einheimische Kinder arbeiteten an geschnitzten Figuren und Masken oder Puppen und anderem Spielzeug. Sie halfen beim Schnitzen und Bemalen oder Zusammenbauen der Einzelteile. Die Arbeit war hart und dauerte oft 12 Stunden am Tag (Büchner 2011: 151). Die Spielzeuge aus Südtirol wurden dann europaweit abgesetzt. Typisch sind Holzgliederpuppen, die in Gröden gefertigt, nach Holland gehandelt und dann nach England exportiert wurden, um dort aufgrund ihres langen Handelsweges als „holländische Puppen“ bekannt zu werden.

Abbildung 1: Sogenannte Holländische Puppe, online unter: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/01/Gliederpuppe.jpg/250px-Gliederpuppe.jpg
Die Fertigung der Grödner Schaukelpferde
Zu den typischen Grödner Holzspielzeugen gehören auch die Schaukelpferde, die in mehreren Arbeitsschritten gefertigt wurden. Die geschnitzten Figuren wurden zunächst grundiert, dazu wurde meist sogenanntes Gesso aufgetragen, das eine Mischung aus Tierleim, Kreide oder Gips und weißem Pigment ist. Darauf folgte die Bemalung, oft in Ölfarben, mit charakteristischen
Fleckmustern. Die Mähne der Grödner Schaukelpferde wurde traditionell aus Rinderschwänzen gefertigt. Die Augen aus Glas und die sorgfältig bemalten Hufe verliehen dem Spielzeug ein lebendiges Erscheinungsbild (Mullins 1992: 55). Die fehlende anatomische Präzision und die statische Haltung spiegeln wohl mehr die Vorlieben der Zeit, als die künstlerischen Möglichkeiten der Zeit wider. Denn die Darstellung galoppierende Pferde unterlag sich ändernden Vorstellungen. Zunächst war die Ansicht verbreitet, dass nie alle Hufe gleichzeitig den Boden verlassen könnten. Bereits Künstler*innen im antiken Ägypten, Griechenland und Rom stellten galoppierende Pferde demgemäß dar und diese Darstellungsweise hielt sich bis ins 18. Jahrhundert (Mullins 1992: 50-59). Im späten 18. Jahrhundert führten englische Sportmaler dann den sogenannten „fliegenden Galopp“ ein, bei dem alle Pferdebeine zugleich in der Luft waren, um Dynamik darzustellen. Diese Darstellungsweise setzte sich ab 1820 durch und dominierte das 19. Jahrhundert. Erst Eadward Muybridges Fotografien von 1887 zeigten den Bewegungsablauf galoppierender Pferde und ließen die Darstellungen realitätsnäher werden. Der „fliegende Galopp“ blieb aufgrund seiner Symmetrie und Stabilität, insbesondere bei Schaukelpferden auf den Kufen, erhalten. Heute gelten Modelle mit geraden Hinterbeinen als frühe Varianten (vgl.ebd: 33-35).
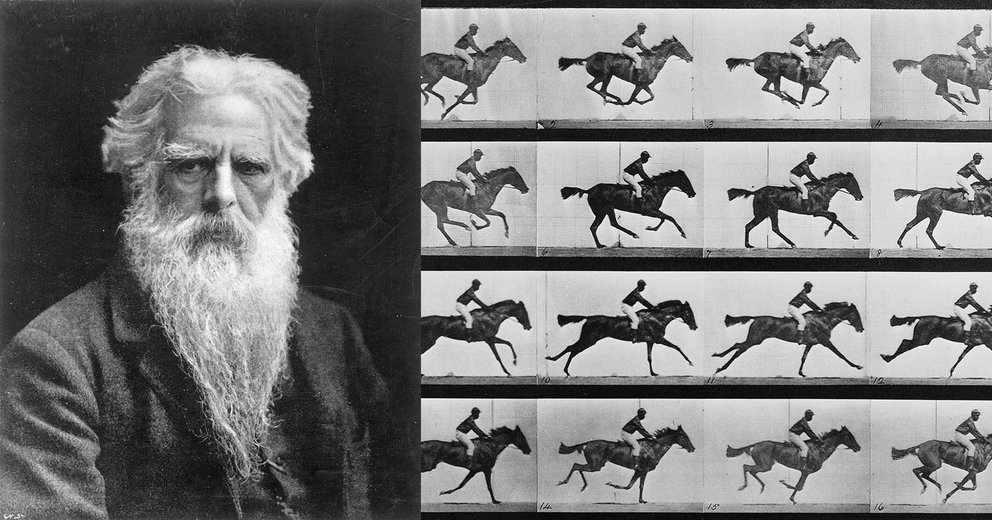
Abbildung 2: Eadward Muybridges Fotografien von 1887, online unter: https://petapixel.com/assets/uploads/2022/08/eadweard-muybridge-featured.jpg
Spielzeug und Erziehungsmittel
Spielzeuggegenstände für Kinder wie dieses Schaukelpferd sind Teil eines erzieherischen Prozesses. An ihnen lernen Kinder, erlangen neue Erkenntnisse und Fähigkeiten (Kling 2014). Mit ihnen werden soziale Rollen, Normen und Ideale vermittelt. In dieser Funktion wurde Spielzeug oft primär als Mittel zur sozialen Erziehung verstanden. In der Übung mit dem Spielzeug sollten Kinder – so beispielsweise im höfischen Kontext um 1800 – für ihre zukünftigen gesellschaftlichen Aufgaben als Erwachsene vorbereitet werden (Weber-Kellermann: 70-85). Besonders deutlich wird das an Spielzeug, das die gesellschaftlichen Erwartungen und Geschlechterrollenbilder der damaligen Zeit transportiert, darunter beispielweise Holzschwerter, die für zukünftige Männer vorgesehen waren oder eben Puppen, die für die Rolle als Mutter vorbereiten sollten. So stattete man im England des 19. Jahrhunderts Schaukelpferde mit sogenannten Damensätteln aus, da das Reiten im Damensattel ein beliebter Reitstil unter Frauen der gehobenen Gesellschaft geworden war, obwohl dieser Satteltyp sehr unsicher war und oft für Stürze vom Dressurpferd sorgte
(Mullins 1992: 38-42). Hier wird besonders gut sichtbar, dass und wie sich bestimmte Frauenideale über Spielzeug in die Alltage der Kinderzimmer vermitteln ließen. Von den Kindern wurde erwartet, sich die für sie vorgesehen Rolle und Haltung anzueignen. Heutige Gender-Forscher*innen kritisieren, dass derartige Rollenbilder und Erwartungen tief in der Gesellschaft verankert sind, obwohl es keine biologischen Gründe dafür gibt (Gürtler 2015).
Wer kann spielen?
Dort, wo das Grödner Schaukelpferd hergestellt wurde, in den armen Stuben der südlichen Alpentäler verlebten Kinder eine Kindheit, die von Hunger, Armut und harter Arbeit geprägt war. Von Tirol und Südtirol, Vorarlberg und Graubünden, aber auch Gebieten in der Schweiz und Liechtenstein wurden Kinder in dieser Zeit fortgeschickt, um als sogenannte Schwabenkinder ihr Auskommen in Süddeutschland zu finden. Sie mussten fern von Zuhause auf großen landwirtschaftlichen Betrieben mithelfen. Und auch die Grödner Kinder dieser Zeit mussten ihren Teil zum Auskommen der Familien beitragen, entweder in den Schnitzstuben oder anderswo. Nur wenige Kinder in privilegierten Verhältnissen wuchsen unter besseren Bedingungen auf, konnten freie Zeit für Spiel und Sport sowie Bildung genießen. Der Großteil der Kinder des 19. Jahrhunderts musste bereits nach wenigen Jahren Schulbildung in Fabriken oder Handwerksberufen arbeiten (Weber-Kellermann 1997: 156-190). Im 19. Jahrhundert beeinflusste also die soziale Zugehörigkeit auch den Zugang zu Spielzeug und dieses blieb noch lange ungleich verteilt (Weber-Kellermann 1997:192-212). Das Schaukelpferd aus Gröden ist ein bedeutendes Beispiel für diese Wechselwirkungen zwischen Handwerk, Sozialstruktur und Erziehung. Es zeigt sowohl wirtschaftlichen Umbrüche durch die Industrialisierung als auch die Verankerung von Geschlechterrollen im Spielzeug und wie dieses zur Sozialisierung von Kindern genutzt wurde.

Inszenierung der Figur des "Saltners" anlässlich des "Traubenfestes" in Meran
Der Saltner

Abbildung 1: Fotografische Inszenierung des "Saltners"
„Ich bin Walter der Saltner. Man kennt mich auch als Weinberghüter. Meine Aufgabe ist es die Trauben auf dem Weinberg vor DiebInnen zu schützen. Dafür bewache ich den Weinberg Tag und Nacht. Ich trage dabei meine berüchtigte Tracht, bestehend aus einer Lederhose mit Hosenträgern, einer Lederjacke, darunter einer Weste und einem breiten Bauchgurt. Dazu trage ich kurze Schuhe mit Kniestrümpfen und Garmaschen. In der Hand halte ich eine Speer. Um den Hals trage ich eine Kette mit Muscheln und Eberzähnen und auf dem Kopf habe ich einen Dreispitzhut, der geschmückt ist mit Federn, Eichhörnchen- und Fuchsschwänzen. Warum ich das alles trage? Gute Frage!“ Der Saltner ist eine sagenumwobene Figur. Auf zahlreichen Postkarten aus dem 19. Jahrhundert ist er abgebildet.

Abbildung 2: Postkarte mit historischem Ausstellungsobjekt "Saltner" im Tiroler Volkskunstmuseum
Zum Beruf des Weinberghüters
Der Begriff Saltner, kommt aus dem lateinischen von “Saltuarius” und bedeutet Waldhüter. [1] Die Aufgabe der Saltner bestand im Wesentlichen darin, die Trauben in ihren Hutbezirken, also den Weinbergen, denen sie zum Bewachen zugeteilt waren, vor menschlichen und tierischen DiebInnen zu schützen. Dazu patrouillierten die Saltner bei Tag und Nacht durch die Weinberge. Sie Bauten Zäune, welche sie meist mit Dornengestrüpp umrankten, um das Eindringen für mögliche DiebInnen zu erschweren. Außerdem mussten Saltner zu jeder Tages- und Nachtzeit während ihrer Einstellung dienstbereit sein. Im Fall von Hochwasser oder Bränden in den Gemeinden, die sie beschäftigten, wurde erwartet, dass die Saltner zu Hilfe eilten. Der Beruf des Saltners wurde ausschließlich von Männern ausgeübt. Ihre beruflichen Bedingungen, Pflichten, Entlohnung, die zu tragende Kleidung etc. wurde dabei in sogenannten Saltnerordnungen festgeschrieben. Die ersten Saltnerordnungen stammen vom Ende des Mittelalters und reichen bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts. Die konkreten Ordnungen variieren je nach Gemeinde.[2] Literarische Aufzeichnungen oder bildliche Abbildungen und später auch Fotografien stammen meist aus dem Südtiroler und Tiroler Raum. Die ersten bildlichen Darstellungen von Saltnern stammen aus dem 19 Jahrhundert. Diese Abbildungen zeigen Männer, die schlichte, praktikable Kleidung tragen und einen Speer mit sich führen. Ihr Hut wird meist von einer Feder geschmückt. Die Saltner tragen einen sogenannten Koller, das ist eine lederne Kragenjacke, über einer roten Weste und darunter eine Lederhose, mit Hosenträgern. Dazu kommt ein stabiler, lederner Bauchgurt – der sogenannte Ranzen – und die wollenen Kniestrümpfe sowie festes Schuhwerk. Erst in zeitlich späteren, also jüngeren, Abbildungen und Fotografien wird die Kleidung auffallender, ausgeschmückt und aufwendig. So wird dann der Dreispitzhut wird mit Federn verschiedener Vögel geschmückt. An seinen Ecken hängen die präparierten Schwänze von Füchsen und Eichhörnchen bis auf die Schultern des Saltners herab (siehe Abb. 2). Und um den Hals tragen Saltner üppige Ketten mit Eberzähnen und Muscheln. Auch die Ranzen werden zunehmend ausgefallener, mit Verzierungen und ins Leder eingravierten oder genieteten Mustern.

Abbildung 3: Ausstellungsobjekt im Tiroler Volkskunstmuseum
Erfundene Traditionen
Diese Veränderungen lassen sich ab der zweiten Hälfte des 19 Jahrhunderts feststellen. Ganz besonders betraf das zunächst die Saltner aus Meran, die zu prägenden Figuren wurden. Ihr Bild breitete sich dann auch weiter nach Nordtirol und über die Grenzen des historischen Tirols hinaus aus. Die Ursache war der zunehmende Tourismus und die Bewerbung von Tirol als Reiseziel im aufkommenden Alpinismus. Die Figur des Saltners wurde dafür werbewirksam in Szene gesetzt, vielfach abgedruckt und so gelangten bildliche Darstellungen über Zeitschriften wie „Die Gartenlaube“ oder Zeitungsbeiträge und Postkarten bis in die bürgerlichen Wohnungen der europäischen Metropolen. Anhand dieser Darstellungen lässt sich zeigen, wie sich das Bild des Saltners und mithin die Vorstellungen rund um diese Figur veränderten. Geschaffen wurde ein Narrativ, das prunkvolle Kleidung für den Saltner vorsah, der groß gebaut, mit Bart und Pfeife im Mundwinkel durch die Südtiroler Weinberge schreite.

Abbildung 4: Ausstellungsobjekt im Tiroler Volkskunstmuseum, eigene Aufnahme Lina Schäfer und Benjamin Stark 2024
In ebendieser stereotypen Darstellung wurde der Saltner mit seiner als typisch geltenden Tracht zu einem beliebten Motiv, fand Erwähnung in Literatur und sogar in Theaterstücken. Derart wurde der Saltner also zu einer Kunstfigur, die als Beispiel für eine Form von erfundener Tradition (nach Eric Hobsbawm und Terence Ranger: „Invention of Tradition“ 1983) gelten kann. Die dabei produzierten Bilder wirkten wiederum auf den Alltag der davon betroffenen Menschen – den tatsächlich als Weinhüter tätigen Männern – zurück. Ihre Kleidung passte sich immer mehr dem erschaffenen Narrativ und den Erwartungen des Tourismus an. Ihre Aufgaben wurden um den Umgang mit Reisenden und Gästen erweitert, den neugierigen und faszinierten Urlaubenden sollten Erlebnisse mit „echten angeblich traditionellen“ Saltnern geboten werden.
Die frühe Volkskunde und die Erfindung des Saltners
Der Weinberghüter – wie er in zahlreichen Museen – so auch im Tiroler Volkskunstmuseum gezeigt wird, ist also nicht die Darstellung eines historischen Berufes. Die Figuren und Gegenstände erzählen die Geschichte einer historischen Figuration. Also das Making-of des Saltners, zu dem auch das frühere Fach Volkskunde in einer Gemengelage von alpinistisch-touristischem Interesse, bürgerlicher Faszination und erfolgreicher Vermarktung beigetragen hat.
Das Erkenntnisinteresse der jungen Volkskunde lässt sich am sogenannten Fachkanon ablesen, gesammelt und erforscht wurden Mythen, Märchen und Sagen, Lieder und Bräuche, Kleidung, Bau- und Essgewohnheiten der bäuerlichen Bevölkerung, die als das Volk der Volkskunde galt. Es dominierte die Idee, dass in diesen kulturellen Versatzstücken etwas seit langem Überliefertes oder Ursprüngliches finden lasse, dass also damit der Brückenschlag in germanische Vorzeit gelinge. Dabei zeigen zahlreiche Studien wie sie beispielsweise von der sogenannten „Münchner Schule“ der „historisch-archivalischen Methode“ von Hans Moser (1903–1990) oder Karl-Sigismund Kramer (1916–1998) bereits seit den 1960er Jahren vorgelegt wurden, dass viele der als „uralt“ geltenden Traditionen erst im 19. Jhd. entstanden sind. Der Saltner ist ein gutes Beispiel dafür, denn es gab zwar schon seit dem 15. Jahrhundert den Beruf des Weinberghüters, doch führten die Reiseberichte, Pressemeldungen und Märchen zu einer Neuerfindung des Saltners. Sein Kostüm wurde prachtvoller, sein Auftreten extravaganter und er wurde immer mehr zu einer touristischen Attraktion. Verschleiert wird diese Veränderung durch ein begleitendes „schon immer“, das sich in Berichte und Erzählungen über den Weinberghüter einschleicht. Eine kulturwissenschaftliche Spurensuche hat heute die Aufgabe, solche vermeintlichen Kontinuitäten nicht nur aufzudecken und die Historizität und Kontingenz von Gegenständen, Bräuchen und Mythen zu rekonstruieren, sondern das Phänomen der „Erfindung von Tradition“ in seiner eigenen Zeitlichkeit einzuordnen und zu verstehen. So steht das Making-of des Saltners seinerseits für die Tourismusgeschichte Tirols und Südtirols, die schwindende Bedeutung der agrarischen Landnutzung und eben auch die Agency – den Handlungsspielraum – der verschiedentlich daran beteiligten historischen Akteur:innen.

Abbildung 5: Plakatentwurf, Sammlung Touriseum Meran
Warum eigentlich Fuchsschwänze?
Am überaus auffallenden Kopfschmuck des Saltners sind Federn und Tierschwänze angebracht, seine Jacke und Hose sind aus Leder hergestellt und die Kette vor der Brust ist aus zahlreichen Tierzähnen und Muscheln gefertigt, darunter die langen Eckzähne männlicher Wildscheine. Diese Eberzähne ragen sichelförmige bis unter die Brust herab. Der Großteil der Kleidung und auch der Verzierungen ist aus tierischen Materialien gefertigt. Vor dem Hintergrund der aufsehenerregenden Ausgestaltung der Kleidung und Ausstattung der Saltnerfigur lässt sich annehmen, dass viele der Accessoires dekorativen Zweck erfüllen. So scheinen die meisten Gegenstände keiner weiteren, praktischen Verwendung in der eigentlichen Tätigkeit des Weinberghütens zu dienen. Die Trillerpfeife benutzte man aber sicher zum Aufschrecken von Vögeln, die es auf die reifen Trauben abgesehen hatten, noch bevor Vogelschutznetze oder Schreckanlagen üblich wurden. All das deutet auf ein Weltbild hin, in dem es eine deutliche Hierarchisierung gibt. Die Interessen der Menschen stehen über jenen anderer Tiere und Tiere erfahren dies, indem sie genutzt, getötet und verwendet werden. Anthropozentrismus ist ein zeitgenössischer Begriff, um diese Hierarchie und die zentrale Stellung des Menschen darin zum Ausdruck zu bringen.[1] Menschen, Tiere, Pflanzen und andere Entitäten leben in einer anthropozentrischen Ordnung nicht in einem gleichwertigen, symmetrischen Verhältnis zusammen. Menschen nehmen darin eine Ausnahmestellung ein und dominante Rolle ein. Diese Hierarchie ist nicht natürlich, sondern eine historisch gewordene und kontingente Sozialordnung, aber sie ist wirksam, weil sie vielfältige Legitimierungen erfährt. Dennoch kann sie als kulturelles Phänomen benannt und dekonstruiert werden. Dabei hilft es, zwischen zwei Arten des Anthropozentrismus zu unterscheiden. Der „epistemische Anthropozentrismus“ bezieht sich darauf, dass nicht-menschliche Wesen von und für Menschen nur ausgehend von einem menschlichen Blickwinkel beschreibbar sind.[2] Hier gehen wir davon aus, dass Menschen einen gemeinsamen Horizont teilen können. Davon abzugrenzen ist der „normative Anthropozentrismus“. Dieser beschreibt die Idee, dass Menschen allen anderen nicht-menschlichen Wesen überlegen sind und diese Überlegenheit umfasst auch die Bewertung des Lebens und Leidens der davon Betroffenen. Legitimiert wird dadurch also auch die Verwendung verschiedene Tiere als Ressource für den menschlichen Gebrauch. Die Kleidung des Weinberghüters ist dafür ein gutes Beispiel. Sie zeigt die Selbstverständlichkeit der menschlichen Dominanz über nicht-menschliche Wesen. Während damals künstliche Materialien und Plastikstoffe noch nicht zur Verfügung standen, ersetzen diese heute zunehmend die tierlichen Materialien zur Produktion von Kleidung und Alltagsgegenständen. Allerdings gilt beispielsweise Leder nicht als Nebenprodukt der „Fleischproduktion“, sondern immer noch als „fester Bestandteil des Geschäftsmodells“.[3] Die Kritik daran verdeutlicht einen Wandel in der Wahrnehmung von Tieren und dem vorherrschenden Mensch-Tier-Verhältnis. Es Sie zeigt an, dass ethische Bedenken gegen die Tiernutzung und Tierschutzbemühungen im Laufe des 20. Jahrhundert gesellschaftliche Aufmerksamkeit erfuhren. So wird werden Formen der Ausgrenzung, die auf den normativen Anthropozentrismus zurückzuführen sind, aktuell auch heftig debattiert. In der öffentlichen Auseinandersetzung darum entstehen Theorien, die ein symmetrisches oder weniger hierarchisches Zusammenleben von Menschen und nicht-menschlichen Wesen propagieren.

Abbildung 6: Historische Darstellung "Saltner"
Traubendiebe und Bestrafungen
Die Dominanz gegenüber Tieren spiegelt sich nicht nur in der Tracht der Saltnerfigur. Saltner als Weinberghüter waren für ihre Tätigkeit auch legitimiert, von ihnen erwischte Traubendiebe zu bestrafen. Art und Ausmaß der Strafen hingen von der Art des Diebstahls ab und waren in den sogenannten Saltnerordnungen festgelegt, aber sie variierten von Gemeinde zu Gemeinde. Jedenfalls wurde unterschieden zwischen Traubendiebstahl, bei dem direkt vor Ort genascht wurde oder ob eine größere Menge davongetragen wurde, um sie etwa andernorts zu verarbeiten oder zu verkaufen. Kindern durfte übrigens die Kleidung gepfändet werden, während bei Erwachsenen meist ein Pfandgeld gefordert wurde. Auch die körperliche „Züchtigung“ war fallweise erlaubt, dies umfasste aber zu keinem Zeitpunkt das Töten von Menschen. Tierliche Dieb:innen wurden vertrieben, es war aber auch legitim sie zu töten, unabhängig davon ob es sich um wilde oder als Haus- oder Nutztier gehaltene Tiere handelte.[1] Das verdeutlicht noch einmal das in diesen Ordnungen maßgebende Dominanzverhältnis. Was sich in diesen Praktiken niederschlug, verweist auf den überindividuellen soziokulturellen Rahmen, in dem sich die damaligen Akteur:innen bewegten. In diesem scheint es gesellschaftlich erlaubt und wohl weitestgehend akzeptiert gewesen zu sein, Tiere für den Diebstahl von Trauben zu töten.
Literatur
Morandell, Stefan/ Strauß, Brigitte / Untersulzner, Alexa/ Weissteiner, Evi: Der Saltner. Flurwache zwischen Amtsperson und Kunstfigur. In: Südtiroler Landesmuseum für Volkskunde (Hg.), Südtiroler Weinmuseum (Hg.): Beiträge zur Volkskunde. Bd. 4. Dietenheim: Südtiroler Landesmuseum für Volkskunde; 2022, S. 11, 19-24.
Steiner, Gary: Anthropozentrismus. In: Ferrari, Arianna/ Petrus, Klaus (Hg.): Lexikon der Mensch-Tier-Beziehungen. Bd. 1, Bielefeld 2015, S. 28.

Ausstellungsobjekt Tiroler Volkskunstmuseum
(Kein) Platz für blöde Ziegen
Ziegen als Krippenfiguren
Wer sich auf die Suche nach „Ziegen im Museum“ macht, wird sehr schnell bemerken, wenige Objekte erzählen Ziegengeschichten derart plastisch wie die Figuren der Krippendarstellungen. Krippen verkörpern nicht nur die künstlerische Auseinandersetzung mit biblischen Geschichten. Sie verdeutlichen auch Aspekte des Mensch-Tier-Verhältnisses und den historischen Umgang mit Tieren und tierischen Erzeugnissen. In der Bibel und den darin enthaltenen Geschichten werden Tiere und deren Stellung zu den Menschen vielfach thematisiert. Viele Krippen sind insbesondere vom Weihnachtsevangelium inspiriert. Und die Tiroler Krippenbaukunst wurde vor allem durch die Beschreibungen aus dem Lukasevangelium beeinflusst. Kunstvolle Krippen mit Hirt:innen und ihren Herden sind wichtige Bestandteile dieser Inszenierungen. Ein Beispiel dafür ist die sogenannte Nagl-Krippe aus der Sammlung des Tiroler Volkskunstmuseums. Es ist ein Frühwerk des 1939 in Grinzens bei Innsbruck geborenen Holzschnitzers Walter Nagl. Die Krippe entstand 1958 in Innsbruck und zeigt einen ländlich-bäuerliche Szene, wie sie für sogenannte Tiroler Krippen typisch ist. Die Ausstattung der Krippe ist einfach und reduziert auf wenige Figuren, die eine etablierte Ordnung aufweisen. So kommt jeder Krippenfigur ein für sie bestimmter Platz zu. Auch die Ziege – oder wie sie im deutschen Alpenraum liebevoll genannt wird, „die Goas“ – hat einen angestammten Platz in der Figurenordnung der Tiroler Krippen. Auffällig ist dabei die männlich geprägte Darstellung: Hirten in zentralen Positionen tragen Schafe auf den Schultern, während weibliche Figuren und Ziegen oft nur am Rand erscheinen. Walter Nagl bricht mit dieser Konvention: In seiner Krippe hat die Ziege einen prominenten Platz – beinahe als Hauptdarstellerin – gleich neben dem Jesuskind. Die Ziege ist zentraler als gewöhnlich in die „Ordnung“ der Szene eingebunden. Das erzählt von der engen Verbindung zwischen Menschen, Tieren und Kultur, aber auch von Ausschlüssen und Stigmatisierungen.

Abbildung 1: Waldweide mit Ziegen
„Ziegen sind die Kühe des armen Mannes“
Die Hirt:innen der Krippendarstellungen verkörpern die armen Menschen der damaligen Zeit. Schafe und Ziegen verdeutlichen deren gesellschaftliche Stellung um Christi Geburt vor etwa 2000 Jahren. Ziegen (Capra) begleiten Menschen aber schon seit etwa 10.000 Jahren, sie haben einen festen Platz in der Geschichte der
Sesshaftwerdung und Domestikation. Als anpassungs- und widerstandsfähige Tiere haben Ziegen in unterschiedlichsten Gemeinschaften und Regionen überlebt. Sie wurden und werden noch immer gegessen, ihre Haut und ihre Haare werden zu Kleidung verarbeitet, Knochen, Fette und andere Bestandteile werden als vielfältige Grundstoffe genutzt. Im alpinen Raum wurden Ziegen noch bis ins 20. Jahrhundert als Lebensgrundlage für ärmere Schichten betrachtet. So besagt ein bekanntes Sprichwort: „Ziegen sind die Kühe des armen Mannes“, also jener Familien, die sich keine Kühe leisten konnten. Die Ziegenhaltung war nicht nur erschwinglich, sondern auch weniger aufwendig, wenn die Ziegen beispielsweise mancherorts auf die Waldweide getrieben wurden.
Deshalb übernahmen Ziegen bis in die 1950er-Jahre eine wichtige Rolle in der vorwiegend auf Selbstversorgung ausgerichteten alpinen Landwirtschaft Tirols. Vor allem in Regionen mit karger Vegetation, in den Hochgebirgstälern und inneralpinen Trockengebieten, wo größere Tiere kein Auslangen finden, konnten Ziegen aufgrund ihres geringeren Gewichts und Grundumsatzes gehalten werden. Und ihre Produkte wurden vielfältig eingesetzt: Fleisch wurde in den Alpenregionen als „Kitzbraten“ geschätzt und konnte deshalb einträglich verkauft werden, die leicht verdauliche Milch konnte für die Ernährung von Kindern und Kranken dienen. Haut und Haar wurden zu Handschuhleder und Kleidung verarbeitet. Ziegenfelle wurden im alpinen Raum bereits in der Steinzeit genutzt, so fand man auch bei der sogenannten „Gletschermumie Ötzi“ eine Jacke aus Ziegenfell.

Abbildung 2: Reste des Fellmantels von Ötzi (Archeologiemuseum Bozen)
Während die Ziegenhaltung früher für ärmere Familien lebensnotwendig war, hat sich ihre Bedeutung heute stark gewandelt. Oft wird die Ziegenhaltung als Hobby betrieben, in alpinen Regionen dient sie der Landschaftspflege. Ziegen sind Kletterkünstlerinnen und erreichen Weideflächen, die für andere Nutztiere unzugänglich sind. Sie tragen wesentlich zur Erhaltung von Almen und Kulturlandschaften bei, indem sie Sträucher und Gräser abweiden und so die Verbuschung verhindern. Diese Eigenschaft macht sie auch heute noch zu einem wertvollen Teil ökologischer Pflegeprogramme. Aber auch in der modernen Ernährung erfreuen sich Ziegenprodukte wie Milch und Käse wieder größerer Beliebtheit. Zudem sind Ziegen ein fester Bestandteil von Streichelzoos und Bauernhofurlauben geworden – wohl, weil den Tieren allerlei Charaktereigenschaften zugeschrieben werden, die sie dafür auszeichnen sollen.
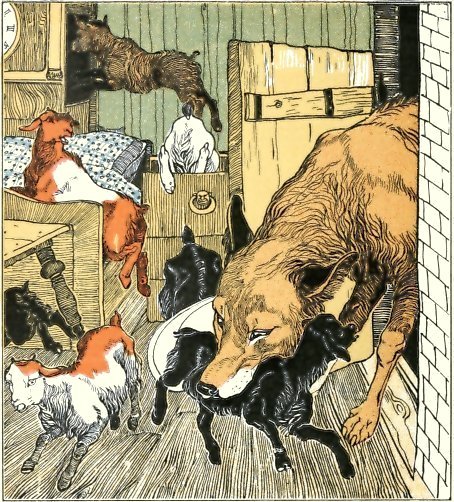
Abbildung 3: Gezeichnete Darstellung des Märchens "Der Wolf und die sieben Geißlein"
Ziegenmärchen – Mythen und Geschichten
Die berühmtesten Ziegen aller Zeiten sind wohl die sieben Geißlein, die, einmal abgesehen von dem kurzen Aufenthalt im Bauch des Wolfes, jene Gewitztheit bewiesen, die man dem Wesen der Ziege ganz allgemein nachsagt.
Tischlein deck dich - ein Märchen der Gebrüder Grimm handelt von einer gewitzten und frechen Ziege die sprechen kann.
»Ich bin so satt, ich mag kein Blatt meh! meh!«
»Wovon sollt ich satt seyn?
ich sprang nur über Gräbelein, und fand kein einzig Blättelein: meh! meh!«
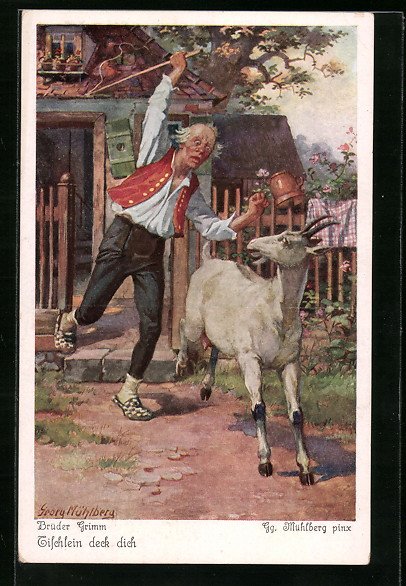
Abbildung 4: Darstellung zu "Tischlein deck dich"
Wenn wir Tieren menschliche Eigenschaften zuschreiben, nennt man das Anthropomorphismus. Das bedeutet, dass wir ihr Verhalten mit unseren Maßstäben erklären. So können wir uns Tiere besser vorstellen, und genau das hat viele Künstler:innen, Dichter:innen und Märchenerzähler:innen inspiriert. Aber Achtung: So spannend diese Geschichten sind, sie haben oft wenig mit wissenschaftlicher Realität zu tun!
Das zeigt das Sinnbild der Ziege bereits seit der Antike. Häufig wurden Ziegen als Opfertiere getötet. Fast immer wird bei Erwähnung der Tiere auch die Milch angesprochen, die unter anderem als Sonnenopfer gebräuchlich war. Ziegenmilch diente auch den Göttern als Speise. So wurde nach der griechischen Mythologie der junge Himmelskönig Zeus, als er von seiner Mutter vor dem Herrscher der Titanen versteckt wurde, von der Ziege Amalthea gesäugt. Als Dank erhob Zeus die Ziege nach ihrem Tod in den Himmel, wo sie als der Stern Capella – einer der hellsten Sterne am Nachthimmel – verewigt wurde. Beim bereits in der Tora beschriebenen Versöhnungsfest soll jährlich ein Ziegenbock, beladen mit den Sünden des Volkes, als sprichwörtlicher Sündenbock in die Wüste geschickt worden sein. Und im aufkommenden Christentum wandelten sich die mythologischen Vorstellungen bis sich spätestens im Mittelalter Teufelsdarstellungen in Ziegen(bock)gestalt etablieren.
Interessanterweise hatte Ziegen und Ziegenprodukte auch in der vormodernen Medizin einen festen Platz. So galten sogenannte Bezoare – kleine kugelförmige Gebilde aus Haaren und Steinchen aus dem Magen der Wildziege – als Wundermittel gegen Vergiftungen und Krankheiten. Auch Ringe aus Ziegenhörnern oder das Blut der Tiere wurden als Heilmittel genutzt.

Abbildung 5: Ausstellungsobjekte "Bezoare"
Ziegenvorurteile
Im deutschen Wortschatz ist die Ziege insbesondere bei Benennungen von Frauenbildern häufig negativ konnotiert, so heißt es beispielsweise: „so a blede goas“ („so eine blöde Ziege“). Diese abwertende Metapher richtet sich gegen Frauen und Ziegen gleichermaßen. Es wird dabei ein Bild hervorgerufen, dass Frauen bestimmte negative Eigenschaften wie Störrigkeit, Eigensinn oder übertriebene Launenhaftigkeit zuschreibt, aber nur, weil diese Abwertungen auch schon den Ziegen zugeschrieben werden. Die Laute der Ziege – das „Meckern“ – sind dabei symbolisch mit Kritik, Klagen und einem unzufriedenen Verhalten verknüpft. Worte wie „Meckerziege“, „Zickenkrieg“ oder „Zickenalarm“ haben sich besonders seit den 1990er-Jahren verbreitet und dienen häufig zur abwertenden Beschreibung von Konflikten zwischen Frauen. Die Dudenaufnahme des Begriffs „Zickenkrieg“ im Jahr 2006 verdeutlicht die alltägliche Sprachverwendung. Hierbei geht es oft weniger um das tatsächliche Verhalten der betroffenen Personen, sondern vielmehr um die gesellschaftliche Wahrnehmung und die Konstruktion von Konflikten unter Frauen. Und die sprachliche Verwendung solcher Begriffe spiegelt auch die gesellschaftliche Erwartungshaltung an Frauen wider: Sie sollen sich fürsorglich und kooperativ verhalten, während Wettbewerb und Durchsetzungsvermögen oft als männliche Eigenschaften gelten. Hier zeigt sich eine ungleiche Wahrnehmung: Männliche Konfliktfähigkeit wurde über Jahrhunderte gesellschaftlich anerkannt, während Frauen häufig an das Ideal der Harmonie gebunden wurden (Hofbauer 2006, S. 26-42).
Derartige Vorstellungen sind kulturelle Konstruktionen, die einem dichotomen – also zweigeteilten – Ordnungssystem entsprechen, das in den Kulturwissenschaften als Grundordnung der europäischen Moderne ausgemacht wird. Dieser zweiteilenden Systematik entsprechen Gegensatzpaare wie Mann/Frau, Natur/Kultur oder Mensch/Tier. Die Unterscheidung zwischen Menschen und allen anderen Tieren wird auch als „anthropologische Differenz“ bezeichnet. In historischen und patriarchalen Diskursen wurden Frauen oft mit der "Natur" assoziiert und auf körperliche Funktionen wie Mutterschaft reduziert. Dies hat dazu geführt, dass Frauen eine Nähe zum Tierlichen attestiert wurde, während Männer mit Vernunft, Geist und Kultur, manchmal dem Menschen schlechthin, gleichgesetzt wurden. Die Ziege als sprachliche Metapher und abwertende Figur zur Beschreibung von Frauen und ihnen zugeschriebenem Verhalten erinnert uns an die Macht der Sprache, soziale Rollen zu definieren. So lädt die Ziegenmetapher auch dazu ein, die darin enthaltenden Vorurteile in Bezug auf Menschen und Tiere kritisch zu hinterfragen.
Moderne Ziegenhirtinnen
In Ziegenherden bestimmen weibliche Leittiere die Hierarchie, sie lenken die Gruppe und sorgen für Ordnung. Die Gruppen umfassen im natürlichen Herdenverband zwischen 20 und 50 Tiere. Sie werden bis zu 12 Jahre alt und können sich Gesichter und Orte merken. Außerdem sprechen Ziegenherden je eigene Dialekte. Die Ziegenhaltung erfordert viel Organisationstalent, emotionale Stärke und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Frauen in diesem Berufsfeld brechen mit veralteten Rollenbildern und oftmals verkörpern sie damit Widerstandsfähigkeit, Unabhängigkeit und Innovationskraft. Früher wie heute gibt es viele inspirierende Beispiele von Frauen, die sich der Ziegenhaltung widmen: In Afrika helfen Hilfsprojekte wie „Ziege wie Zukunft“ alleinerziehenden Frauen, mit Ziegen eine Existenzgrundlage aufzubauen. Die Tiere liefern Milch und sichern ein Einkommen, während Frauen durch Schulungen zur Tierhaltung befähigt werden. Auch in Europa setzen Frauen Akzente: Ob in der Landschaftspflege, der Käseherstellung oder der Erhaltung seltener Ziegenrassen – Ziegenhirtinnen tragen aktiv zum Umweltschutz und zur Bewahrung von Kulturlandschaften bei. Ein Beispiel war Agitu Ideo Gudeta (1978–2020), eine äthiopische Unternehmerin, die in Italien „The Happy Goat“ gründete. Ihr Projekt beförderte die nachhaltige Ziegenzucht und Käseproduktion, konzentrierte sich auf lokale Ziegenrassen und verband Umweltschutz mit Integration. Ihr gewaltsamer Tod im Dezember 2020 erschütterte die Öffentlichkeit. Moderne Ziegenhirtinnen sind Sinnbilder für Wandel und Eigenständigkeit und ihre gesellschaftlichen Rollen werden konfliktreich ausgehandelt. Dabei stehen sie für gerechtere gesellschaftliche Verhältnisse. Und auch in die Tiroler Krippenwelt hielt diese Entwicklung bereits Einzug. So zeigt die neugestaltete Krippe des Krippenvereins von Thaur bei Innsbruck die Darstellung einer Hirtin mit Ziege, die entschlossen im Vordergrund steht, mit hochgeschürztem Rock und einer selbstbewussten Haltung.

Abbildung 6: Eigene Aufnahme Karin Lamprecht Krippe in Thaur mit Ziegenhirtin
Literaturverzeichnis
Albert, Ulrike (2020): Bock auf Ziegen. … von der Geschichte eines der ältesten Haustiere. 1. Auflage. Hersbruck: Deutsches Hirtenmuseum (Schriftenreihe Sonderausstellungen Deutsches Hirtenmuseums Hersbruck, Bd. 16).
ARCHIV - Wissenswertes (2022): Zum Thema Tiere als Bedeutungsträger in der Kulturlandschaft. S. 13.
Hofbauer, Johanna (2006): Konkurrentinnen außer Konkurrenz? Zugangsbarrieren für Frauen im Management aus der Perspektive des Bourdieu'schen Distinktions- und Habituskonzepts. In: Österreichische Zeitschrift für Soziologie, S. 31.
Sellner, Manfred (1989): Schimpfwörter aus allgemeiner und Tierschimpfwörter aus emanzipatorisch-soziolinguistischer Sicht. In: Bernard Jeff (Hg.): Semiotik der Geschlechter: Akten des 6. Symposiums der Österreichischen Gesellschaft für Semiotik, Salzburg 1987 - in Zsarb. mit d. Salzburger Gesellschaft für Semiologie (SIGMA): Stuttgart: Heinz: Wien: Österr. Ges. f. Semiotik (11), S. 249–259.
Wild, Markus (2006): Die anthropologische Differenz. Quellen und Studien zur Philosophie, Band 74. Berlin; New York: Walter de Gruyter, S. 3-4.
Zöllner, Frank (2004): Anthropomorphismus: Das Maß des Menschen in der Architektur von Vitruv bis Le Corbusier. In: Neumaier, Otto (Hrsg.): Ist der Mensch das Maß aller Dinge? Beiträge zur Aktualität des Protagoras (Arianna. Wunschbilder der Antike, Bd. 4). Möhnesee: Bibliopolis, S. 307-344.
Meuser, Michael (2008): It’s a Men’s World. Ernste Spiele männlicher Vergemeinschaftung, S. 33–44. Online verfügbar unter https://bibsearch.uibk.ac.at/AC06911141
Onlinequellen
Duden (o. J.): Zicken / Zickenkrieg: Rechtschreibung, Bedeutung, Definition, Herkunft. Verfügbar unter: https://www.duden.de/rechtschreibung/zicken [Zugriff am 23.02.2025].
ARGE ALP (o. J.): Tradition - Vielfalt - Wandel II. Verfügbar unter: https://www.argealp.org/de/projekte/d/tradition-vielfalt-wandel-ii [Zugriff am 23.02.2025].
Curiosa di Natura (2021): Agitu Ideo Gudeta - Capra Felice. Verfügbar unter: https://www.curiosadinatura.com/2021/01/26/agitu-ideo-gudeta-capra-felice/ [Zugriff am 23.02.2025].
Tirol.gv.at (o. J.): Archiv Fachliteratur AUFBEHALTEN. Verfügbar unter: https://www.tirol.gv.at/fileadmin/themen/kunst-kultur/museum/Museumsportal_Serviceteil/Serviceteil_DOKUMENTE/Archiv_Fachliteratur_AUFBEHALTEN/Archiv_WW_2022.pdf [Zugriff am 23.02.2025].
Interviews und Feldnotizen
Feldnotizen vom 19.01.2025: Gespräch mit einem Mitglied des Krippenvereins Thaur.
Interview am 06.11.2024: Zeitzeugin Marianna Knoll.

Ausstellungsobjekt Tiroler Volkskunstmuseum
Fraisen, Schlangen und Ameisen
In einer Vitrine des Tiroler Volkskunstmuseums sind es kleine, auf einer Schnur aufgefädelte Knochen, die uns vor ein Rätsel stellen. Was ist das wohl und wozu wurde es gebraucht? Das außergewöhnliche Objekt ist im Ausstellungsbereich „Das prekäre Leben“ zu finden. Es
liegt auf dunkelblauem Untergrund, hebt sich durch die helle Farbe davon ab. Zierlich und schlicht, leicht zu übersehen. Erst auf den zweiten Blick lässt sich erkennen, dass nicht Perlen oder Edelsteine auf einer Schnur aufgefädelt sind. Und die Beschriftung des Schaukastens verrät: „Fraisenkette aus Natternwirbel“. Die Kette besteht aus vielen kleinen Wirbelknochen einer Ringelnatter. Ursprünglich hatte die Schnur eine rote Farbe, die über die vielen Jahre verblichen ist. Die Fachleute des Museums nehmen an, dass diese Kette mit einer Länge von 58 cm im 19. Jahrhundert hergestellt wurde. Wozu aber brauchten die damaligen Menschen eine aus den Knochen einer Schlange hergestellte Kette?
Schlangensymbolik und medizinische Vorstellungen
Schlangen standen im alltäglichen und laienhaften Umgang mit Krankheiten im 19. Jahrhundert und schon lange Zeit davor hoch im Kurs. Schon in der griechischen Antike wurde
Äskulap (Asklepios) als Gott der Heilkunst mit Stab und darum sich windender Schlange dargestellt. Darauf zurückgehend trägt auch eine in Europa weit verbreitete Schlangenart den Namen Äskulapnatter. Und der sogenannte Äskolapstab mit der charakteristischen Schlangendarstellung gilt noch heute als Symbol der Medizin, des Apotheken- und Heilwesens.

Abbildung 1: Sogenanntes Nasenschild, online: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:APOTHEKE,_Nasenschild_in_Konstanz_(2015).jpg
Das zeigt, dass Schlangen, Schlangenbestandteile und Schlangenbilder in der Vergangenheit und auch noch in der Gegenwart symbolisch aufgeladen wurden. Menschen verbinden also unterschiedliche Vorstellungen über Schlangen zu einem kulturellen Bild „der Schlange“ und einzelne Schlangenarten oder gar Tierindividuen werden durch die kulturellen Vorstellungen zu Symbolträger:innen. So steht „die Schlange“ vor allem in christlich geprägten Vorstellungen für das Böse, Doppelzüngige, Hinterlistige, Verführerische, aber auch für Erneuerung des Lebens, Unsterblichkeit, Wandlung, Weisheit und Heilung. Die Wahrnehmung oder der Umgang mit den davon betroffenen realen Tieren wird von diesen Vorstellungen geprägt.
Reale Schlangen waren wohl auch deshalb begehrte medizinische Handelsartikel und wurden für den Einsatz als Heilmittel getrocknet, verbrannt und pulverisiert. Einzelne Teile wie Augen, Blut, Fett oder die Galle sollten Krankheiten lindern. Bei schweren Geburten wurde Schlangenhaut auf den Bauch der Gebärenden gelegt und zur Abwehr der „Fraisen“ wurde Natternwirbeln große Wirkmacht zugesprochen.
Die „Fraisen“ als Schreckgespenst
Dann und wann taucht heute noch im Tirolerischen die Redewendung „Da krieg i die Fraisn“ auf. Das bedeutet, dass sich jemand über etwas aufregt und vor Wut zu zittern beginnt. Das althochdeutsche Wort „freisa“ heißt übersetzt „Angst, Gefahr, Schrecken“. Und die „Fraisen“ waren im 19. Jahrhundert – aus dem die Fraisenkette stammt – eine wortwörtlich gefürchtete Krankheit. Denn man verwendete den Begriff „Fraisen“ für Säuglings- und Kinderkrankheiten, bei denen hohes Fieber auftrat. Das Fieber löste Krämpfe aus, die Kinder begannen zu zittern und waren oftmals schwer krank. Die Fraisen waren also eine gefürchtete Kinderkrankheit. In den ländlichen und oft abgelegenen Orten des historischen Tirols gab es aber nur unzureichende medizinische Versorgung, oftmals mussten sich die Menschen selbst behelfen. So erhoffte man sich Schutz vor Kinderkrankheiten wie den Fraisen von Amuletten oder Ketten, auch einer Fraisenkette aus Natternwirbeln. Die rote Farbe der Schnur – so glaubte man – verstärke die Abwehrwirkung. Denn Rot stand für Leben, es sollte also helfen, den Tod zu verbannen. Fraisenketten wurden Säuglingen und Kleinkindern um den Hals gehängt, unter das Kissen gelegt, an der Wiege oder dem Bettchen angebracht. Noch bis ins 20. Jahrhundert waren Fraisenketten in allen gesellschaftlichen Schichten in Tirol gebräuchlich. Denn alle fürchteten die „Fraisen“ und versuchten ihre Kinder davor zu schützen.

Abbildung 2: Fraisenkette, online unter: https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Necklet_of_the_vertebrae_of_an_adder_hung_with_3_medallions._Wellcome_M0016842.jpgikipedia
Weit verbreitet, aber unkontrollierbar
Die Fraisen traten als plötzliche Krankheit und scheinbar ohne Ursache auf. Es kam zu Verkrampfungen und heftigen Zuckungen am gesamten Körper der oftmals erst wenige Wochen alten Kinder. Das damit verbundene, meist hohe, Fieber, führte mitunter zur Bewusstlosigkeit oder gar zum Tod. Hunger und Fehlernährung, unzureichende hygienische Zustände und Krankheiten wie Scharlach, Diphtherie und Tuberkulose führten in dieser Zeit allgemein zu hoher Kindersterblichkeit. Da aber insbesondere die Ursache der sogenannten „Fraisen“ unbekannt war, verbanden sich besondere Ängste damit. Es schien, als ob die „Fraisen“ die Kinder gleichsam aus dem Nichts „anfällt“ oder die Krankheit wie „angezaubert“ über sie kam. Auch nahm man vielfach an, die Krankheit sei darauf zurückzuführen, dass Frauen in der Schwangerschaft oder während des Stillens Angst, Furcht oder Schrecken erlebt hätten. Oft wurden die „Fraisen“ aber auch mit dem Zahnen der Kinder zwischen dem vierten und achten Lebensmonat in Verbindung gebracht. Dann fiel das hohe Fieber der „Fraisen“ oft mit Magen-Darm-Erkrankungen oder anderen Kinderkrankheiten wie durch Vitamin-D- und Kalziummangel hervorgerufene Rachitis zusammen.
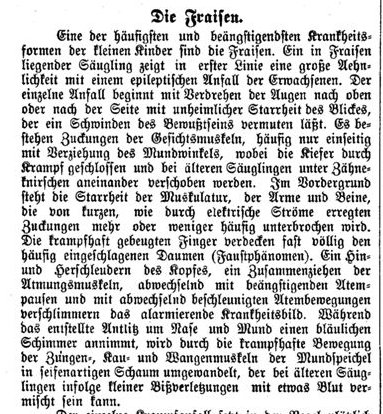
Abbildung 3: Ausschnitt aus Hebammen-Zeitung, 1.7.1910, online unter: https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=hez&datum=19100701&zoom=33
Ein Artikel aus der Hebammen-Zeitung vom 1. Juli 1910 beschreibt die Fraisen eindrücklich:
„Eine der häufigsten und beängstigendsten Krankheitsformen der kleinen Kinder sind die Fraisen. Ein in Fraisen liegender Säugling zeigt in erster Linie eine große Ähnlichkeit mit einem epileptischen Anfall der Erwachsenen. Der einzelne Anfall beginnt mit Verdrehen der Augen nach oben oder nach der Seite mit unheimlicher Starrheit des Blickes, der ein Schwinden des Bewusstseins vermuten läßt. Es bestehen Zuckungen der Gesichtsmuskeln, häufig nur einseitig mit Verziehung des Mundwinkels, wobei die Kiefer durch Krampf geschlossen und bei älteren Säuglingen unter Zähneknirschen aneinander verschoben werden. (…) Der Krampfanfall setzt in der Regel plötzlich ein und dauert gewöhnlich nur einige Minuten, um dann durch Lösen der starren Glieder an Intensität nachzulassen. Das Kind liegt noch wie betäubt, nur einzelne Zuckungen erinnern gleichsam an die fernen Blitze und den leisen Donner eines abziehenden Gewitters.“
In der „Hebammen-Zeitung“ spielt die Fraisenkette zur Abwehr- oder Milderung der Fiebererkrankung keine Rolle. In aufklärerischer Absicht wird auf die Rolle der modernen Medizin verwiesen, indem dazu aufgefordert wird, dass ein Arzt die Ursache der „Fraisen“ feststellen müsse, um das Kind dann auch richtig zu behandeln.
In der sogenannten Volksmedizin wurde hingegen alles, was sich in krampfartigen Erscheinungen zeigte, unter dem Sammelbegriff „Fraisen“ zusammengefasst. So waren die Mittel, sich dieser Krankheit zu erwehren neben den Fraisenketten, auch Fraisenhauben, Fraisenhemdchen, Fraisenschnuller, Fraisenrosenkränze oder Fraisenschlüssel. Sie alle sollten zur Abwehr der Krankheit dienen. Und beim Versuch, die „Fraisen“ zu heilen, galt kaltes Wasser, das ins Gesicht des Kindes gespritzt wurde, als überlieferte Heilmethode. Ein kalter Wasserstrahl über den Rücken oder ein Senfbad versprachen ebenfalls Heilung. Befremdend mutet heute die Methode an, Schrecken mit Schrecken zu bekämpfen, indem das Kind eine Ohrfeige bekam.
Heute steht die historische Bezeichnung „Fraisen“ für Fieberkrampf, Krampfanfall oder Epilepsie. Fiebersenkende und krampflösende Medikamente haben der Krankheit den Schrecken genommen und die Kindersterblichkeit gesenkt. Es wird davon ausgegangen, dass die Fieberkrämpfe jeweils unterschiedliche Ursachen hatten. Damals aber gab es die Überzeugung, es handle sich um die Fraisen, die durch die heilbringenden Kräfte der Ringelnatter abgewehrt werden könnten.
Die Ringelnatter als Glücksbringerin
Ein Blick in die Schlangenmythologie zeigt Schlangen als gewollte Mitbewohnerin, Wächterin oder gar „Untermieterin“. Sie wohnen unter der Türschwelle, dem Ofen, der Treppe, in den Wänden oder im Fundament des Hauses. Sie beschützen das Haus, vertreiben böse Einflüsse und Krankheiten. Der Schlange wird ein Platz im Leben des Menschen gegeben. In zahlreichen Sagen und Märchen wird von Schlangen erzählt und die Ringelnatter gilt darin als Glücksbringerin und Beschützerin von Kindern, Haus und Hof. Sie überbringt Reichtum und Segen wie im Märchen „Das Natternkrönlein“ von Ludwig Bechstein aus dem Jahr 1856. Dort trägt die weiße, manchmal singende „Krönleinnatter“ eine goldene Krone auf dem Kopf. Sie wohnt im Stall und wird von der Magd mit Milch versorgt. Nachdem die Magd vom Hof vertrieben wird, verschwindet auch die Natter. Damit verlässt den Bauern das Glück und er verliert seinen Reichtum. Märchen wollen Botschaften vermitteln, die oft erzieherischen oder moralisierenden Charakter haben. Das „Natternkrönlein“ will sagen: Behandle die Natter gut, denn sie bringt dir Glück. Dabei wird auf die enge Verbindung des Menschen mit anderen Lebewesen verwiesen. Der gute Umgang mit ihnen ermöglicht ein gutes und angstfreies Zusammenleben.
Aber das den Schlangen typische Dahinschlängeln und Züngeln löst bei manchen Menschen auch das Gefühl der Bedrohung, des Ekels oder der Angst aus. Im Extremfall spricht man von einer Schlangenphobie (Ophidiophobie).

Abbildung 4: Zeichnung von Maria Rehm zum "Natternkrönlein", online unter: https://www.sagen.at/texte/maerchen/maerchen_oesterreich/tirol/unterinntal/kroenlnatter.html
Teamarbeit für eine Fraisenkette
Schlangenwirbel und Tierknochen gehören wie Horn, Holz und Stein zu den ältesten Materialien, die Menschen für die Herstellung von Gebrauchsgegenständen nutzten. Aus Knochen und Horn erzeugte man z. B. Werkzeuge, Messergriffe, Nähnadeln, Angelhaken, Flöten oder Schmuck. Bevor Kunststoffe wie Plastik verfügbar waren, wurden die Dinge des täglichen Gebrauchs mit Einfallsreichtum und Geschick aus diesen organischen Materialien gefertigt. So lagen auch die Natternwirbel für die Fraisenkette nicht einfach am Wegesrand, um eingesammelt und zu einer Kette aufgefädelt zu werden. Dafür musste eine Ringelnatter gefangen, getötet, in einem Topf gekocht und dann in einen Ameisenhaufen gelegt werden. Die Ameisen nagten das Fleisch ab, übrig blieb das Skelett der Ringelnatter.
Am Zustandekommen der ungewöhnlich wirkenden Fraisenkette waren also mehrere tierliche und menschliche Akteur:innen beteiligt. Absichtsvoll handelnde Menschen, die an die Heilkräfte der Schlangenknochen glaubten oder diesen Glauben bedienten, wirkten zusammen mit den davon betroffenen Ringelnattern, die dafür eingefangen, getötet und weiterverwendet wurden. Und beteiligt waren auch Ameisen, denen ihrerseits heilende Kräfte zugesprochen wurden. So war auch der Einsatz oder die Verwendung von Ameisen damals weit verbreitet und ab dem 17. Jahrhundert ist der Berufsstand des „Ameislers“ nachgewiesen, der die dafür benötigten Tiere im Wald aufsammelte und handelte. Sogenannte Ameisler oder Ameisträger verkauften die Puppen der Ameisen für medizinische Zwecke oder als Vogelfutter.

Abbildung 5: "Amastrager Zeichen 1820", online unter: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Ameisler?uselang=de#/media/File:Amastrager.png
Sehr bekannt war aber auch der mit Spiritus oder Schnaps und Ameisen angesetzte „Ameisengeist“, der gegen Gicht, Rheuma und Kreuzschmerzen helfen sollte. Riesenhafte Kräfte versprach hingegen eine Flasche Wein in einem Ameisenhaufen.
Literatur
Bächtold-Stäubli, Hans/Hoffmann-Krayer, Eduard (Hg.): Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens. Berlin/Leipzig 1927-1942.
Friedl, Inge: Die Fraisen und der Vierziger. In: Heilwissen in alter Zeit. Bäuerliche Traditionen, Wien/Köln/Weimar 2009.
Groiß, Franz: Ameise und Volkskultur. In: Weidinger, Alfred/Mandl-Kiblböck, Manfred (Hg): Geschätzt, verflucht, allgegenwärtig. Ameisen in Biologie und Volkskultur. Linz 2009. 165-188.
Hebammen-Zeitung. Organ des Unterstützungsvereins für Hebammen und der „Reichsorganisation der Hebammen Österreichs“, Jg. XXIV, Nr. 13, Wien 1910, 286. Online unter: https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=hez&datum=19100701&zoom=33 (Stand: 5.2.2025)
Horvoka, Oskar v.: Fraisen und andere Krankheiten im Lichte der vergleichenden Volksmedizin. In: Zeitschrift für österreichische Volkskunde, Jg. XIII, Wien 1907, 118.
Jühling, Johannes: Die Tiere in der deutschen Volksmedizin in alter und neuer Zeit. Dresden 1900.
Meissner, Friedrich Ludwig: Forschungen des 19. Jahrhunderts im Gebiete der Geburtshülfe, Frauenzimmer- und Kinderkrankheiten. Leipzig 1833, 270.
Meyers Großes Konversations-Lexikon: „Frais“. Bd.6, Leipzig 1906, 815.
Perl, Maria: „… und bald war das kindliche Leben erloschen“. Eine Fallstudie über die Säuglings- und Kindersterblichkeit ausgewählter Lechtaler Gemeinden im Zeitraum von 1871 bis 1910, Innsbruck 2020.
Schmeller, Johann Andreas: Bayrisches Wörterbuch. München 1872–1877. Online unter: https://publikationen.badw.de/de/bwb/index (Stand: 5.2.2025)
Tiroler Volkskunstmuseum: M-Box Karte: „Fraisenkette aus Natternwirbel“, Inventarnummer F2822, erfasst am 30.10.2015.

Ausstellungsobjekt Weiherburg (Eigene Aufnahme Anita Singer, 23.10.2024)
Columba livia subspecies domestica
Tauben sind quer durch die Kulturen uralte Symbole des Friedens, des Glücks, der Liebe und stehen sinnbildlich für den Heiligen Geist im Christentum. Ihr Fleisch war einst beliebte Nahrungsquelle. In beiden Weltkriegen gelangten sie als Nachrichtenvermittler:innen zu Ruhm und Ehren. Gleichzeitig werden sie als Dreckschleuder, Krankheitsüberträger:innen und gar als „Ratten der Lüfte“ verunglimpft: kaum eine andere Vogelart polarisiert so stark. Über Jahrtausende wurden Tauben von Menschen hochgeschätzt. Wie kam es also zum aktuellen erheblichen Imageproblem?
Viele der heute in Städten lebenden Tauben sind entflogene und frei gelassene Nachkommen domestizierter Felsentauben namens Columba livia. Ursprünglich waren sie wahrscheinlich Wald- und Felsenbewohner:innen. Seit der menschlichen Sesshaftwerdung vor rund 12.000 Jahren sind sie den Menschen nahe. Neueste Forschungen lassen bereits enge Beziehungen mit Neandertalern vermuten, deren Höhlen sie gemeinsam bewohnt haben sollen. Weltweit gibt es mehr als 300 Taubenarten, die auch in Distanz zu Städten leben. Menschen meinen, wenn sie von Tauben sprechen, in der Regel jene, die in Städten leben. Mit ihrer Domestikation gehen auch zahlreiche negative Aspekte einher, wie Ausbeutung und großes Tierleid beispielsweise im Brieftaubensport.
Die hier abgebildete Zuchttaube Columba livia subspecies domestica ist Teil der Ausstellung „Faszinierende Vogelwelt“ im Museum Weiherburg/Alpenzoo. Ein Gespräch mit der Kuratorin Petra Schattanek-Wiesmair verrät, dass die Taube von Reinhard Lentner, einem Ornithologen, in Terfens (Bezirk Schwaz/Tirol) tot aufgefunden wurde. Im Sammlungs- und Forschungszentrum der Tiroler Landesmuseen wurde sie dann präpariert. Die Taube trug einen roten Metallring, der mit der Inschrift RO versehen war. Das deutet auf Rumänien als Herkunftsland hin. Details über den Ursprungsort und die Umstände ihrer Reise nach Tirol konnten trotz intensiver Bemühungen bisher nicht eruiert werden. In der Ausstellung kann sie noch bis 2026 besucht werden, wo es neben weiteren Themen um die Beziehung zwischen Vögeln und Menschen in Vergangenheit und Gegenwart geht.

Abbildung 1: Taubenschlag. Foto: Elfriede Karner, 11.01.2025.
Tauben als urbane Plagegeister
Jahrtausendelang lebten Menschen und Tauben miteinander in Städten und Siedlungen. Aber heutzutage stören Tauben genauso wie Bettler:innen oder Obdachlose den urbanen Raum. In den Konsumzonen soll Ordnung herrschen. Moderne Hochhäuser mit Glasfronten verhindern zwar das Brüten, aber gerade Einkaufsstraßen und Fußgängerzonen brachten ein vermehrtes Nahrungsangebot mit sich. Taubenpopulationen nahmen deutlich zu.
Menschen der westlichen Moderne denken oft in Dichotomien. Männlich/weiblich: Der Täuberich bleibt unsichtbar, Taube wird als weiblich gedacht. Rein/schmutzig: Tauben galten jahrtausendelang als rein, erst seit den 1960er Jahren werden sie als schmutzig bezeichnet. Natur/Kultur: Auch dieser von Menschen gemachte Unterschied spielt für Tauben keine Rolle. Ihr Lebensraum ist die Stadt, sie können nicht in einen „natürlichen“ Lebensraum abgeschoben werden. Dies erleben viele Menschen als Kontrollverlust. Sie haben die vermeintliche Natur nicht im Griff.
Taubenfüttern gehörte lange zum Alltag in den Städten, zum Beispiel am Markusplatz in Venedig. Nun verstößt, wer sie füttert, gegen gesellschaftliche Normen. Tauben werden dadurch immer kränker, ihr Kot säurehaltiger, weil sie Futter im Müll suchen müssen.
Worte wie „Dreckschleuder“, „Krankheitsverbreiter:innen“, „Zerstörer:innen von Denkmälern und Häusern“ dienen als Beschreibungen für Tauben. Drastisch wird von ihnen als „Ratten mit Flügeln“ bzw. „Ratten der Lüfte“ gewarnt. Diese Metapher entstand in New York, wo der Parkwächter Thomas B. Hoving neben Drogendealern und Obdachlosen auch Tauben aus dem Bryant Park vertreiben wollte, damit dieser „sauber“ wird. Woody Allen verbreitete diese Redensweise in seinem Film „Stardust Memories“ von 1980 weltweit. Sie ruft Assoziationen mit der Pest hervor. Dass die Pest nicht von Ratten, sondern von Flöhen übertragen wurde, ist bis heute nicht jedem bekannt.
Fakten belegen, dass Tauben, genauso wie alle anderen so bezeichneten Haus- und Wildtiere, also auch wie zum Beispiel Katzen und Hunde, Krankheiten übertragen können. Die Gefahr ist jedoch gering. Ihr Kot ist bei richtiger Fütterung neutral. Autoabgase und saurer Regen sind hauptverantwortlich für den Zerfall von Denkmälern. Menschen verdrängen ihre Schuld. Auch ist das Geschäft von Säuberungs- und Vergrämungsmaßnahmen, als Taubenabwehr beworben, sehr rentabel. Es schafft großes Tierleid, denn Tauben verletzen sich an den sogenannten Spikes und verfangen sich in den Netzen.
Neuerrichtete Taubenschläge in Städten ermöglichen Tauben ein gesundes Leben. Futter und reichlich Wasser werden angeboten, der Taubenschlag wird regelmäßig gereinigt. Allerdings greifen Menschen dabei drastisch in die Vermehrung der Tiere ein. Deren Eier werden durch Attrappen ausgetauscht, was die Tauben brüten lässt, aber zu einer Bestandsminimierung führt.
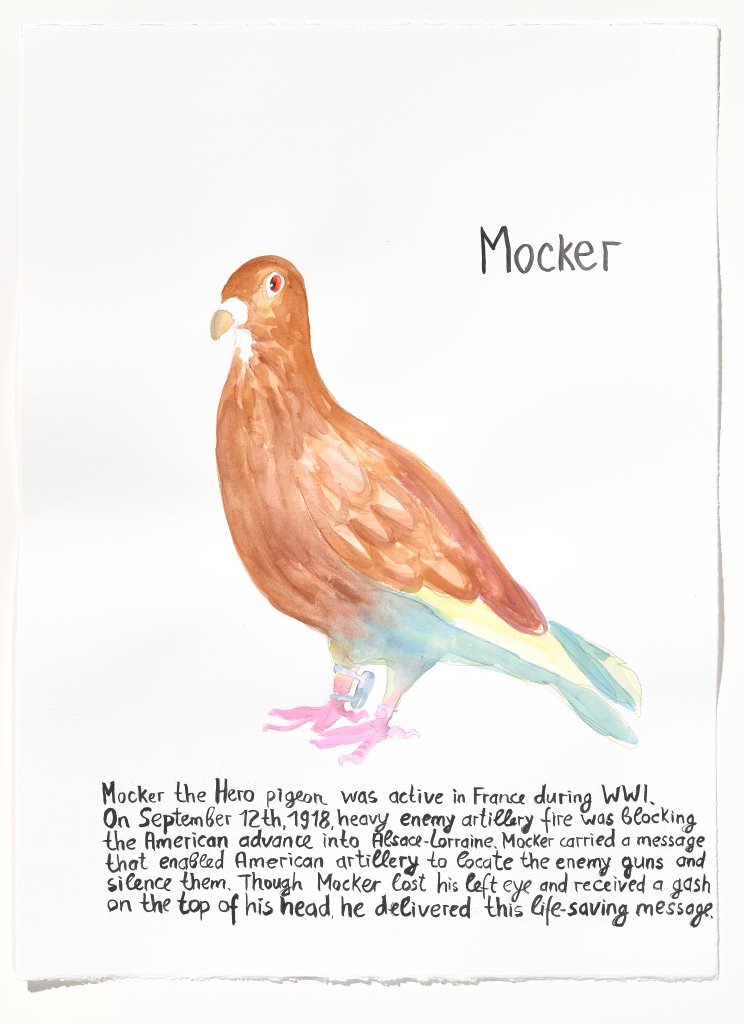
Abbildung 2: Mocker. Anna Jermolaewa, "Famous Pigeons (Mocker)", TLM, Moderne Sammlung 2024.
Tauben als Orientierungskünstler:innen im Einsatz
Tauben finden zielgerichtet den kürzesten Weg zurück zu ihrem Schlag und zeichnen sich nicht nur als Brieftauben durch ihren hervorragenden Orientierungssinn aus. Sie richten sich nach dem Stand der Sonne, dem Magnetfeld der Erde und Landmarken. Diese Eigenschaft teilen sie auch mit anderen Vögeln. Das Besondere an Tauben ist aber ihre einfache Haltung. Unter günstigen Bedingungen können sie bis zu 1000 Kilometer am Stück zurücklegen. Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 120 km/h fliegen sie sehr schnell. Und ihr empfindliches Gehör reagiert auf besonders tiefe Töne, den Infraschall. Dies ermöglicht ihnen, Geräusche, die von weit herkommen, zu hören, wie etwa eine ferne Meeresbrandung. Zudem sind sie in der Lage, den Geruch des Heimatschlages und dessen Umgebung über weite Entfernungen zu empfangen.
Darum hat auch der Kriegseinsatz von Brieftauben eine lange Tradition, die im 19. Jahrhundert an Bedeutung gewann. Zwar galten Brieftauben am Vorabend des ersten Weltkrieges aufgrund zunehmender Technisierung als Auslaufmodell, aber mit den alltäglichen Problemen der modernen Kommunikationstechniken, wie zum Beispiel durchtrennte Telegraphenleitungen, änderte sich diese Meinung abrupt. Sodass Brieftauben im Ersten und noch im Zweiten Weltkrieg für das Militärwesen unverzichtbar waren. In ganz Europa wurden die Vögel daher aus den Taubenschlägen ausgehoben. Häufig stellten sich dazu die zivilen Züchter als militärisches Pflegepersonal zur Verfügung. Insgesamt wurde etwa eine halbe Million Brieftauben in beinahe allen Kombattantenstaaten (Angehörigen der Streitkräfte) eingesetzt. Neben Nachrichtenübermittlungen setzte man Tauben auch in der Luftfotografie ein. Dazu schnallte man ihnen kleine Kameras an, die automatisch auslösten und Bilder von feindlichen Linien ermöglichten. Viele Menschenleben konnten durch sie gerettet werden, wenngleich sie selbst oftmals dafür ihr eigenes Leben verloren.
„Die Wahrnehmung der Taubeneinsätze in der Öffentlichkeit war enorm. Die einzelnen Berichte über militärisches Heldentum der Tauben unterstreichen einen weiteren faszinierenden Aspekt des Kriegseinsatzes: ihre kulturelle Bedeutung. […] Nach dem Krieg gingen einige der gefiederten Kriegshelden auf Tournee, zunächst als lebendige, später ausgestopfte Zeugen des großen Massakers“, schreibt Rainer Pöppinghege. „Ähnlich wie die Soldaten wurden die Brieftauben als Kriegshelden bzw. Märtyrer gefeiert. […] Einige von ihnen wurden durch die Regierungen mit dem englischen Victoria Cross oder in Frankreich mit dem Croix de Guerre ausgezeichnet.“ (Pöppinghege 2009: 103-117)
Der abgebildete „Mocker“ stammt aus einer fortlaufenden Serie „Famous Pigeons“ der politischen Konzeptkünstlerin Anna Jermolaewa. Sie porträtiert darin acht Brieftauben, die in außergewöhnlicher Weise die beiden Weltkriege prägten. „Ich persönlich mag Tauben. Sie haben gemeinhin einen schlechten Ruf und mir war daran gelegen, ihr Image ein wenig aufzubessern. […] Die Famous Pigeons sind zwar Kriegsveteranen, aber keine Symbole per se. Sie nehmen unfreiwillig am Krieg teil, ähnlich wie Wehrpflichtige“ beschreibt die Künstlerin ihre Intention in einem Gespräch mit Thomas Trummer (Trummer 2024).
Heute finden Brieftauben oftmals ihren Einsatz im umstrittenen Taubensport. Im Vordergrund stehen hier Leistung und Wirtschaftlichkeit, das Wohlbefinden der Vögel spielt in der Regel keine Rolle. Tierschutzorganisationen und Privatinitiativen machen immer wieder darauf aufmerksam und setzen sich für ein Verbot der Wettflüge ein.
Als „zartes“ Täubchen auf dem Speiseplan
Über Jahrtausende hinweg waren Tauben als Nahrungsmittel für Menschen wichtig. Sie wurden mit vorgekautem Brot zwangsernährt und zur Verfettung gebracht. In Österreich waren Tauben bis in die 1950er Jahre eine beliebte Nahrungsquelle und wurden häufig gegessen. Ihr Fleisch, leicht verdaulich, mit wenig Fett und viel Eiweiß und Mineralstoffen, galt als gesundheitsfördernd und wurde zum Beispiel in Wiener Krankenhäusern einmal pro Woche als Diätspeise angeboten. Weiterhin auf dem Speiseplan stehen Tauben unter anderem in England und Frankreich. Zahlreiche Kochrezepte finden sich dazu im Internet.
Die Industrialisierung veränderte die menschliche Nutzung der Tauben aber massiv. Ausgehend von den USA, Anfang des 20. Jahrhunderts, nahm das Huhn ihren Platz auf dem menschlichen Speiseplan ein. Hühner ertragen die Umstände der oft quälerischen, jedenfalls aber intensiven und verdichteten Tierhaltung in großen und geschlossenen Ställen besser als Tauben. Der für die Landwirtschaft über eine lange Zeit wichtige Taubenkot wurde durch synthetisch hergestellten Dünger ersetzt.
Tauben wurden auch Heilkräfte zugesprochen. So sollten sie unter anderem bei Augenleiden, bei Geschwüren oder Typhus heilend wirken. Man glaubte unter anderem, dass Krankheiten auf die Tauben übertragen werden könnten. Hierfür ließ man sie im Krankenzimmer nisten. Oder man legte Teile eines getöteten Tieres auf kranke Stellen und Körperteile. Tauben wurden aber auch am Körper des Kranken festgebunden, manchmal gar, bis sie qualvoll starben und verfaulten.
Menschliches Staunen über kluge Tauben
Das, was Menschen unter Intelligenz verstehen, ist durchaus bei Tauben feststellbar. Menschen können jedoch in keiner Weise alle Fähigkeiten der Tauben erkennen. Tauben sind ihnen in vielem überlegen. Ohne GPS oder Landkarte finden sie von ihnen unbekannten Orten nach Hause. Und sie sehen und hören deutlich besser als Menschen und viele anderen Tiere. Die US-Küstenwache trainierte Tauben, treibende Menschen im Meer zu entdecken. Ihre Trefferquote lag vom Helikopter aus bei 90-100 Prozent. Menschen hingegen erreichten nur eine Quote von 38 Prozent. Die erstaunlichen Fähigkeiten der Tauben konnten nach einer kurzen Einarbeitungszeit auch zur Erkennung von Brustkrebs auf Röntgenbildern eingesetzt werden. Sie erzielten bis zu 85 Prozent, im Team – wenn man das Ergebnis von vier Tauben zusammenzählt – erhöhte sich die Trefferquote sogar auf 99 Prozent. Darüber hinaus erkennen Tauben Gesichter wieder, auch wenn sie sie nur einmal gesehen haben. Und sie merken sich mehr als 1000 Bilder für mindestens ein Jahr. Tauben können selbst kleine Bildausschnitte zuordnen. Überdies erkennen sie nach einem Training Werke von Maler:innen, ohne genau dieses Bild vorher gesehen zu haben.
Verglichen mit menschlichen Fähigkeiten zeigt sich in Experimenten, dass Tauben planen, täuschen, lügen, betrügen und Werkzeuge benutzen können. Sie verfügen über abstraktes Wissen und haben, nach menschlicher Definition, Bewusstsein von sich selbst. Sie rechnen gut, haben darüber hinaus ein Verständnis von Wahrscheinlichkeiten, auch von Arithmetik, von Verlust und Gewinn. Bei der Lösung von manchen statistischen Problemen sind sie besser als die meisten Menschen, da sie aus Erfahrungen ihr Verhalten flexibler anpassen. Bei komplexen Aufgaben sind sie beharrlich und ihre Frustrationstoleranz ist hoch.
Literaturverzeichnis
Ackerman, Jennifer: Die Genies der Lüfte. Die erstaunlichen Talente der Vögel. Reinbek bei Hamburg 2017.
Amir, Fahin: Schwein und Zeit. Tiere, Politik, Revolte. Hamburg 2018.
Pöppinghege, Rainer: Brieftauben im Ersten Weltkrieg. In: (Ders. (Hg.): Tiere im Krieg. Von der Antike bis in die Gegenwart. Paderborn 2009, 103-117.
Schneider, Karin: Tauben. Ein Porträt. In: J. Schalansky (Hg.): Naturkunden Nr. 69. Berlin 2021.
Quellenverzeichnis
Arttirol 10. Kunstankäufe des Landes Tirol 2021-2023. Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck 2024.
Jermolaewa Anna im Gespräch mit Thomas D. Trummer. In: Trummer, Thomas D./Kunsthaus Bregenz (Hg.): Anna Jermolaewa. KUB Collection. Köln 2024.
SWR2 Wissen. Podcast. Die Taube – Ein Vogel polarisiert. Online unter: https://www.swr.de/swr-suche-100.html?swx_restriction=&swx_q=Die%20Taube%20ein%20vogel%20polarisiert%20 (Stand: 03.01.2025).
Die Taube. Friedenssymbol und Hassobjekt. Von Volker Eklkofer / Sendung Brigitte Kohn. 2014. Online unter: https://www.br.de/radio/bayern2/sendungen/radiowissen/mensch-natur-umwelt/taube-vogel-frieden-hass-symbol-100.html (Stand:03.01.2025).

Codex 281, Digitalisat der Universitäts- und Landesbibliothek Innsbruck
Von Haut und Ei zu Kunst und Schrift
Tiere spielen in der Geschichte der Buchherstellung eine weit größere Rolle, als man auf den ersten Blick vermuten würde. Sie liefern das Material für Pergament, das über Jahrhunderte hinweg als Beschreibstoff benutzt wurde, weil es haltbar ist und sich gut für die Überlieferung von Wissen eignet. Außerdem dienten Tiere als Inspirationsquelle für kunstvolle Illustrationen, die nicht nur schön aussehen sollten, sondern oft auch eine tiefere symbolische Bedeutung hatten. In mittelalterlichen Handschriften gibt es viele Darstellungen von Fabelwesen, realen Tieren und Mischwesen. Sie dienten als Allegorien oder Metaphern für moralische und theologische Konzepte. Man findet Tiere in Lehrtexten, in Bestiarien – mittelalterlichen Tierdichtungen – oder als Verzierungen in illuminierten Manuskripten. Besonders spannend ist zum Beispiel der Codex 281 aus der Zeit zwischen 1490 bis 1495 der Universitätsbibliothek Innsbruck. Der ist nicht nur ein wichtiges Zeugnis der mittelalterlichen Buchkunst, sondern zeigt auch, wie die Menschen damals über Tiere gedacht haben. Die schönen Miniaturen und die genauen Tierbilder in der Handschrift zeigen, wie wichtig Tiere im Denken und Schreiben des Mittelalters waren. Es handelt sich um ein sogenanntes Stundenbuch – also ein liturgisches Buch für das Stundengebet, das insbesondere im Mittelalter von Geistlichen und Laien genutzt wurde. Es enthält Gebete, Psalmen und Hymnen für verschiedene Tageszeiten und oft auch kunstvolle Illustrationen. Der Codex 281 gehörte Frere Jean Bourgeois und zeigt nicht nur, wie schön mittelalterliche Bücher gestaltet wurden, sondern auch, wie Menschen ihre Umwelt – besonders die Tiere – in ihr Wissen, ihre Geschichten und ihre religiösen Vorstellungen einbanden.
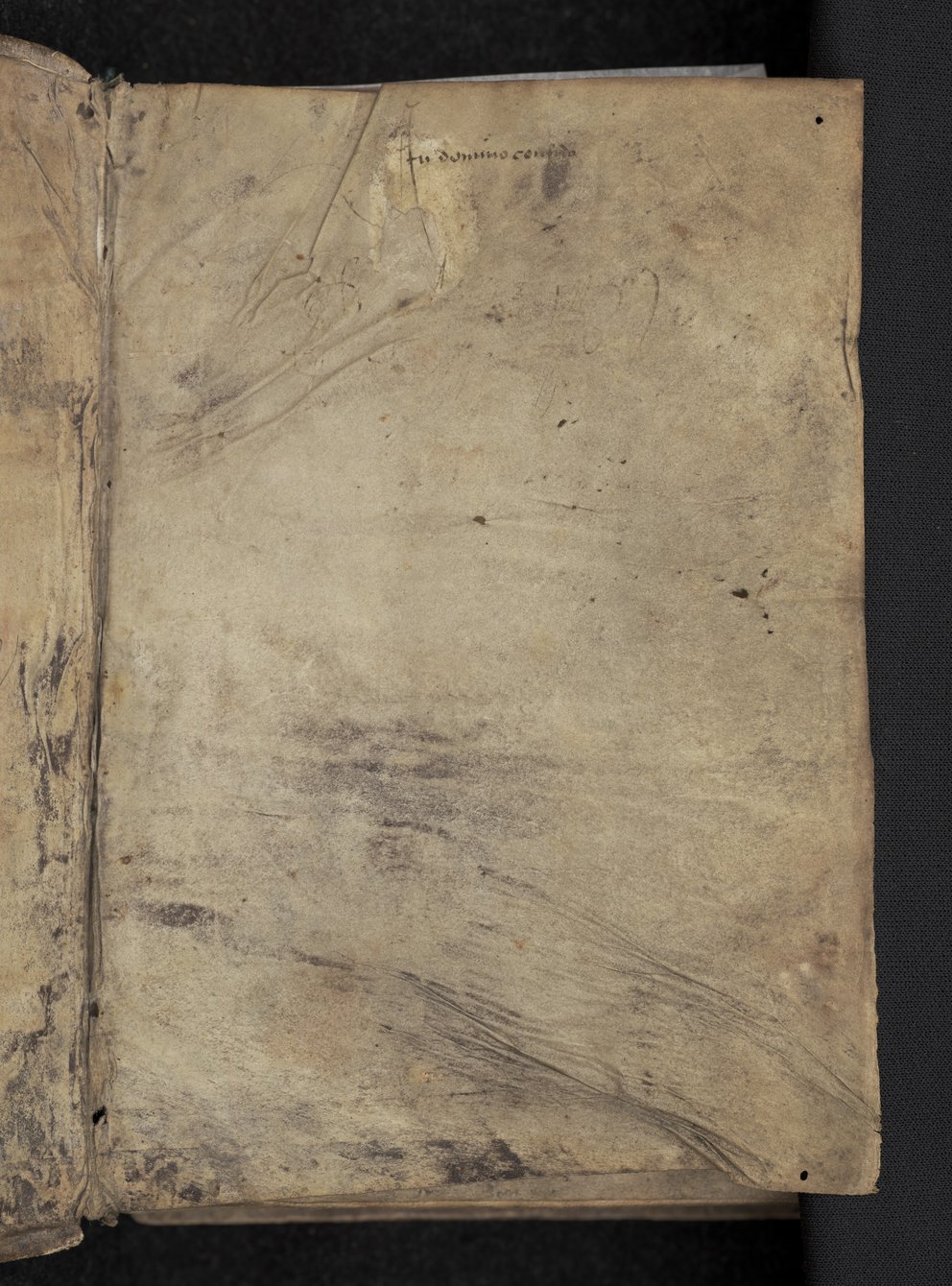
Abbildung 1: Digitalisat Codex 281 ULB Innsbruck
Pergament: Von der Tierhaut zur Schreibfläche
Pergament war im Mittelalter der wichtigste Beschreibstoff. Man hat es aus Tierhäuten gemacht, vor allem von Kälbern, Schafen oder Ziegen. Die Herstellung war aufwendig: Die Häute wurden erst mal in Wasser gereinigt, um Schmutz und Fett rauszuholen. Dann wurden sie in eine Kalklauge gelegt, damit Haare und andere organische Rückstände rauskommen. Dann wurden die Häute aufgespannt und mit einem speziellen Messer so lange abgeschabt, bis die Oberfläche glatt und gleichmäßig war. Das war ein aufwendiger Prozess, der viel Sorgfalt, Erfahrung und handwerkliches Geschick erforderte, denn die Qualität des Pergaments hing stark von der richtigen Bearbeitung ab. „Die Größe der Pergamentblätter wurde häufig durch Zusammensetzung mehrerer Stücke oder durch Ergänzung von schmalen Streifen am Rand erreicht“ (Kompatscher 1999, 279). Pergament war damals richtig teuer und wurde so bearbeitet, dass es für die Schreibenden praktisch war. Manchmal kann man in alten Handschriften noch die Nähte oder Klebestellen erkennen, mit denen kleinere Pergamentstücke zusammengefügt wurden, um größere Seiten zu bekommen. Pergament war haltbarer als Papier, deshalb wurde es für wertvolle Handschriften verwendet. Es war robust, wetterfest und abriebfest, sodass viele mittelalterliche Codices bis heute gut erhalten geblieben sind. Ein weiterer Vorteil war, dass Tinte zur Korrektur einfach abgekratzt oder überschrieben werden konnte. Das ging auf Papier nicht. Besonders hochwertiges Pergament wurde als Vellum bezeichnet, das aus der Haut ungeborener oder neugeborener Kälber gewonnen wurde. Es war schön glatt, durchsichtig und wurde für die wertvollsten Manuskripte, königliche Urkunden oder Bibelausgaben verwendet. Bei der Herstellung von Vellum musste man ganz genau arbeiten, weil schon kleinste Unregelmäßigkeiten die feine Struktur des Materials beeinträchtigen konnten. Das Wenden, Spannen und Abschaben der Tierhaut war ziemlich aufwendig und die verschiedenen Qualitäten des Pergaments wurden dann auch für verschiedene Zwecke genutzt. Für kunstvoll illustrierte Handschriften wurde feines Vellum verwendet, für alltägliche Dokumente oder weniger aufwendig gestaltete Bücher gröberes Pergament. Die mittelalterlichen Handschriften tragen noch heute die Porenstruktur der Tierhaut und lassen dünnere oder dickere Stellen sowie feine Einschnitte erkennen. Dabei wurden kleinere Fehler, wie Risse oder Löcher, nicht immer als Makel betrachtet, sondern teilweise kunstvoll verziert oder in den Text integriert.

Abbildung 2: Digitalisat Codex 281 ULB Innsbruck
Farbpigmente: Farben aus Naturstoffen
Die Miniaturen und Verzierungen in Codex 281 sind vielseitig! Die Farben wurden aus natürlichen Stoffen, also tierlichen, pflanzlichen und mineralischen Substanzen gewonnen. Das war ein hochspezialisiertes Handwerk, das sowohl chemisches Wissen als auch handwerkliches Geschick erforderte. Die mittelalterliche Buchmalerei nutzte Materialien aus der Natur, um leuchtende Pigmente herzustellen, die noch heute wunderschön strahlend aussehen. Rot wurde aus Cochenille gemacht, das ist ein Farbstoff, der aus getrockneten und gemahlenen Körpern von Schildläusen gewonnen wurde. Das Rot des mineralischen Zinnobers wurde durch ein spezielles Erhitzungsverfahren aus Quecksilbersulfid hergestellt. Gelb kam von natürlichen Erdpigmenten wie Ocker oder von pflanzlichen Quellen wie Safran. Grün wurde oft aus Malachit hergestellt, während für Schwarz Ruß oder verbrannte Knochen verwendet wurden. Besonders wertvoll und begehrt war Ultramarinblau. Dazu brauchte man seltenen und teuren Lapislazuli, einen Halbedelstein, der hauptsächlich aus Afghanistan importiert wurde. Deshalb wurde die tiefblaue Farbe auch nur in den wertvollsten Handschriften oder für religiöse Darstellungen verwendet. Für die Farbherstellung müssen die Pigmente mit einem Bindemittel vermischt werden. Vor allem tierliches Eiweiß eignete sich gut, um richtig brillante und haltbare Farben zu kriegen. Eigelb hingegen diente vor allem als Bindemittel für die Temperamalerei. Aber auch tierliche Leime wurden für Farben und Vergoldungen genutzt. Fischleim – gewonnen aus Gräten und Fischhaut – oder Hasenhautleim – der heute noch im Instrumentenbau eingesetzt wird – haben dabei geholfen, die Pigmente zu binden und die Farbe noch brillanter zu machen. Diese organischen Bindemittel haben dafür gesorgt, dass die Farben nicht nur leuchtend blieben, sondern auch lange auf dem Pergament hafteten. Besonders aufwendig war die Technik der Vergoldung, die den Handschriften einen edlen Glanz verlieh. Das Blattgold wurde in hauchdünnen Schichten aufgetragen und mit Eiweiß oder Tierleim fixiert. Das Blattgold wurde dann poliert, um eine spiegelnde Oberfläche zu erzeugen. In manchen Handschriften wurden auch Goldpigmente in die Farben gemischt, um spezielle Glanzeffekte zu erzielen. Die Miniaturen, Ranken und Initialen machen die Bücher zu etwas ganz Besonderem. Man kann richtig gut erkennen, wie gut die Buchmalerei damals war. Und man sieht, dass die Menschen damals Ahnung von Materialkunde und Handwerkskunst hatten. Viele dieser Techniken sind heute fast in Vergessenheit geraten, aber in historischen Manuskripten wie dem Codex 281 sind sie noch in voller Pracht erhalten. Sie zeigen, dass Bücher im Mittelalter weit mehr als nur Wissensspeicher waren – sie waren Kunstwerke, die mit größtem Aufwand und tiefem Respekt vor den verwendeten Materialien geschaffen wurden.
Einband: Schutz und Schmuck zugleich
Neben der Schrift und den Bildern war auch der Bucheinband wichtig. Er schützte das Buch und zeigte, wie wertvoll die Handschrift war. Viele mittelalterliche Handschriften hatten also richtig schöne Einbände aus Leder. Das Leder kam von Rindern, Ziegen oder Schweinen. Die Verarbeitung des Leders war ein eigenes Handwerk, für das man spezielles Wissen über Gerbprozesse und Prägungstechniken brauchte. Besonders wertvolle Einbände hatten kunstvolle Muster, Prägungen oder Goldverzierungen, die das Buch zu einem echten Kunstobjekt machten. Manche Einbände hatten auch Metallbeschläge, die sie stabiler machten und vor Abnutzung schützten. Vor allem bei oft genutzten Büchern, brachte man Eckbeschläge und Metallbuckel an, um die empfindlichen Pergamentseiten zu schützen. Manchmal wurden auch kunstvolle Prägungen in die Einbände gemacht, mit biblischen Szenen, Blumenmustern oder Wappensymbolen. Besonders prunkvolle Codices wurden in mit Edelsteinen besetztes Leder gebunden und mit aufwendigen Goldprägungen versehen. Diese Bucheinbände waren oft von Klöstern oder Fürstenhöfen in Auftrag gegeben worden. Dadurch wurden die Handschriften nicht nur zu einem Gebrauchsgegenstand, sondern auch zu einem Statussymbol. Ein Buch mit wertvollem Einband zeigte Reichtum und Bildung an. Deshalb wurde es oft verschenkt oder als Stiftung an Kirchen und Klöster übergeben. Neben Leder wurden auch andere Materialien für Einbände verwendet. Einige Bucheinbände waren mit Pergament überzogen, das bemalt oder mit filigranen Mustern versehen wurde. Andere hatten stabile Holzdeckel, die mit Leder bespannt waren und oft auch Schnallen oder Schließen. Die Schließen waren nicht nur schön, sondern auch praktisch, weil sie dafür sorgten, dass sich die Pergamentseiten nicht wellten, wenn es feucht oder kalt wurde. Im Kloster waren aufwendig gestaltete Bucheinbände ein Ausdruck von Ehrfurcht und Kunstfertigkeit. Mönche und Buchbinder haben viel Zeit und handwerkliches Geschick investiert, um als sakrale Objekte zu gestalten. Liturgische Handschriften, Evangeliare oder Psalter wurden in prächtigen Deckeln aufbewahrt, die oft mit religiösen Symbolen geschmückt waren. Auch wissenschaftliche Codices oder Werke der antiken Philosophie erhielten edle Einbände, um ihre Bedeutung zu unterstreichen. Ein prächtig gebundener Codex war nicht nur ein Träger von Wissen, sondern auch ein Zeichen für geistige und kulturelle Errungenschaften. In Bibliotheken und Schreibstuben – sogenannten Skriptorien –wurden solche Handschriften mit besonderer Sorgfalt behandelt und oft mit speziellen Buchtruhen oder Regalsystemen aufbewahrt.

Abbildung 3: Digitalisat Codex 281 ULB Innsbruck
Tierdarstellungen: Tiere als Symbole und Wissensobjekte
Die Bilder von Tieren in alten Büchern hatten oft symbolische Bedeutungen. Sie waren mehr als nur Schmuck. Sie sollten Wissen vermitteln, Geschichten illustrieren oder theologische und moralische Konzepte veranschaulichen. Im Codex 281 finden sich Darstellungen von echten und fantastischen Tieren. Die Symbole und Details sind tief in der mittelalterlichen Kultur verwurzelt. Die Bilder waren also nicht nur schön, sondern sollten auch was lehren. Deshalb muss man die Tierdarstellungen nicht nur realistisch, sondern auch metaphorisch interpretieren. Sie spiegeln die mittelalterliche Weltanschauung, in der die Grenzen zwischen realer und mythischer Tierwelt oft verschwammen. So waren Drachen, Einhörner oder Greife keine reinen Fantasiewesen, sondern bedeutungsvolle Symbole. Drachen standen zum Beispiel für Chaos oder das Böse, Einhörner galten als Zeichen von Reinheit und Keuschheit. In vielen Manuskripten wurden Tierdarstellungen aber auch als Allegorien für moralische oder theologische Konzepte verwendet. Das Bild eines Löwen stand für Macht und Mut, oft auch für Christus, ein Drache für den Teufel und Schlangen für Weisheit und Versuchung. Vögel waren oft ein Zeichen für Spiritualität – Tauben symbolisierten den Heiligen Geist und Adler die göttliche Macht. Die dargestellten Füchse versinnbildlichten List und Betrug, Lämmer hingegen Sanftmut und Unschuld. Derartige Tierdarstellungen waren in Klöstern für die religiöse Bildung besonders wichtig und es gab dafür sogenannte Bestiarien – das war eine besondere Form mittelalterlicher Bücher. Sie verbanden Naturkunde mit christlicher Moral und erklärten die Bedeutung verschiedener Tiere anhand biblischer oder philosophischer Deutungen. Die Bücher stellten nicht nur zoologisches Wissen der damaligen Zeit dar, sondern gaben auch Hinweise darauf, wie Menschen durch die Betrachtung der Natur göttliche Wahrheiten erkennen sollten. Aber es gab nicht nur Bilder, die Tiere so darstellten, wie man sie sich vorstellte, sondern auch naturgetreue Abbildungen. Dazu gab es auch Beschreibungen, wie die Tiere lebten, was sie aßen und wofür man sie nutzte. Das war eine frühe Form naturwissenschaftlicher Dokumentation, die später auch die moderne Zoologie beeinflusst hat. Die kunstvollen Darstellungen von Tieren in Handschriften wie dem Codex 281 zeigen, wie eng Kunst, Theologie und Naturbeobachtung im Mittelalter miteinander verflochten waren. In dieser Zeit hatte jedes Lebewesen – ob echt oder fantastisch – eine tiefere Bedeutung.
Tiere in der Handschrift: Vom Material bis zur Inspiration
Tiere waren in der mittelalterlichen Buchkultur wichtig. Sie waren nicht nur das Material für das Pergament, auf dem man die Bücher schrieb, sondern auch für die Farben, mit denen man sie verzierte. Eiweiß, Knochenleim oder Schildlaus-Farbstoffe waren zum Beispiel essenzielle Bestandteile der Farbherstellung und Buchbindung. Aber Tiere waren nicht nur praktisch, sondern auch ein zentrales Motiv in der mittelalterlichen Kunst. Man findet sie in den Handschriften in den unterschiedlichsten Formen. Besonders oft wurden Tiere in Bestiarien dargestellt. Das sind mittelalterliche Enzyklopädien, die sich nicht nur mit der Naturkunde befassen, sondern auch erklären, welche symbolische Bedeutung verschiedene Tiere haben. Diese Werke vermitteln ein Weltbild, in dem jedes Lebewesen eine tiefere, oft moralische oder theologische Bedeutung hat. Der Löwe zum Beispiel stand für Christus, die Schlange für Weisheit oder den Teufel. Die abgebildeten Fabelwesen z eigten, dass es eine Verbindung zwischen Mythen und der realen Welt gab. Aber auch in anderen religiösen und weltlichen Handschriften tauchten Tiere auf. In alten Büchern und so finden sich oft Bilder von Tieren. Das sind dann so Randverzierungen oder Initialschmuck. Die Bilder sind nicht immer so streng symbolisch, manchmal sind sie auch einfach nur zum Spaß gemacht. Affen, Vögel, Katzen oder Hunde sind in den kunstvollen Ranken und Bordüren von Manuskripten zu sehen. Manchmal sind die Tiere in grotesken oder humorvollen Szenen zu sehen, die den Betrachter zum Schmunzeln bringen. Besonders in der gotischen Buchmalerei wurden Tiere oft mit menschlichen Eigenschaften versehen – etwa als musizierende Hasen, kämpfende Schnecken oder fabelhafte Mischwesen. Auch die Kunst der Marginalien – also die dekorativen Zeichnungen am Rand von Manuskripten – zeigt, wie sehr Tiere Teil der visuellen Kultur des Mittelalters waren. Manche dieser Bilder am Rand hatten eine tiefere Bedeutung, andere waren einfach nur zum Unterhalten oder als Karikaturen über die Gesellschaft. In manchen Handschriften sieht man Szenen, in denen Tiere wie Füchse oder Eulen menschliche Rollen übernehmen – die Füchse sind dann listige Mönche oder die Eulen stehen für Weisheit oder das nächtliche Geheimnis. Die Tiere waren nicht nur ein Rohstoff, sondern auch eine Inspirationsquelle für Künstler und Schreiber. Sie waren ein wichtiger Teil der mittelalterlichen Weltanschauung und wurden auf verschiedene Arten in die Buchgestaltung integriert, zum Beispiel als symbolische Wesen, als Deko oder als humorvolle Elemente am Rand. Die Handschriften zeigen also nicht nur das Wissen der Zeit, sondern auch die enge Verbindung zwischen Menschen, Natur und Kunst, die damals eine zentrale Rolle spielte.
Eine Verbindung von Kunst und Kultur
Der Codex 281 ist ein echt beeindruckendes Beispiel dafür, welche große Rolle tierliche Materialien und Vorstellungen von Tieren als Natur- und Fabelwesen für die Schriftkultur des Mittelalters spielten. Vom Pergament über Farbpigmente bis hin zu kunstvollen Bucheinbänden und symbolträchtigen Tierdarstellungen – Tiere waren in der Handschriftenproduktion allgegenwärtig. Sie waren Rohstofflieferanten für die Herstellung der Bücher, Inspirationsquelle für die künstlerische und inhaltliche Gestaltung und versinnbildlichen noch heute die mittelalterliche Weltanschauung. Ihre Häute waren das Pergament, ihre Farbstoffe sorgten für leuchtende Miniaturen und aus ihren Knochen und Häuten gewonnene Leime und Bindemittel ermöglichten die handwerkliche Perfektion der Buchkunst. In den Bestiarien und in theologischen Werken symbolisierten Tierdarstellungen christliche Tugenden oder Laster und dienten zur Veranschaulichung moralischer Lehren. In weltlichen Handschriften fanden sie sich in spielerischen oder humorvollen Darstellungen wieder. Die Tiere in den Büchern zeigen, wie eng die Menschen damals mit der Natur verbunden waren und wie sie die Welt sahen. Heute sind solche Handschriften also nicht nur historische Dokumente, sondern auch Zeugen einer vergangenen Kunstform, in der Natur und Kultur auf einzigartige Weise miteinander verbunden waren. Sie erzählen von einer Zeit, in der Bücher nicht nur Wissensspeicher, sondern auch kunstvolle Objekte waren, deren Herstellung ein tiefes Verständnis für Materialien, Symbole und handwerkliche Techniken erforderte. Der Codex 281 ist also ein echt faszinierendes Beispiel dafür, wie sich das Wissen und die künstlerische Ausdrucksweise einer Epoche in den Seiten eines Buches widerspiegeln können.
Literaturverzeichnis
De Bruyker, Melissa: Fokalisierung aus anthropologischer Sicht. In: Orbis Litterarum 65(4), 2010, 255–291.
Förschler, Silke: Medium der Verlebendigung. Tierdarstellungen auf Pergament. In: Ullrich, Jessica/Rieger, Stefan (Hg.): Tiere und/als Medien. Neofelis Verlag 2020.
Kluge, Mathias: Handschriften des Mittelalters: Grundwissen Kodikologie und Paläographie. 2. Aufl., München 2015.
Kompatscher, Gabriela: Katalog der Handschriften der Universitätsbibliothek Innsbruck, Teil 3: Cod. 201–300. Wien 1999.
Löffler, Karl: Einführung in die Handschriftenkunde. Wiesbaden 2023.
Manuscripta.at: Codex 281 – Handschriftendetail. Online unter: https://manuscripta.at/hs_detail.php?ID=7862 (Stand: [6. Februar 25]).
Piccard, Gerhard: Die Wasserzeichenkartei Piccard im Hauptstaatsarchiv Stuttgart. Stuttgart 1966.
Schneidmüller, Bernd: Papier im mittelalterlichen Europa. Herstellung und Gebrauch. Berlin 2015.

Hornlöffel im Tiroler Volkskunstmuseum (Eigene Aufnahme Kevin Albu 2024)
Hornlöffel

Abbildung 1: Hornlöffel im Tiroler Volkskunstmuseum in Innsbruck, eigene Aufnahme Kevin Albu 2024
Beim Objekt handelt es sich um einen verzierten Löffel aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Als Material wurde Horn verwendet, vermutlich handelt es sich dabei um Ochsen- oder Kuhhorn. Ausgestellt wird er in der Dauerausstellung „Das Prekäre Leben“ im Tiroler Volkskunstmuseum in Innsbruck. Gemeinsam mit weiterem Besteck befindet sich der Löffel in einer Ledertasche, die ebenfalls verziert wurde – in der Mitte ein rotes Herz. Der Löffel ist 19 Zentimeter lang und wurde in der Mitte des Stiels ‚gedreht‘, ein typisches Merkmal für Hornlöffel aus Sterzing zu dieser Zeit. Ein sogenanntes ‚Treueherz‘ ist mit der Zahl Drei eingraviert, was ein typisches Liebesmotiv für Geschenke aus dem 18. und 19. Jahrhundert ist. Neben weiteren eingravierten Verzierungen lässt sich mit geschultem Auge lesen: „Ein dreyes Herz ich esta mir da weil ich ein solches führ“. Während „esta mir“ sich mit "erwarte mir" übersetzen lässt, steht „drey“ für „treu“. Durch die gleiche Aussprache der Wörter lässt sich die Zahl Drei erklären.

Abbildung 2: ‚Löffelbrett‘ mit verzierten Hornlöffel aus: Waggerl, Karl Heinrich: Schöne Sachen: bäuerliches Brauchgut. Salzburg 1974. S. 89.
Der Hornlöffel kam wohl eher weniger beim Essen zum Einsatz und mehr als Dekoration. Verzierte ‚Löffelbretter‘ wurden an die Wand gehängt und mit Zierlöffeln bestückt. Wie verbreitet diese Dekoration allerdings war, welche Haushalte sie tatsächlich führten und wann genau, ist leider schwierig zu beantworten.
Zur Herstellung
Sterzing galt in den Alpenländern zum 18. und 19. Jahrhundert als eines der größten Verarbeitungszentren der mitteleuropäischen Hornwarenindustrie. Jährlich wurden dort so viele Hauswaren aus Horn exportiert, dass die Sterzinger „Löffelmacher“ (Menardi 1994: 8) ein beachtliches Maß an Rinderhörnern für die Produktion importiert haben müssen. Für die Herstellung der Löffel wurden die Hörner aufgeschnitten und gegebenenfalls eingeweicht. Unter Wärmeleistung in eine Platte gepresst, ließen sie sich leichter zuschneiden und verbiegen. Die Verzierung der Löffel gestaltete sich je nach Gebrauch: Vor allem Liebesmotive scheinen beliebt gewesen zu sein, aber auch als Hochzeitsgaben, zur ‚Weisat‘ oder Taufe, oder als Erinnerungsstücke fanden sie Verwendung. Der Name ‚Löffelmacher‘ verbreitete sich wohl, weil die Hornlöffel neben Schnupftabakdosen besonders hohe Verkaufszahlen erreichten. Es wurden aber auch Haarkämme und Pulverhörner hergestellt. Besonders stark wirtschaftete die Hornwarenindustrie im 18. und frühen 19. Jahrhundert, allerdings neigte sie sich mit der Wende zur Moderne und der Industrialisierung im Laufe des 19. Jahrhunderts dem Ende zu. Bis 1914 lief die Produktion in geringem Maß weiter, Mitte des 20. Jahrhunderts flaute sie endgültig ab. Über die genauen Gründe wird wenig berichtet, doch die Massenproduktion von Blechwaren (einschließlich Besteck) spielte wohl eine entscheidende Rolle. Zu den Lebensumständen der sogenannten „Löffelmacherfamilien“ (Menardi 1994: 9) ist wenig bekannt, allerdings wird berichtet, dass sie Ende des 19. Jahrhunderts wohl eher bescheiden verdienten.
Liebesgabe
Hornlöffel sind ein typisches Objekt für die ‚Liebesgaben‘ im 18. und 19. Jahrhundert, später wurden aber auch andere Objekte als Liebesgaben verstanden – zum Beispiel Hilfsgüter aus der Bevölkerung für die Soldaten an den Fronten des Ersten Weltkrieges. Und auch Hauswaren wie Geschirr und andere Alltagsgegenstände waren keine unüblichen Geschenke, die mit entsprechenden Verzierungen zu Liebesgaben wurden. Die Spannbreite der Anlässe für solche Geschenke war breit: So war es möglich, zur Hochzeit einen verzierten Löffel mit Glückwünschen, dem Hochzeitstag oder den Namen des Paares aus dem Kreis der Verwandtschaft zu erhalten. Aber auch als persönliche Liebes- oder Freundschaftsgeschenke wurden Hornlöffel oder andere Waren übergeben. Dabei spielt Geschlecht eine Rolle bei der Auswahl der Gaben und dies deutet wiederum verschiedene gesellschaftliche Rollenzuschreibungen an: Im Kontext der Hornwaren bekamen Männer oft Geschenke wie Schnupftabakdosen, Pulverhörner, Pfeifen oder Zündholzbehälter, während Frauen beispielsweise Kämme, Bürsten, Nähstöcke oder Wollkratzer erhielten.
Tiere als Material der Volkskunst
Löffel aus Rinderhörnern aber auch andere Objekte als tierlichen Überresten wie Haut, die zu Leder gemacht wird, Zähne, die zu Schmuckgegenständen werden oder Knochen, die für die Herstellung von Seife verwendet werden, werfen die Frage auf, ob die Verarbeitung dieser Materialien zu ‚Liebesgaben‘ oder Alltagswaren im Sinne tierethischer Überlegungen hinterfragt wurde. Es ist anzunehmen, dass Tiere und tierliche Körper als Ausgangsstoffe selbstverständlich erschienen. Aus tierethischer Perspektive wird dies oft als Verdinglichung von Tieren verstanden. Dieses Zum-Ding-Machen ist im Rahmen der ‚Volkskunst‘ häufig wiederzufinden, sei es in Form von Material, Schmuck oder künstlerischen Darstellungen. Worauf die Hornlöffel, die als Volkskunst gesammelt wurden, aber auch hinweisen: Die tierlichen Materialien müssen auch als wertvoll gegolten haben. Die soziokulturellen Umstände im 19. Jahrhundert mit der damaligen Ressourcenknappheit und Armut eines Großteils der Bevölkerung in den Alpenländern bedingte einen sorgsamen Umgang mit jeglichen Roh- und Ausgangsstoffen. Dies beförderte eine Form der Kreislaufwirtschaft, die die Verwendung aller Teile der tierlichen Körper umfasste. Das bezieht sich nicht allein auf die Ernährung im Sinne von „From Nose to Tail“, sondern eben auch auf die Nutzung und Verwendung von Horn, Klauen, Haut und Knochen als Ausgangsmaterialien für unterschiedlichste Dinge. So verdeutlichen die als Liebesgaben verzierten Hornlöffel einen wichtigen Aspekt: In der alpin-agrarisch geprägten Lebenswelt, in der die Hornlöffel hergestellt und benutzt wurden, waren Tiere und tierliche Spuren immer und überall zu finden. Dabei standen die Menschen und die genutzten Tiere in einem eng aneinander gebundenen Abhängigkeitsverhältnis. Und dieses konnte erst mit der Verwendung moderner – meist auf Petrochemie basierenden – Materialien breitenwirksam gelockert werden. Allerdings gibt es auch Ausnahmen: Als Alternative zum Hornlöffel gab es beispielsweise die Viechtauer Zierlöffel, die in etwa zur gleichen Zeit aus Holz geschnitzt und in großen Mengen exportiert wurden. Aber auch hier finden sich Darstellungen von Tieren auf den Löffeln.
Was von den Tieren bleibt
Die musealen Bestände insbesondere der volkskundlichen Sammlungen bergen mit einer Vielzahl von Kunst- und Alltagsobjekten etliche Beispiele, die Auskunft geben könnten über tierliches Leben, Tiernutzung und das menschlich-tierliche Zusammenleben in historischen Verhältnissen. Der Kontext, in dem diese Dinge aber gezeigt werden, lässt oftmals erst auf den zweiten Blick auf die tierlichen Anteile schließen. So zeigt beispielsweise auch die Deutung der Hornlöffel als Liebesgaben an, dass damit Geschichten über vergangene menschliche Praktiken konserviert und erzählt werden. Aber derart werden die Dinge und die mit ihnen überlieferten Geschichten nur eingeschränkt dargestellt, nämlich aus anthropozentrischer Perspektive.
Literatur
Beitl, Klaus: Liebesgaben: Zeugnisse alter Brauchkunst. Salzburg/Wien 1974.
Benker, Gertud: Alte Bestecke: ein Beitrag zur Geschichte der Tischkultur. München/Callwey 1978.
Haibl, Michaela: Nachforschungen zur Erforschung der Liebesgabe. In: Beitl, Matthias/Schneider, Ingo (Hg.): Emotional turn?!: europäisch ethnologische Zugänge zu Gefühlen & Gefühlswelten: Beiträge der 27. Österreichischen Volkskundetagung in Dornbirn vom 29. Mai - 1. Juni 2013. Wien 2016.
Haller, Reinhard: Aus alten Kästen und Truhen: Liebesgaben und Hochzeitsgeschenke; Volkskunst in Oberbayern, Niederbayern und der Oberpfalz. München 1980.
Kierdorf-Traut, Georg: Volkstkunst in Tirol. Alpenländische Kunsttradition zwischen Kulturströmungen. Bozen 1977
Menardi, Herlinde: Um Liebe und Hochzeit: Katalog zur Sonderausstellung des Tiroler Volkskunstmuseums, 4. Juli bis 26. Oktober 1981. Innsbruck 1981.
Menardi, Herlinde: Sterzinger Hornarbeiten: 17. - 20. Jh.; Sonderausstellung im Deutschordenshaus Sterzing. Sterzing 1994.
Petrus, Klaus: Verdinglichung. In: Ferrari, Arianna/Petrus, Klaus (Hg.): Lexikon der Mensch-Tier-Beziehungen. Bielefeld 2015.
Schmidt, Leopold: Volkskunst in Österreich. Wien 1966.
Waggerl, Karl Heinrich: Schöne Sachen: bäuerliches Brauchgut. Salzburg 1974.
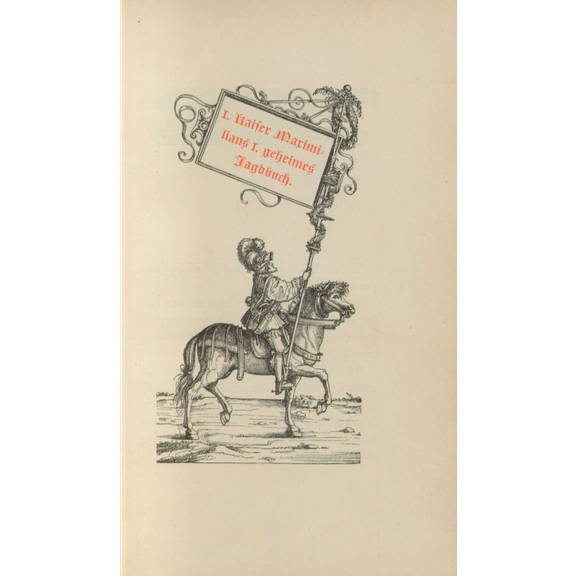
Maximilianisches Jagdbuch, Digitalisat der Universitäts- und Landesbibliothek Innsbruck
Tierliche Bildmotive

Abbildung 1: Kachelofen im Tiroler Volkskunstmuseum, eigene Aufnahme Marilena Buchauer und Sara Knollenberger 2025
Vom „Recht des Stärkeren“ auf einem Kachelofen mit Jagdmotiven im Tiroler Volkskunstmuseum
Der Kachelofen aus Kufstein wird auf das 16. Jahrhundert datiert und heute im Tiroler Volkskunstmuseum Innsbruck aufbewahrt. Seine grafitierten Schüsselkacheln aus gebranntem Ton bilden eine pyramidenförmige Struktur mit einer Höhe von etwa 144 cm und einer Tiefe und Breite von je 106 cm. Die Motive der Kacheln zeigen zwei leicht variierende Jagdszenen: Eine Darstellung zeigt einen Jäger, der ein Gewehr anlegt, begleitet von einem Hund. In der zweiten Szene fehlt der Hund, dafür trägt der Jäger eine Tasche am Gürtel. Zu sehen sind außerdem drei unterschiedliche Darstellungen von springenden Hirschen.

Abbildung 2: Detailausschnitt Kachelofen Tiroler Volkskunstmuseum, eigene Aufnahme Marilena Buchauer und Sara Knollenberger 2025
Jagd als Bildmotiv
Die Jagdszenen auf den Kacheln sind mehr als nur dekorative Elemente – sie galten als Ausdruck von Herrschaft und sozialem Status (Leib, 2011). In der frühen Neuzeit war die Jagd ein Privileg der Oberschicht und eng mit ihrem Selbstverständnis verknüpft. Der Hirsch, oft als Sinnbild von Stärke und Männlichkeit verstanden, verkörperte das Ideal des edlen Jägers und seiner überlegenen Stellung gegenüber der Natur. Die Darstellung der Jagd diente dazu, die Kontrolle des Menschen über die Natur zu verdeutlichen und den Herrschaftsanspruch der Elite zu unterstreichen (Brassat, 2009).
Der Hirsch hatte zudem in der christlichen Symbolik eine tiefe Bedeutung. In mittelalterlicher Ikonographie wurde er mit Christus assoziiert, während die Jagd nach dem Hirsch als spirituelle Suche nach Erlösung interpretiert werden kann. Diese tiefgreifende Symbolik könnte auch auf den Kufsteiner Kacheln eine Rolle spielen. Der Hirsch soll als heiliges Tier und Bote göttlicher Weisheit wahrgenommen worden sein (Delumeau, 1980). Die Vorstellung des Hirsches als göttliches Wesen findet sich auch in Legenden wie jener des Heiligen Hubertus, dem während einer Jagd ein Hirsch mit einem leuchtenden Kreuz zwischen dem Geweih erschien und ihn zur Bekehrung geführt haben soll (Wikisource).

Abbildung 3: Detailausschnitt Kachelofen im Tiroler Volkskunstmuseum, eigene Aufnahme Marilena Buchauer und Sara Knollenberger 2025
Jagd als Privileg der Oberschicht
Die Jagd, insbesondere die Hirschjagd, war und ist bis heute eng mit dem Adel und der Oberschicht verbunden. Jagen gilt als herrschaftliche Tätigkeit der oberen Klassen und ist demnach vordergründig nicht Mittel der Nahrungsbeschaffung, sondern Statussymbol und Ausdruck von Macht, Reichtum und sozialem Rang. So war die Jagd des „Königwildes“, der Hirsche und Wildschweine, ausschließlich dem Hochadel vorbehalten, während die Jagd auf sogenanntes Niederwild zur Nahrungsbeschaffung auch dem sogenannten einfachen Volk möglich war. Die Jagd auf bestimmte Tierarten wurde somit zum Mittel, Überlegenheit, Macht und Einfluss zu demonstrieren. Große Jagdgesellschaften zeigten dies mit aufwendiger Kleidung und Prunk, Luxus und Überlegenheit und noch heute gilt beispielweise die Jagd auf die „Big Five“ Afrikas, das sind Elefanten, Nashörner, Wasserbüffel, Löwen und Leoparden, als Privileg der Reichen und Adeligen.
In Tirol war der Zugang zu Wäldern und deren Nutzung sowie die Jagd auf darin lebende Wildtiere schon seit dem Mittelalter und in der frühen Neuzeit mit den sogenannten „Tiroler Landesordnungen“ streng reguliert worden. Und auch in vielen anderen europäischen Ländern gab es bereits sehr früh Jagdgesetze, die der Oberschicht Jagdrechte zusprachen. Die einfache Bevölkerung wurde für unerlaubtes Jagen streng bestraft. Der sogenannte „Wildfrevel“ galt als direkter Angriff auf den Stand des Adels. Dieser wiederum bildete erfolgreiche Jagden auf Hirsche oder Bären und Wölfe auf Wappen und in Kunstwerken ab. So auch auf dem Kachelofen im Volkskunstmuseum. Hirsch- und Rehgeweihe, Gamshörner und Bärenfelle in Schlössern und Jagdhütten dienten als Trophäen, die an erfolgreiche Jagdausflüge erinnern sollten und Jagderfolg sowie Status hervorhoben (Pamer, Maier, 2023). In vielen aristokratischen Kreisen existieren noch heute Jagdgesellschaften, denen am Erhalt selbst gewählter Traditionen und Werte gelegen ist. Und oft wird die Jagd oder die zur Schaustellung von Jagderfolg mit gesellschaftlichen Anlässen verbunden. So dient das Jagen heute nicht zuletzt auch als Plattform für Geschäftsleute und politische Akteur_innen, die im elitären Rahmen ihre gesellschaftliche Stellung aushandeln und Netzwerke pflegen.
Gedanken zu den Verhältnissen der verschiedenen Gattungen untereinander und zueinander
Die Kacheln des im Tiroler Volkskunstmuseum ausgestellten Ofens aus dem 16. Jahrhundert regen dazu an, über die dargestellte Beziehung zwischen Hund, Hirsch und Mensch nachzudenken. Offenbar wird eine Hierarchie zwischen den Gattungen dargestellt. Der Hund nimmt dabei eine zentrale Rolle als Bindeglied zwischen Menschen und Beute ein. In Jagdbüchern wie dem „Maximilianischen Jagdbuch“ werden Hunde als unentbehrliche Jagdhelfer beschrieben, deren Erfolg maßgeblich von der Loyalität und der Disziplin der Hunde abhänge (Maximilianisches Jagdbuch, 1598). Der Hund wird also als Diener des Jägers gezeigt, der den Hirsch aufspüren und treiben soll. Das heißt, er unterliegt der menschlichen Kontrolle und zeichnet sich durch tierlichen Gehorsam aus. Oder mit anderen Worten: Der abgebildete Jagdhund steht (auch) für die Fähigkeit des Menschen, sich die Natur untertan zu machen. Dem gegenüber wird der Hirsch als Beute gezeigt. Er repräsentiert in den Jagdszenen Wildheit, Anmut und Freiheit, wird aber zugleich in eine Position der Verletzbarkeit gedrängt. Während er zugleich als unbezwingbar gilt, wird er durch die gezielte Jagd des Menschen zu einem Symbol für die Überlegenheit der menschlichen Zivilisation über die Wildnis. An der Spitze der Hierarchie steht demgemäß der Jäger als Herrscher über wilde und domestizierte Tiere. Es ist – so zeigen die Kacheln - der menschliche Jäger, den über den Ausgang der Jagd bestimmt. Das verdeutlicht das – idealisierte – dominierende Verhältnis des Menschen über die Natur und die Tiere. In dieser Lesart dienen Jagdmotive als Metapher für die menschliche Kontrolle über Naturgeschehnisse – was eine moderne Interpretation aus unserer zeitgenössischen Perspektive ist.

Abbildung 4: Detailausschnitt Kachelofen im Tiroler Volkskunstmuseum, eigene Aufnahme Marilena Buchauer und Sara Knollenberger 2025
Jagd als Tiernutzung
In der Vergangenheit war Jagd zu Zwecken der Nahrungsbeschaffung aber oft auch subsistenzsichernd und hierzu zählen dann auch die Fallenjagd oder der Vogelfang mit Netzen. Weniger prestigereich wurden dann auch fast alle Teile eines erlegten Tieres zur Ernährung und als Material für die Weiterverarbeitung zu Alltagsdingen und Kunstgegenständen verwendet. Sodass die tierlichen Körper vollumfänglich als Ressourcen genutzt werden konnten. Fleisch und Innereien wurden durch Räuchern, Trocknen und Einsalzen konserviert und für die menschliche Ernährung haltbar gemacht. Felle und Häute wurden gegerbt, um sie beständig zu machen und für die Herstellung von Kleidung, Schuhen, Zelten und Decken zu verwenden. Knochen und Geweihe wurden zu Werkzeugen wie Nadeln, Messergriffe oder Pfeilspitzen verarbeitet. Außerdem dienten die Hartteile wie die Hufe, Klauen und Krallen auch als Material für Musikinstrumente und für die Herstellung von Schmuck. Die Fette wie beispielsweise Murmeltierfett wurden als Heilmittel oder auch als Lampenöl, für die Herstellung von Seifen und Schmiermitteln herangezogen. Aus den Därmen wurden Wursthüllen und Hörner – wie auch Rinderhörner – wurden als Behälter genutzt, zu Knöpfen oder Alltagsdingen wie Löffel oder auch Bestandteilen von Waffen weiterverarbeitet. Auch die Sehnen dienten unter anderem bei der Bogenherstellung und allgemein zum Binden. Die zeitgenössische Nutzung der gejagten tierlichen Körper und daraus geschöpfter Materialien hat sich im Laufe des 21. Jahrhunderts stark verändert. Die zuvor umfängliche Nutzung wurde stark eingeschränkt. Das sogenannte Wildfleisch hat einen hohen Stellenwert – es gilt in vielen Regionen und angesichts tierethischer Bedenken gegen die agrarische Tierhaltung als Delikatesse. Allerdings beschränkt sich dies auf die wenigen Tierarten, die in der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Einteilung als Hochwild galten. In geringem Umfang werden Felle und Häute immer noch zur Herstellung von Kleidung oder Dekoration verwendet, ein Großteil des tierlichen Materials wird heute aber ungenutzt und als Nebenprodukt der Waldpflege entsorgt. Einzig Geweihe und Schädel außergewöhnlicher Tierindividuen werden als Trophäen behalten oder als Dekorations- und Prestigegüter gehandelt. Zunehmend werden Stimmen laut, die einen nachhaltigen Ansatz der Nutzung tierlicher Materialien fordern. Sie rufen Projekte ins Leben, die ältere Techniken der Verwertung aufgreifen, um Ressourcen zu schonen und Abfälle zu minimieren. So lassen die Jagdmotive auf den Ofenkacheln nicht zuletzt auch eine Industrialisierungsgeschichte erzählen, in der die Jagd sich von der Subsistenzstrategie zum kostspieligen Hobby entwickelt, das von zunehmendem Komfort, sich spezialisierender Technologie und ethischen Diskussionen flankiert wird (Wutzke, 2015).
Jagd in der heutigen Zeit – noch aktuell und vertretbar?
Die Jagd, insbesondere die sogenannte Hochwildjagd ist auch heute noch teuer, gesetzlich reglementiert und erfordert in Tirol eine spezielle Ausbildung mit abschließender Prüfung zum Jagdschein und eine gültige Jagderlaubnis – die jährlich zu verlängernde Jagdkarte. Damit ist die Jagd prinzipiell allgemein zugänglich, aber der tatsächliche Zugang oft allein schon durch die Landbesitzverhältnisse erschwert. Die meisten Jagdreviere im Bundesland Tirol finden sich in Privat- oder Gemeinschaftsbesitz oder im Besitz der Bundesforste. Kritiker_innen argumentieren, dass die Jagd das Ökosystem in den Wäldern stört und das Wohlergehen der davon betroffenen Tiere gefährdet. Umweltverbände fordern etwa ein Jagdverbot für gefährdete Arten, kürzere Jagdzeiten sowie ein Verbot für die Verwendung von giftiger Bleimunition. Dabei geraten auch Berufsjäger_innen, deren Aufgabe es ist, die jeweiligen Wildbestände zu kontrollieren, aufgrund mangelnden Wildbestandmanagements in Kritik. Jedoch ist auch anzuerkennen, dass die Jagd, bei verantwortungsvoller Ausführung, einen Beitrag zum Erhalt ökologischer Gleichgewichte leisten kann. So weist etwa der Tiroler Jägerverband auf die verantwortungsvolle Rolle der Jagd hin, insbesondere im Hinblick auf den Schutz und die Regulation heimischer Wildtierbestände (Larcher, Tiroler Jägerverband).Dass Jagd hoch emotionale Debatten hervorruft, wurde zuletzt beim sogenannten Tuberkulose-Skandal im Frühjahr 2025 im Bregenzerwald in Vorarlberg deutlich. Über 100 landwirtschaftliche genutzte Rinder wurden aufgrund einer Tuberkuloseerkrankung notgeschlachtet oder zur Eindämmung der Ausbreitung der Krankheit vorbeugend gekeult. Da die Krankheitsübertragung vermutlich während der Alm- und Weidesaison durch Hirsche erfolgte, wurden Vorwürfe gegen die Jägerschaft erhoben und der eventuell zu steigernde Abschuss der übertragenden Tiere debattiert (Trummer, 2025).
Historische Artefakte wie der Kachelofen aus Kufstein dokumentieren die Bedeutung vergangener Jagdpraktiken. Eine zeitgemäße Auseinandersetzung in der Gegenwart muss wohl eine Balance zwischenetablierten Formen der Jagdausübung, ökologischer Verantwortung und menschlich-tierlicher Fairness finden.
Literaturquellen
Leib, Sarah: Mittelalterliche und frühneuzeitliche reliefverzierte Ofenkacheln aus Tirol und Vorarlberg – unter Berücksichtigung handwerklicher, produktionstechnischer, soziokultureller und ikonografischer Aspekte. Dissertation, Universität Innsbruck, 2013.
Leib, Sarah: Bildprogramm mittelalterlicher und frühneuzeitlicher Ofenkacheln aus Tirol und Vorarlberg in ihrem sozialen Kontext. In: Atrium Jahresbericht 2010, Innsbruck 2011, S. 33.
Brassat, Wolfgang: Die Jagd als Bildmotiv. Ikonographische Studien zur europäischen Jagdgeschichte. München 2009, S. 112–115.
Delumeau, Jean: Kulturgeschichte des Mittelalters und der Renaissance. München 1980, S. 198–223.
Maximilianisches Jagdbuch: Eine Sammlung historischer Jagdszenen aus der frühen Neuzeit. Augsburg 1598, S. 67–102.
Pamer, Tobias; Maier, Andreas: Der Wald als Rechtsraum in der Grafschaft Tirol. Vom (fast) unbeschränkt nutzbaren Gut des Mittelalters zur streng regulierten Ressource der frühen Neuzeit. Universität Innsbruck.
Onlinequellen
Wutzke, Antje: Eine kurze Geschichte der Jagd. 2015. Online unter: https://wildeswissen.de/2015/08/21/eine-kurze-geschichte-der-jagd/ (Stand: 19.02.2025).
Larch, Anton: Verantwortung für Wild, Wald und Natur!. In: Tiroler Jägerverband. Online unter: https://www.tjv.at/tiroler-jaegerverband/leitbild/ (Stand: 01.07.2025)
Trummer, Nicolas: Tuberkulose: 107 Rinder gekeult. In: Landwirt Media, 2025. Online unter: https://landwirt-media.com/tuberkulose-107-rinder-gekeult/ (Stand: 17.02.2025).

Handtuchhalter Vanitas im Tiroler Volkskunstmuseum (Fotograf: Johannes Plattner 2017)
Leben und Tod im Schlangenmotiv
Der Handtuchhalter aus dem 17. Jahrhundert (um 1675) zeigt ein sogenanntes Vanitasmotiv (siehe Abbildung 1). Die Frauendarstellung ist zweigeteilt: Eine Seite zeigt eine wohlhabende junge Frau – vielleicht eine Prinzessin – in bunten, reich verzierten Gewändern, gekrönt und mit einer Perlenhalskette. Sie versinnbildlicht Vitalität, Reichtum und Schönheit. Im Kontrast dazu wird auf der anderen Seite das Skelett der Figur gezeigt, ein Totenschädel, die Halswirbel und der Brustkorb mit Rippen und einem knöchernen Arm mit fleischloser Hand. Die Perlenkette der „lebendigen“ Seite verwandelt sich auf den Rippenknochen zu einer Schlange, die sich um den beinernen Oberarm windet.
Der Handtuchhalter stammt aus der Weiherburg bei Innsbruck, die bereits im 15. Jahrhundert als Ansitz für Adelige in Nähe der damaligen landfürstlichen Residenzstadt erbaut wurde und 1490 in den Besitz Kaiser Maximilians (1459–1519) kam. Erzherzog Ferdinand II. (1529–1595) ließ dann dort einen Tiergarten anlegen. Nach mehreren Besitzwechseln ging die Weiherburg 1911 an die Stadt Innsbruck. Heute findet sich dort der Alpenzoo und in der Weiherburg wird seit 2021 eine Ausstellung der Tiroler Landesmuseen gezeigt. Der Handtuchhalter hingegen wurde bereits um das Jahr 1675 gestaltet und stammt demgemäß wohl aus adeligem Besitz – wird derzeit aber in der Ausstellung „Das prekäre Leben“ im Tiroler Volkskunstmuseum gezeigt. Er wurde aus Zirbenholz gefertigt und bemalt. Die Gestaltung zeugt von handwerklichem Geschick, aber auch von den ästhetischen Vorstellungen der Entstehungszeit (Kammel 2002, S. 16).
Schönheit und Vergänglichkeit
Das frühneuzeitliche Alltagsobjekt verbindet das Bildnis einer jungen Frau und deren entfleischtes Skelett und genau dieses enge Nebeneinander von jugendlicher Schönheit und Erinnerung an Tod und Sterblichkeit sind heute ungewöhnlich. Der Handtuchhalter zeigt ein Vanitasmotiv und entstammt der Barockzeit, die in Tirol um 1600 einsetzte. Diese Zeit – in der auch zahlreiche Kirchenbauten barockisiert wurden – war über Tirol hinaus geprägt vom 30-Jährigen Krieg und wiederkehrenden Pestjahren. Das Vanitasmotiv und Kunstwerke wie der Handtuchhalter deuten an, dass der Alltag und wohl auch die Gedanken der damaligen Menschen stark vom engen Nebeneinander von Leben und Tod beeinflusst waren. Die Kunstwerke erscheinen als Spiegelbild der tiefsten menschlichen Ängste und Hoffnungen.
Schlangen, Perlenketten und Seifenblasen

Abbildung 2: Vanitas Still Life #3. Edwaert Collier. Fine Art America, 2017. [Online unter: https://fineartamerica.com/featured/3-vanitas-still-life-edwaert-collier.html]
Die Perlenkette um den Hals der dargestellten jungen Frau geht auf der knöchernen Körperhälfte der Figur in eine Schlange über. Vielleicht kann das als Anspielung auf den Sündenfall in der Genesis gedeutet werden. Oder ist es ein Gewissensbiss, der durch das nahegelegene Maul der Schlange am Herzen symbolisiert wird? Schlangenmotive und auch Perlenketten waren jedenfalls bekannte Themen der allegorischen Bildsymboliken und damit Teil der verbreiteten Stilmittel im Barock. Allegorien ermöglichen es, komplexe Konzepte wie Leben und Tod bildlich darzustellen. Dazu zählen für die zeitgenössischen Vanitasdarstellungen auch Seifenblasen, neben Totenschädeln oder erloschenen Kerzen. All das soll die Vergänglichkeit des Lebens verdeutlichen und daran erinnern, dass Freude und Glück oft nur von kurzer Dauer sind (Benthien 2018, S. 178). Dies interpretierten die Menschen im Zeitalter des Barocks als trostspendend. Denn die damaligen Gesellschaften litten unter Krieg, Krankheiten und großer sozialer Ungerechtigkeit. Mit der Erkenntnis, dass jeder einmal sterben werde und Schönheit, Reichtum sowie Macht vergänglich sind, verband sich ein tröstendes Gefühl im Rahmen der damaligen Jenseitsorientierung. Heute und in säkularisierten Zusammenhängen erinnern die historischen Vanitasdarstellungen hingegen eher daran, das Leben als kostbare Zeit im Diesseits zu begreifen.
Totenschädel und Schlangentattoos heute
Abbildung 3: Tattoo mit schwarzem Totenkopf und farbiger Schlange. Artist: skullspiration_com. BARB Beauty-Behandlungen, 2024. [Online unter: https://barb.pro/de/blog/snake-tattoo]

Die Kombination aus Schlange und Totenschädel ist heute ein weitverbreitetes Motiv für Tattoos, das eine kraftvolle Symbolik in Bezug auf Leben, Tod und Transformation miteinander verbindet (Danilovich, 2024). Gegenwärtig symbolisieren diese Darstellungen vor allem den Kreislauf von Leben und Tod sowie den Konflikt zwischen Gut und Böse (Rees, 2021). Dabei werden die Schlagen als Teil der Bildmotive stets lebendig dargestellt und sollen so verdeutlichen, dass das Leben in Zyklen verläuft und aus dem Tod neues Leben hervorgehen kann. Zudem stehen Schlangentattoos mit Totenschädeln wie die früheren Vanitasdarstellungen noch immer in engem Zusammenhang mit dem Konzept des „Memento Mori“ – der Erinnerung daran, sterblich zu sein. Dies wurde siegreichen Heerführern im antiken Rom als Mahnung während eines Triumphzuges mitgegeben und auch spätere Machtausübende sollten immer wieder daran erinnert werden, dass auch sie einmal sterben würden.
Reale Schlangen als Opfer der Tiersymbolik?
Schlangen werden heute häufig mit negativen Eigenschaften wie Eifersucht, Verrat oder Hinterlist assoziiert. Dem war jedoch nicht immer so: Etwa die ägyptische Mythologie erzählt von einem Schlangenwesen – Uroboros, das alles geschaffen habe und zusammenhalte. In der chinesischen Astrologie verheißt das Jahr der Schlange Intuition, Ehrgeiz, Charme und Klugheit, aber auch Eifersucht und Eitelkeit. In der christlich-biblischen Erzählung erlangte die Schlange einen schlechten Ruf. Das zeigt, dass Tieren allgemein und hier Schlangen im Besonderen menschliche Eigenschaften, Motivationen und soziale Rollen zugeschrieben werden. In Kinderbüchern sprechen Katzen und Hunde, in Hollywood-Blockbustern werden Haie zu Monstern und Schlangen erscheinen seit dem biblischen Ursprungsmythos als schlau, aber hinterlistig, mitunter sogar böse. Tieren in Erzählungen, Märchen und Fabeln menschliche Züge zuzuschreiben – sie zu anthropomorphisieren, also menschenähnlich oder menschenförmig zu erzählen – hat reale Konsequenzen für die davon betroffenen Tiere. Denn kulturelle Ideen, Geschichten und Vorstellungen beeinflussen das Verhalten von Menschen. Während es in Österreich eher selten Begegnungen mit realen Schlangen gibt, werden Schlangenprodukte global gehandelt. Von 2008 bis 2017 wurden etwa 3,2 Millionen Pythonhäute und 1 Million Hautstücke aus Südostasien nach Europa importiert. Die meisten für die Luxusindustrie verwendeten Schlangen werden in ihren natürlichen Habitaten gefangen. Sogenannte Wildfänge sind billiger, als die regulierte Haltung und Zucht. Die Schlangen werden aus ihrem Lebensraum entnommen, in Schlachthäuser gebracht und sollen mit einem Schlag auf den Kopf – um ihre Häute nicht zu beschädigen – getötet werden. Tierschutzorganisationen klagen an, dass diese Tötungsmethoden oftmals nicht wirkungsvoll sind und die Schlangen ihre Häutung deshalb lebend – vielleicht bei vollem Bewusstsein – erfahren. Sie werden am Kopf aufgehängt, und ihre Körper werden mit Wasser gefüllt, da die gestraffte Haut besser abzuziehen ist (Pro Wildlife, 2017). Es ist davon auszugehen, dass die kulturelle Unterscheidung zwischen Menschen und nichtmenschlichen Tieren zu einer Hierarchisierung führt, die derartige Praktiken – allem Anschein nach – legitimiert. Unter anderem in der christlich-westlichen Philosophie ging man lange Zeit von einem wesentlichen Unterschied zwischen Menschen und allen anderen Tieren aus. Und Philosophen wie etwa Friedrich Nietzsche (1844–1900) deuten das menschliche Bewusstsein der eigenen Sterblichkeit als ein solches Unterscheidungsmerkmal (Klein Willnik, 2017). Wie das Vanitasmotiv und die „Memento Mori“ Mahnungen aber verdeutlichen, galt es dieses Bewusstsein offenbar auch erst einmal zu etablieren.
Falsche Schlangen
Sprichwörter und Redewendungen wie „Du falsche Schlange“, „so eine Giftschlange“ oder „die Schlange am Busen nähren“ beschreiben oftmals hinterlistige oder gehässige Frauenfiguren, denen man lieber nicht näherkomme, weil sie sich als verräterisch oder undankbar entpuppen (Märchenatlas, 2025). Das spiegelt und tradiert stereotype Bilder in denen sich die zugeschriebenen Eigenschaften vermischen und gegenseitig verstärken: Frauen seien so wie falsche Schlangen, Schlangen so wie heimtückische Frauen. Denn wenn wir sprechen, stellen wir das, worüber wir sprechen, gleichzeitig her. Das heißt, wenn wir einen Menschen als Frau bezeichnen, wird dieser Mensch in unserem Ansehen zu einer Frau. Und wir assoziieren das, was wir mit der Sozialfigur Frau verbinden, mit diesem Menschen. Sprachliche Mittel wie Metaphern und Bildsprache tragen also zur Identifizierung und Unterscheidung bei. Dafür werden Bedeutungen auch aus anderen Kontexten, wie etwa dem Sprechen über Natur oder nichtmenschliche Tiere entlehnt. Und damit werden dann auch Bewertungen und klischeehaftes Wissen auf die neuen Kontexte – hier auf die vergeschlechtliche Kategorie Frau projiziert. Wenn Frauen sprachlich mit Schlangen verglichen und die beiden Figuren miteinander verbunden werden, ist das also kein neutraler Akt. Die Bedeutungsübertragungen in Redewendungen verfestigen bestimmte – abwertende – Vorstellungen über Frauen und Schlangen, die auf reale Betroffene wirken. Doch Metaphern und Bedeutungen sind keine fixen Wahrheiten, sondern historisch gewachsene, kulturelle Ideen. Damit sind sie nicht nur einer kulturwissenschaftlichen Analyse zugänglich, sondern auch veränderlich.
Literatur
Benthien, Claudia: Aufzeichnung von Vergänglichkeit. Koen Theys’ Videoinstallation The Vanitas Record als ‚spektakuläres’ Stillleben. In: Paragrana, 27 (2018), H.2. Online unter: https://doi.org/10.1515/para-2018-0043 (Stand: 23.02.2025).
Kammel, Frank M.: Dem Tod ins Auge geschaut. Vergänglichkeit als Thema barocker Kleinbildwerke. In: Laue, Georg (Hg.): Memento Mori. München 2002, 6-31.
Klein Willink, Ivo: Nietzsche und die Verachtung des Leibes. Eine Analyse zur vierten Rede von Nietzsches "Also sprach Zarathustra". Nijmegen 2017, 14.
Michel, Paul: Tiersymbolik. Bern 1991.
Schmitt, Rudolf: Metaphernanalyse und die Konstruktion von Geschlecht. In: Forum: Qualitative Sozialforschung, 10 (2009), H. 4.
Internetquellen
Danilovich, Julia. „52 aussagekräftige Schlangen-Tattoo-Designs für Männer und Frauen“. Barb Beauty-Behandlungen. Online unter: https://barb.pro/de/blog/snake-tattoo (Stand: 20.02.2025)
Duden Lernattack GmbH Lernhelfer. „Das Vanitasmotiv im Barock“. Online unter: https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/deutsch-abitur/artikel/das-vanitasmotiv-im-barock (Stand: 15.02.2025)
Märchenatlas: Tiere im Märchen. Die Schlange in Sprichwörtern und Redensarten. Online unter: https://www.maerchenatlas.de/miszellaneen/marchenfiguren/die-schlange-im-maerchen (Stand: 20.02.2025)
Pro Wildlife: Reptilleder. Ein grausamer Luxus. Online unter: https://www.prowildlife.de/aktuelles/hintergrund/reptilleder (Stand: 20.02.2025)
Rees, Prisca-Vanessa. „Schlangen-Tattoo: Bedeutung und was hinter dem Trend steckt“. FOCUS online. Online unter: https://praxistipps.focus.de/schlangen-tattoo-bedeutung-und-was-hinter-dem-trend-steckt_130782 (Stand: 24.02.2025)

Personenschlitten Lechmuseum, ausgestellt in: Spuren. Die Ausstellung zur Skikultur, vom 24. Juni 2018 bis 28. April 2019, Huber Hus, Lech
Pferdestärken

Abb. 1: Lech am Arlberg, ÖNB Digital: http://data.onb.ac.at/AKON/AK028_579. Gelaufen 1934, abgerufen 26.11.2025
Einst und noch bis ins 21. Jahrhundert waren Pferdeschlitten und Fuhrwerke unverzichtbar für die Menschen am Arlberg. Heute steht dieser Schlitten mit Klappverdeck im Lechmuseum und lässt Geschichten über die lokale Vergangenheit erzählen, aber auch über menschliche Beziehungen zu Pferden und deren Wandel im Laufe Zeit.
In den Alpen galten Pferde, neben Rindern, lange als unverzichtbare Arbeits- und Transportkräfte. Sie zogen Schlitten und Kutschen, brachten Waren und Menschen ans Ziel und waren notwendig für die Besorgungen des täglichen Lebens. Schon seit deren Domestizierung setzten Menschen bestimmte Tiere gezielt für Arbeiten ein, die ihren Alltag erleichtern oder ihren Lebensunterhalt sichern sollten (Petrus 2015: 38). Aber besonders Pferde und ihr Vermögen, auf steilen Wegen Transporte zu leisten, spielte für den Wintertourismus in Lech und dem Nachbarort Zürs eine Schlüsselrolle. Ohne Pferdeschlitten wären Gäste kaum in die abgelegenen Orte am Arlberg gelangt, als es noch weder Busse noch Skilifte gab. Der hier gezeigte Schlitten steht symbolisch für die engen Verbindungen, die dafür zwischen Menschen und Pferden notwendig waren und für eine Zeit, in der Pferdestärken den Alpentourismus erst möglich machten.
Transportgeschichte – das Pferd als Arbeitskraft
Im 19. Jahrhundert war das Leben der Menschen in Lech und Zürs von Knappheit, Armut, agrarischer Subsistenzwirtschaft und dem Säumerwesen geprägt. Die Wege über den Arlberg, als wichtigste Ost-West-Verbindung zwischen Tirol und Vorarlberg, waren unsicher und beständig von Muren, Felsstürzen und anderen alpinen Gefahren wie raschen Wetterwechseln und Unwettern oder Kälte- und Wintereinbrüchen bedroht. Weite Strecken konnten nur zu Fuß zurückgelegt werden. Die Menschen in den Höhenlagen lebten von der Viehzucht und der Milchwirtschaft sowie dem Verkauf von Tieren, Käse und Butter. Sie mussten die Waren in tiefer gelegene Täler und deren Hauptorte bringen, um dort Mehl, Getreide, Zucker und die wichtigsten Alltagsgüter einzutauschen oder zu kaufen. Alles wurde mühsam transportiert – oft mit Pferden und Kutschen oder Schlitten. Mit der Eröffnung der Arlbergbahn 1884 wurde der Flexenpass zwischen Warth, Lech und Zürs und dem Klostertal mit Stuben und dem Bahnhof in Langen immer wichtiger. Die Straße wurde zunehmend ausgebaut, ein Teilabschnitt bereits 1897 fertiggestellt, die Anbindung ins Tiroler Lechtal 1909 eröffnet. Auf der Vorarlberger Seite gab es eine Verbindung zum Bahnhof Langen – eine Lebensader für die Region. Nicht nur Waren wurden transportiert, sondern auch die ersten Tourist_innen kamen mit der Bahn bis in die Berge. Doch die Route blieb gefährlich und vor allem der letzte Streckenabschnitt bis in die Bergdörfer mit Lawinen im Winter und Steinschlägen im Sommer war gefürchtet. Immer wieder gab es Verletzte und sogar Tote. Trotzdem wurde der Gästetransport für die Einheimischen zu einer wichtigen Einnahmequelle. Ein Pferd zog den Schlitten, zwei Gäste fanden Platz, dazu konnte das Gepäck verstaut werden. Im Winter 1938/39 erreichte dieses Transportwesen seinen Höhepunkt: Rund 70 Pferde waren in Lech für den Gästetransport im Einsatz. Das zeigt, wie zentral die Pferde für den touristischen Aufschwung in der Region waren. Während Menschen Tiere seit Jahrtausenden für schwere Arbeiten nutzen und damit ihr Leben zu erleichtern trachten (Petrus 2015, 38), wäre auch der Beginn des Wintertourismus in Lech ohne Pferde kaum möglich gewesen.

Abb. 2: Flexenstraße. Gemeindearchiv Lech. Nachlass Paul Weczera. Postkarte Ritsch-Lau. AA-3278.
Tourismusgeschichte – Das Pferd als Schlüssel zum wirtschaftlichen Erfolg
In der nun breit aufkommenden Bergbegeisterung mit dem beginnenden Winter- und Skitourismus – der geprägt war von der verkehrstechnischen Erschließung der Alpen durch Eisenbahn und Straßenbau – waren Pferde für die letzten Wege hin zu den hochgelegenen Orten in der Region unersetzlich. Ohne sie wäre es unmöglich gewesen, die wachsende Zahl an Gästen über den hochgelegenen Flexenpass mit seinen steilen Abgründen und engen Kurven nach Lech zu bringen. Es gab weder Busse noch Taxis und keine Seilbahnen, die die Strecke hätten bewältigen können – nur Fußmärsche oder Pferdeschlitten. Die Leute in Lech erkannten schnell, welche Chance sich ihnen bot. Ihre Pferde und Schlitten wurden fortan nicht mehr nur für den eigenen Bedarf und Warentransport ins Tal genutzt, sondern auch für den lukrativen Gästetransport in die Bergdörfer. Wer Pferde besaß, konnte also gutes Geld verdienen und mit dem Erfolg des Wintertourismus veränderte sich die ganze Region. Immer mehr Gäste kamen, und damit stieg auch der Bedarf an Unterkünften. Viele Familien richteten dafür sogenannte „Fremdenzimmer“ ein und bald entstanden größere Hotels oder bestehende Unterkünfte wurden ausgebaut, um den steigenden Ansprüchen gerecht zu werden.

Abb. 3: Pferdeschlitten vor dem Tannbergerhof. Gemeindearchiv Lech, Nachlass Anton Mathis AA-1827.
Aufbruch in die Moderne – Abschied vom Pferd
Die Fahrt mit den Pferdeschlitten im Winter erforderte eine durchgehend schneebedeckte Fahrbahn. Das machte die Wege aber für andere Transportmittel schwierig oder gar nicht mehr passierbar. Deshalb entwickelte sich der Arlberg nach dem Zweiten Weltkrieg auch zu einem Versuchsfeld für maschinelle Schneeräumungsgeräte. Einen entscheidenden Wendepunkt markiert der Winter 1950/51: Erstmals war es mit der neu auf den Markt gekommenen Mercedes-Unimog-Schneefräse möglich, die gesamte Strecke über den Flexenpass – von Langen nach Lech – schneefrei zu halten. Das aber bedeutete das Ende der Pferdeschlitten, an deren Stelle fortan Postomnibusse und Taxis traten. Und dieser Übergang verlief nicht ohne Konflikte. Es gab Vorbehalte der lokalen Bevölkerung und berechtigte Ängste um das Einkommen aus dem Pferdetransportwesen. Der technologische Fortschritt, der einerseits Mobilität, Komfort und nicht zuletzt weiter steigende Gästezahlen brachte, bedeutete für die einheimischen Fuhrleute dann tatsächlich auch oft das Ende einer einträglichen Erwerbsquelle.

Abb. 4: Taxi und Schlitten in Zürs. Gemeindearchiv Lech, Sammlung Sauerwein, AA-5401.
Gleichzeitig bot der Wandel aber auch Chancen. Einige erkannten das Potenzial der neuen Technik und gründeten die Taxizentrale in Lech, die es heute noch gibt. Damit wurden dann zwar die Pferde von Autos abgelöst, die Fuhrleute konnten jedoch ihre Rolle im Personenverkehr bewahren. Allerdings erfolgte mit dem Umstieg von einer Pferdestärke auf viele PS auch der Einstieg in eine neue, auf petrochemischer Industrie aufbauender Energieversorgung. Wo zuvor in einem lokalen, agrarischen Kreislauf Pferde gehalten wurden, mussten die Personen- und Lastkraftwagen fortan mit erdölbasierten Treibstoffen getankt werden. Die Pferde verschwanden damit allmählich aus dem Alltag der Menschen in Lech und Zürs. Es endete ihre Rolle als unverzichtbare Arbeitskraft. Damit wurden dann auch die Beziehungen zwischen den Menschen und ihren Pferden neu definiert.
Blick auf heute – Das Pferd als Symbol alpiner Tradition und kulturelles Erbe
Wenn heute museale Objekte wie der hier gezeigte Pferdeschlitten aus dem Lechmuseum an diese Epoche erinnern, dann verweisen sie auf das Ende des „Pferdezeitalters“. Damit habe sich, wie der Historiker Reinhart Koselleck beschreibt, der menschliche Blick auf das Pferd als kulturelles Symbol und Figur, aber auch der Umgang mit realen Pferden maßgeblich verändert. Waren Menschen zuvor von Pferden und deren Leistungsvermögen abhängig, um das wirtschaftliche Überleben in den alpinen Regionen zu sichern, setzte dort spätestens gegen Mitte des 21. Jahrhunderts, an anderen Orten schon bedeutend früher, ein kultureller Wandel ein. Pferde und ihre Anwesenheit in dörflichen Zusammenhängen wurden der Alltäglichkeit enthoben. Heute sind Pferde und Pferdebesitz Symbole für Luxus und hochpreisige Freizeitangebote. Von Arbeits- und Reittieren vor allem für Männer in agrarischen und militärischen Zusammenhängen sind sie zur Hauptbesetzung in der medialen Inszenierung idyllischer Ponyhof-Romantik und mithin zu Mädchenträumen geworden. Im hier gezeigten Beispiel gelten Pferde aber auch als Teil „alpiner Tradition“ und „kulturellen Erbes“. Diesen in Erinnerung zu bewahren, werden heute beispielsweise Kutschfahrten im Stil der alten Pferdeschlitten als touristisches Angebot fortgeführt. In Lech gibt es dafür ein „2 PS-Familienunternehmen“, für das sogenannte Noriker Pferde gehalten und eingesetzt werden. Während Pferde also einst den Alltag prägten, sind sie heute vor allem Symbolträger – für Tradition, Nostalgie und ein Stück alpinen Kulturerbes. Dabei lässt der Pferdeschlitten aus dem Lechmuseum auf eine mit menschlichem Geschick eng verflochtene Pferdegeschichte schließen. Wiewohl aber die Menschen und Pferde über lange Zeit hinweg in hochalpinen Orten mit- und voneinander lebten, wird auch deutlich, dass die „im Rahmen der (gemeinsam) geleisteten Arbeitstätigkeit“ gelebte „soziale Beziehung“ asymmetrisch war und so „bedeutet dies noch nicht, dass beide gleichgestellt [gewesen] wären“ (Petrus 2015: 40).
Literatur
Heinrich, Birgit; Gärtner, Monika. Spuren. Die Ausstellung zur Skikultur im Lechmuseum. In: Tiroler Heimatblätter. 94. Jahrgang, Heft 2. 2019, 50 – 55.
Meixner, Wolfgang. Die touristische Erschließung von Lech. In: Ortner, Birgit (Hg.), Gemeindebuch Lech, Lech am Arlberg, 2014, 202 - 235.
Ortner, Birgit. Lech im 19. Jahrhundert. In: Ortner, Birgit (Hg.), Gemeindebuch Lech, Lech am Arlberg, 2014,
86 – 87.
Petrus, Klaus. Arbeit. In: Ferrari, Arianna, Petrus, Klaus (Hg.), Lexikon der Mensch-Tier-Beziehungen: Bielefeld. 2015. 38 – 41.
Schmidgall, Markus. Aufbruch in die Moderne: Die Entwicklung von Lech im 20. Jahrhundert. In: Ortner, Birgit (Hg.), Gemeindebuch Lech, Lech am Arlberg, 2014, 100 – 104.
Sauerwein, Herbert. Schneeräumung und Gästetransport auf der Flexenstraße. Archiv Gemeinde Lech.
Sauerwein, Herbert. 100 Jahre Flexenstraße. Archiv Gemeinde Lech.
Quellen
Homepage: Best of the Alps. Lech. Die Geschichten. Das Zwei-PS-Familienunternehmen.
Online unter: https://www.bestofthealps.com/de/d/lech-zurs-am-arlberg/daniel-kocher-bildhauer-sich-den-dingen-fugen/ (Stand: 30.11.2024).
Homepage: Süddeutsche Zeitung. Jahrhundert der Pferde. Im Galopp von Fritz Göttler. Online unter: https://www.sueddeutsche.de/kultur/jahrhundert-der-pferde-im-galopp-1.2735576 (Stand: 26.01.2025).
Konzeption und Organisation
Dr.in Nadja Neuner-Schatz, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Fach Empirische Kulturwissenschaft an der Universität Innsbruck.
E-Mail: nadja.neuner-schatz@uibk.ac.at
