Viele Sportler*innen nutzen das Höhentraining, um ihre Leistung zu verbessern. Der durch die Höhe verursachte Sauerstoffmangel trägt dazu bei, die Produktion roter Blutkörperchen anzuregen, die für den Transport von Sauerstoff zu den Muskeln im Körper verantwortlich sind. Ab einem bestimmten Punkt wirken diese Vorteile sich jedoch nachteilig aus, da eine zu hohe Anzahl an roten Blutkörperchen das Blut zähflüssig macht, den Widerstand im Kreislauf erhöht, den Blutdruck ansteigen lässt und das Herz dadurch härter arbeiten muss. „Wenn eine ungewöhnlich hohe Anzahl roter Blutkörperchen auch auf Meereshöhe dauerhaft bestehen bleibt, spricht man von der seltenen Krankheit Polyzythämie. Bei Personen, die permanent in großer Höhe leben und aus irgendeinem Grund zu viele rote Blutkörperchen produzieren, nennt man das Syndrom chronische Höhenkrankheit“, erklärt Justin Lawley, Professor für Leistungsphysiologie und Prävention an der Universität Innsbruck. „Diese Patient*innen leiden unter Anzeichen wie hohem Blut- und Lungendruck sowie Durchblutungsstörungen, körperliche Aktivität ist für sie extrem anstrengend“, so Lawley weiter.
Einzigartiges Phänomen in Cerro de Pasco
In der peruanischen Bergbaustadt Cerro de Pasco in den Zentralanden weisen überdurchschnittlich viele Männer eine stark erhöhte Anzahl roter Blutkörperchen auf und leiden damit an der chronischen Höhenkrankheit. Erstaunlich ist, dass frühere Forschungen darauf hindeuten, dass ihre körperliche Leistungsfähigkeit – gemessen an der Sauerstoffaufnahme des Körpers – zumindest in den ersten Jahren der chronischen Höhenkrankheit mit der von gesunden Einwohnern vergleichbar ist. Daraus schließen Lawley und seine Kolleg*innen, dass sich einige Andenbewohner bis zu einem gewissen Grad an das zähflüssige Blut angepasst haben. „Dieses einzigartige Phänomen wurde bisher nur in dieser Bevölkerung in den Anden nachgewiesen. Es zeigt uns, dass ein Überschreiten des optimalen Hämatokrits, mit dem der Anteil an roten Blutkörperchen im Blut gemeint ist, nicht zwangsweise zu einer Belastungsintoleranz führen muss. Mit unseren Untersuchungen wollten wir herausfinden, welche physiologischen Prozesse sich verändert haben, um trotz Polyzythämie eine normale körperliche Leistungsfähigkeit zu ermöglichen“, beschreibt Lawley. Zu diesem Zweck führte das internationale Team, das aus Forscher*innen von mehr als 20 Universitäten weltweit bestand, eine Reihe von Studien mit den Bewohnern von Cerro de Pasco durch, wobei modernste Forschungsmethoden zum Einsatz kamen.
Blutbestandteile und Blutdruck entscheidend
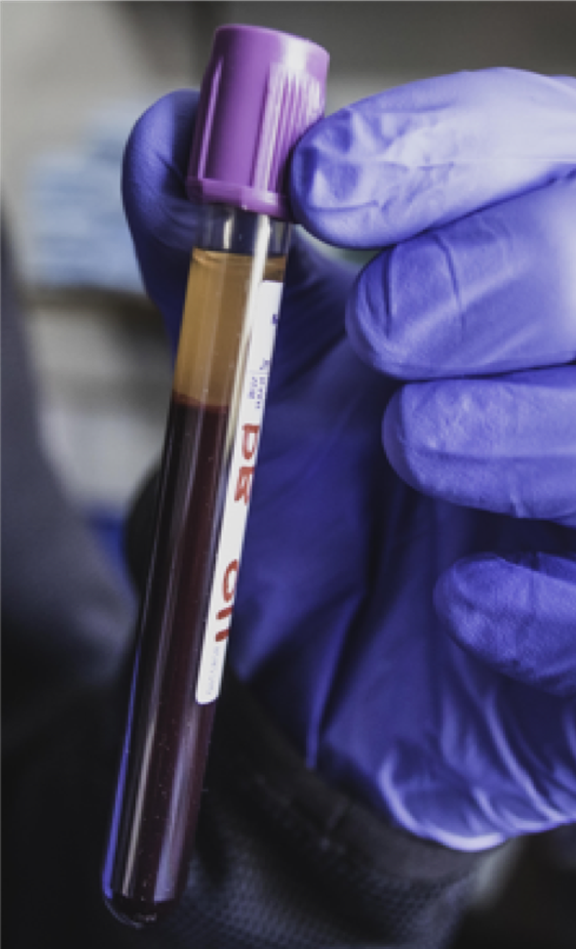
Zunächst untersuchten die Wissenschaftler*innen, wie dick das Blut von Andenbewohnern mit chronischer Höhenkrankheit ist. Dazu entnahmen sie Blutproben, um den Anteil des Plasmas im Blut im Verhältnis zur Anzahl der roten Blutkörperchen zu bestimmen. „Das Ergebnis war für uns überraschend. Jahrzehntelang ging man davon aus, dass der Hauptgrund für die erhöhten Erythrozyten bei der chronischen Höhenkrankheit darin liegt, dass die betroffenen Andenbewohner weniger atmen und ihnen deshalb der Sauerstoff fehlt. Unsere Ergebnisse zeigen jedoch, dass der Anteil des Plasmas sehr gering ist und der Anstieg der Erythrozyten daher möglicherweise ein Ausgleichsmechanismus zur Aufrechterhaltung des Blutvolumens ist. Die hohe Anzahl an roten Blutkörperchen macht das Blut der Betroffenen schließlich dickflüssig“, sagt Lawley. In weiteren Studien wollen die Forscher*innen herausfinden, warum diese Verringerung des Blutplasmas auftritt und ob es dafür einen genetischen Mechanismus gibt. Dazu werden Lawley und sein Team im kommenden Jahr nochmals nach Cerro de Pasco reisen und dann mehrere Monate in der Bergbaustadt verbringen. „Wir wissen, dass das Volumen des Blutplasmas durch regelmäßiges aerobes Training erhöht werden kann. So konnten wir erst kürzlich feststellen, dass der sogenannte „König der Berge“, der tibetische Sherpa, ein sehr großes Plasmavolumen hat, wodurch er den Anteil roter Blutkörperchen vergleichbar mit dem von Flachlandbewohnern halten kann“, berichtet Lawley. Bei ihrem nächsten Forschungsaufenthalt wollen die Wissenschaftler*innen deshalb testen, ob Bewegung eine mögliche Therapie für Patienten ist, die ihre Symptome bisher nur durch die Entfernung von roten Blutkörperchen oder den Abstieg in tiefere Regionen lindern konnten.
Anpassung auf Zeit
Zwar haben die Tests der Forscher*innen gezeigt, dass Andenbewohner, die an einer milden Form der chronischen Höhenkrankheit leiden, diese gut bewältigen können, einige der Tests ergaben jedoch auch beunruhigende Ergebnisse: Bei komplexen Untersuchungen der Gefäßfunktion, bei denen die Forscher*innen Infusionen mit im Sympathikusnerv platzierten Mikroelektroden kombinierten, konnten sie deutliche Unterschiede zwischen gesunden und betroffenen Teilnehmern feststellen: „Obwohl zum Beispiel ihr Blutdruck in Ruhe normal war und sie ohne Probleme Sport treiben konnten, konnten wir sehen, dass ihre Blutgefäße dysfunktional waren und während des Sports sehr stark verengt werden mussten, um den Blutdruck zu halten. Diese Verengung war bei den gesunden Probanden viel geringer“, erklärt Lawley. Diese Ergebnisse zeigen, dass eine physiologische Anpassung an die Krankheit Polyzythämie wahrscheinlich nur bis zu einem gewissen Grad möglich ist. „Je länger eine Person an der Krankheit leidet und je älter sie wird, desto schwieriger wird es wahrscheinlich für den Körper, die Anpassungsmechanismen aufrechtzuerhalten. Die Gefäße werden durch den Alterungsprozess steifer und sind weniger in der Lage, bei Bewegung zu reagieren“, fügt Lawley hinzu. Künftige Tests werden daher auch Menschen mit fortgeschrittener chronischer Höhenkrankheit untersuchen. Außerdem wollen die Forscher*innen herausfinden, wie sich die starke Verschmutzung durch den Bergbau in Cerro de Pasco, einer der am stärksten verschmutzten Städte der Welt, auf die chronische Höhenkrankheit auswirkt. Die Expedition hat bereits zu über 18 peer-reviewten Publikationen geführt, fünf davon mit Beteiligung von Forscher*innen der Universität Innsbruck.
Buch über Medizin und Physiologie in der Höhe: Justin Lawley ist Professor für Leistungsphysiologie und Prävention am Institut für Sportwissenschaft der Universität Innsbruck. Lawleys Forschung konzentriert sich auf die Physiologie der menschlichen Anpassung an Stress (z. B. durch Sport, niedrige Sauerstoffwerte und Temperaturschwankungen oder Schwerelosigkeit) und die Nutzung dieses Wissens zur Verbesserung der menschlichen Gesundheit und Leistung. Im Februar dieses Jahres veröffentlichten er und seine Kollegen die sechste Auflage von Ward, Milledge and Wests High Altitude Medicine and Physiology. Das Buch befasst sich mit einem der Schwerpunkte von Lawleys Forschung, der Physiologie in großen Höhen. Das Buch richtet sich in erster Linie an Sportwissenschaftler*innen mit Kursen in Umweltphysiologie, an Ärzt*innen, die Menschen auf Expeditionen vorbereiten oder sich auf Krankheiten und Unfälle in der Höhe spezialisieren, sowie an Ärzt*innen und Physiolog*innen, die die Abhängigkeit des Menschen von Sauerstoff und die Anpassung des Körpers an die Höhe untersuchen.
Links
- Hansen, A.B., Moralez, G., Amin, S.B., Simspon, L.L., Hofstaetter, F., Anholm, J.D., Gasho, C., Stembridge, M., Dawkins, T.G., Tymko, M.M., Ainslie, P.N., Villafuerte, F., Romero, S.A., Hearon, C.M., Jr and Lawley, J.S. (2021), Global REACH 2018: the adaptive phenotype to life with chronic mountain sickness and polycythaemia. J Physiol. https://doi.org/10.1113/JP281730
- Luks, A.M., Ainslie, P.N., Lawley, J.S., Roach, R.C., & Simonson, T.S. (2021). Ward, Milledge and West's High Altitude Medicine and Physiology (6th ed.). CRC Press. https://doi.org/10.1201/9780429444333
- Institut für Sportwissenschaft

