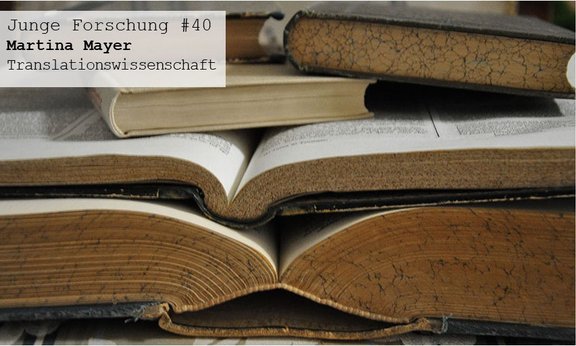Auf der Suche nach dem Österreichbegriff in der Encyclopédie
Enzyklopädische Wörterbücher sind historische Dokumente und geben Aufschluss über den Wissensstand, Interpretation und Wertungen ihrer Zeit. Die Encyclopédie von Denis Diderot (1713-1784) und Jean Le Rond d’Alembert (1717-1783) im Speziellen, als intellektuelle Machtdemonstration Frankreichs und Prestigeprojekt des dortigen Buchhandels, kann einen besonderen Beitrag zur Klärung der französisch-österreichischen Kulturbeziehungen im 18. Jahrhundert leisten. Mein Dissertationsprojekt kreist um die Frage, inwiefern das Konzept Autriche – ‚Österreich‘ als Nation im heutigen Sinne existierte damals nicht – in der Encyclopédie repräsentiert ist. Im Fokus meiner Suche steht das Bild von Autriche, das die Avantgarde der französischen Aufklärung verbreitet hat und das auf die Gesellschaft zurückgewirkt hat. Erörtert wird auch die Rolle der Enzyklopädisten (eine nach heutigem Stand der Forschung rein männliche société de gens de lettres) als Akteure des Kulturtransfers.
Auf der Metaebene soll meine Dissertation zum Verständnis des seinerzeitigen Österreichbegriffs beitragen. Innerhalb der traditions- und umfangreichen Encyclopédie-Forschung gibt es nur ein einziges, schon älteres Werk mit ‚Österreichbezug‘. Die Dissertation Tirol, Kärnten und Steiermark im Spiegel der Encyclopédie von Diderot und D’Alembert von Wanda Nauss (Innsbruck, 1937) unterliegt allerdings einer geographischen Einschränkung und dem Umstand begrenzter Recherchemöglichkeiten zu ihrer Entstehungszeit: Der Zugriff auf ein vollständiges Exemplar aller Bände des Erstdrucks der Pariser Folio-Ausgabe war aufgrund der unübersichtlichen Publikationspraxis bis vor wenigen Jahren keine Selbstverständlichkeit; erst seit Kurzem steht die Édition Numérique Collaborative et CRitique de l’Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers (1751-1772), mit der der ursprünglichste Text erschlossen werden kann, online unter dem Akronym ENCCRE zur Verfügung.
Die Encyclopédie: von Enthusiasmus und Kompetenz getragen
Die Encyclopédie ist die Autorität der französischen Wörterbuchlandschaft schlechthin. Diderot und D’Alembert wollten das gesamte Wissen ihrer Epoche in 28 Bänden – 17 Textbänden (1751-1765) und elf mit Bildtafeln (1762-1772) – darstellen. Damit exponierten sie sich angesichts der strikten Zensur politisch, gingen ohne nennenswerten eigenen finanziellen Gewinn beachtliche persönliche Risiken ein, hinterließen aber auch einen geistesgeschichtlichen Meilenstein. Maßgeblich Anteil daran hatte noch ein Dritter: Louis de Jaucourt (1704-1780) ersetzte 1758 D’Alembert, als dieser das Projekt aufgrund von Streitigkeiten rund um den Artikel GENÈVE verließ.
Die Paratexte zeigen, dass die Hauptakteure der Encyclopédie und das Kollektiv der Enzyklopädisten hohe Ansprüche hatten. Möglichst viel empirisch untermauerte Information sollte sinnvoll angeordnet der Wahrheitsfindung dienen und den Universalitätscharakter des Werks begründen. Allerdings bedeutet lexikographische Arbeit Selektion und Vulgarisierung. Die Enzyklopädisten – etwa 180 sind teils oder vollständig namentlich belegt – haben ohne Lohn, ohne Belegexemplar und doch nach bestem Wissen und Gewissen gearbeitet, um dieses ambivalente Ziel zu erreichen. Sie kamen aus unterschiedlichen akademischen Bereichen und suchten inhaltliche Unterstützung bei Menschen mit einschlägigem prozeduralen Wissen – Bauern, (Kunst-)Handwerkern, Vertretern der Zünfte usw. von unbekannter Identität. Die Artikel sind teils aber bestimmten Autoren zuordenbar, und so erlauben sie Schlüsse auf die Nutzung persönlicher Fachkompetenz: Ein Enzyklopädist beschrieb ein Lemma nicht zwingend aufgrund seines Berufs, sondern oft wegen seiner Freizeitinteressen. Die Herausgeber ihrerseits koordinierten, korrigierten, redigierten, fungierten aber auch als Autoren.
Statistik und Systematik: Autriche in der Encyclopédie
Sucht man nun das Stichwort Autriche, so stößt man in 76 637 Artikeln auf 297 Treffer. Was zunächst wenig erscheinen mag, erklärt sich schlüssig: Autriche wird in der Encyclopédie korrekterweise als einer der cercles de l’Allemagne, also als der österreichische Rechtskreis des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation, bezeichnet. Häufig dürften Erläuterungen zu Allemagne – zu Charakter, Lebensart, Wirtschaft der Deutschen usw. – Autriche subsumieren. Verborgene Bezüge und Anspielungen müssen daher durch detaillierte Lektüre statt mittels digitaler Suche aufgezeigt werden.
Im Detail: 199 Nennungen von Autriche haben geographischen, 45 geschichtlichen und 12 juridischen Hintergrund; das Konzept scheint in 34 weiteren Wissensgebieten auf. Im exemplarisch ausgewerteten Band I der Encyclopédie finden sich zehn Treffer, nämlich in den Artikeln ALBERTUS / ALLEMAGNE / ALTEMBOURG / ANABAPTISTES / ANDRÉAS (SAINT) / ARCHIDUC / ASCHAW / ASTRONOMIE / ATTERZÉE, ASTERZÉE, SCHWARTZÉE und im mit 68 Wörtern sehr kurzen Artikel AUTRICHE, der im geographischen Sinne der Entstehungszeit Ober- und Niederösterreich behandelt.
Entwirft man eine Typologie der Verwendung von Autriche, so findet man fünf Funktionen: Erstens ist der Begriff Teil von Adelstiteln (bspw. „Albert, Archiduc d’Autriche“ in ALBERTUS). Zweitens bezeichnet er die Dynastie Habsburg (bspw. „château de Suisse, dans l’Argow, ancien patrimoine de la Maison d’Autriche“ in ALTEMBOURG). Drittens repräsentiert er die habsburgische Macht gebunden an ihr Territorium (bspw. „par des priviléges particuliers accordés à l’Autriche, à la Hongrie, à la Boheme“ in ALLEMAGNE). Viertens bezeichnet er Ober- und Niederösterreich (bspw. in: „* ATTERZEE, ASTERZEE, SCHWARTZEE, lac d’Allemagne, dans la haute Autriche & le quartier de Traun, le long de l’Eger qui le traverse ; il est aussi traversé du Manzée.“). Fünftens findet man ihn als geographische Entität (bspw. „George Purbachius, ainsi appellé du bourg de Burbach sur les frontieres d’Autriche & de Baviere, qui enseigna publiquement la Philosophie à Vienne, est un de ceux qui ont le plus contribué au rétablissement de l’Astronomie.“ in ASTRONOMIE).
Die enzyklopädische Praxis: Fakten und Wertungen
Gerade die Beispiele zu Funktion vier und fünf sind interessant. Der Artikel ASTRONOMIE zeigt, wie viel Gehalt sich unerwartet in einem Eintrag finden kann. Der Artikel ATTERZÉE, ASTERZÉE, SCHWARTZÉE wiederum lohnt toponomastisch und orthographisch, gibt er doch Aufschluss über phonetisch angepasste Schreibweisen bei noch weitgehend ungenormten Eigennamen. Zugleich fragt man sich, welche Quellen die Enzyklopädisten hatten: Die Ager wird zur „Eger“, der Mondsee durchfließt den Attersee, und das Traunviertel wird kraft eines Übersetzungsfehlers zum Quartier im Sinne eines Stadtviertels. Andere Artikel hingegen, bspw. ARCHIDUC, zeugen von ‚Österreichkompetenz‘: Der Autor Edme François Mallet bezieht sich auf die nicht unstrittige Entstehungsgeschichte dieses Titels, stellt dennoch seine originär österreichische Herkunft fest, erläutert detailliert Rechte und Aufgaben eines Erzherzogs und schafft eine ausgewogene Mischung von einführenden sowie vertiefenden Informationen. In Summe wird sein Artikel allen Maßstäben der Wissensvermittlung gerecht.
An anderen Stellen findet sich ein Spiel mit Wertungen, Andeutungen bzw. Auslassungen. Als Beispiel sei der Artikel VIENNE von Jaucourt einem Close Reading unterzogen; der Zugänglichkeit halber arbeite ich mit eigenen Übersetzungen ausgewählter Passagen. Zunächst schildert Jaucourt Wiens Lage kurios („8 Meilen [lieues] westlich von Preßburg, 210 Meilen südöstlich von Amsterdam, 260 Meilen nordöstlich von Konstantinopel, 408 nordöstlich von Madrid & 270 südöstlich von Paris“). Es folgt eine ästhetische Einschätzung: „Sie kann in gewisser Weise als Hauptstadt Deutschlands betrachtet werden, denn seit langer Zeit ist sie gewöhnlich Residenzstadt der Kaiser; seine schönste Stadt ist sie aber nicht; ganz umgeben von Mauern, Bastionen & Gräben hat sie nichts vom angenehmen Charakter jener Städte, deren Avenuen durch die Vielgestalt der Gärten bezaubern, durch die Lustschlösser & andere äußere Zierden, nämlich die Früchte der glücklichen Lage, welche die Sicherheit des Friedens mit sich bringt. In Wien gibt es nur eine kleine Anzahl schöner Stadthäuser: jenes des Prinzen Eugen, das von Li[e]chtenstein & jenes von Caprara.“ Dann kommt Jaucourt zur Hofburg und den Vororten: „Der kaiserliche Palast gehört zu den gewöhnlichsten [Gebäuden] & nichts dort zeigt die Majestät des Herrn, der ihn bewohnt; als einzigen Garten gibt es einen kleinen Abschnitt unter den Fenstern des Salons der Kaiserin, wo man einige Blumen pflanzt & ein bisschen Grünzeug zieht; die Appartements sind niedrig & eng, die Plafonds mit bemalten Leinwänden bedeckt & die Böden sind aus Tannenbrettern; in Summe ist all das so einfach, als sei es für arme Mönche erbaut. Die Vororte machen mehr Eindruck als die Stadt, weil sie seit der letzten Türkenbelagerung ganz neu aufgebaut wurden.“ Abgerundet wird das düstere Bild durch Verweise auf den unschönen Gesamteindruck, die erbärmliche Unterbringung der Universität, die schlechte Luft, die stets von Schlamm und Unrat bedeckten Verkehrswege. Letztgeschilderte Umstände dürften kein Wiener Unikum gewesen sein; dennoch wird indirekt nahegelegt, dass die Stadt vielleicht ja deshalb nicht gerade viele Gelehrte hervorgebracht habe. Dazu noch die Mittelmäßigkeit des talentlosen Kaisers Leopold und seines Sohnes, der wie schon sein Vater Minister und Stadtrat an seiner Stelle regieren lasse. Insgesamt spricht aus dieser Passage wohl die ressentimentgeladene Perspektive des Franzosen auf Leopold I., den politischen Gegenspieler des Sonnenkönigs.
Das Beispiel VIENNE verdeutlicht, worin neben der möglichst vollständigen Aufarbeitung der maßgeblichen Information die größte Herausforderung meiner Arbeit liegt: Es gilt, die aufgefundenen Erläuterungen, Fakten, Wertungen und Zuschreibungen in ein gut kontextualisiertes, systematisches Geflecht einzuarbeiten, das unter sinnvoller historischer Einordnung dazu beitragen kann, ein bilaterales Verhältnis besser zu verstehen.
Literatur & Links zum Thema
Diderot, Denis/D’Alembert, Jean-Baptiste le Rond (2017): Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. PAR UNE SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES. Mis en ordre & publié par M. DIDEROT, de l’Académie Royale des Sciences & des Belles-Lettres de Prusse ; & quant à la Partie Mathématique, par M. D’ALEMBERT, de l’Académie Royale des Sciences de Paris, de celle de Prusse, & de la Société Royale de Londres. Paris: Chez BRIASSON, rue Saint Jacques, à la Science, DAVID l’aîné, rue Saint Jacques, à la Plume d’or, LE BRETON, Imprimeur ordinaire du Roy, rue de la Harpe, DURAND, rue Saint Jacques, à Saint Landry, & au Griffon. Publiziert online als: Édition Numérique Collaborative et CRitique de l’Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers (1751-1772). In: http://enccre.academie-sciences.fr/encyclopedie/.
Mayer, Martina (2013): Sprachpflege und Sprachnormierung in Frankreich am Beispiel der Fachsprachen vom 16. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Innsbruck: IUP. Online unter: https://books.openedition.org/iup/849?lang=de.
Mayer, Martina (2021): „‘Autriche (Géog.) pays d’Allemagne’: Österreich in der Encyclopédie“. In: Lacheny, Marc / Piok, Maria / Scheichl, Sigurd Paul / Zieger, Karl (Hg.) Französische Österreichbilder – Österreichische Frankreichbilder. Berlin: Frank & Timme, 77-107.
Nauss, Wanda (1937): Tirol, Kärnten und Steiermark im Spiegel der Enzyklopädie von Diderot und D’Alembert. Diss. (masch.) Innsbruck.
Zur Person
Martina Mayer ist seit 2012 Senior Lecturer am Institut für Translationswissenschaft. Sie lehrt u. a. Fach- bzw. Literaturübersetzung FR-DE, Translationsmanagement, Gender Studies sowie französische und österreichische Kulturwissenschaft. Seit 2018 hat sie auch eine Gastprofessur an der Université de Poitiers, wo sie in drei Studiengängen die Einführungen in die Translationswissenschaft hält. Als Mitglied des Doktoratskollegs Austrian Studies sowie der Forschungszentren Kulturen in Kontakt und Dimensionen des Literaturtransfers forscht sie zu translationsrelevanter Kulturwissenschaft, französischer Sprachgeschichte, Translationsdidaktik und intralingualer Übersetzung.