Kapitel
15 | |
| |
 A. (Privat)Rechtliche Sicherungsmittel A. (Privat)Rechtliche Sicherungsmittel |
 C. Sicherungsmittel
iwS C. Sicherungsmittel
iwS |
| |
B. Dingliche Sicherheiten |
| |
| |
1. Allgemeines
zum Pfandrecht | |
Das Pfandrecht ist ein
altes, aber immer noch verlässliches und beliebtes Sicherungsmittel,
das einfach zu handhaben ist, was zu seiner weiten Verbreitung beigetragen
hat. Freilich müssen – strenger als beim Eigentumserwerb – gewisse Übergabsformen eingehalten
werden: Das Pfandrecht legt besonderen Wert auf Publizität;
sei es bei beweglichen Sachen (Übergabe → KAPITEL 2: Übergabsarten
für bewegliche Sachen Faustpfandprinzip),
sei es bei Liegenschaften (Grundbuch). Das ist aber kein Selbstzweck,
sondern geschieht insbesondere aus Gründen des Gläubigerschutzes,
einem Gesichtspunkt, dem im Pfandrecht besondere Bedeutung zukommt. | |
| |
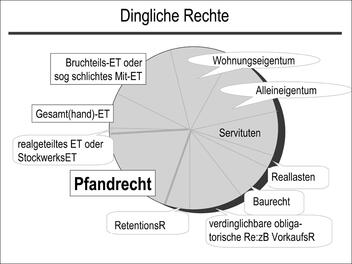 | Abbildung 15.23: Dingliche Rechte |
|
Die Grundlagen unseres Pfandrechts stammen
aus dem alten
Griechenland,
das nicht nur Hypotheken und Mehrfachbelastungen von Liegenschaften
kannte, sondern auch schon entwickelte Grundbücher geschaffen hatte.
– Der Publizitätsgedanke war im antiken Griechenland hoch entwickelt.
– Das Urkunden-, Register- und Archivwesen stammt ebenso von den
Hellenen wie das Notariat und die Anfänge der Advokatur. Vorbilder
und Anregungen hatte Ägypten geliefert. | |
Auch die Pfandrechtsbegründung
folgt der Lehre von Titel und Modus → KAPITEL 2: Die
Lehre von Titel und Modus.
Der Titel rechtsgeschäftlicher Pfandrechtsbegründung ist der Pfandvertrag (§§
1368 ff ABGB), Modus – je nach Art des zu begründenden Pfandrechts
– entweder eine der Übergabsarten der
§§ 426 ff ABGB (ausgenommen das Besitzkonstitut: Faustpfandprinzip!)
oder beim Liegenschaftspfand / der Hypothek, die Eintragung ins
Grundbuch; vgl auch § 451 ABGB. | Pfandvertrag
als
Realvertrag |
§ 1368 ABGB bringt zum Ausdruck, dass der Pfandvertrag Realvertrag ist.
Das führt – wie in → KAPITEL 3: Das
Darlehen als Realvertrag,
erwähnt – dazu, dass Titel und Modus stärker als sonst verzahnt
sind. Vgl nur den Wortlaut des § 1368 ABGB: „ ... wirklich einräumt,
folglich ...”! | |
2. Persönliche,
dingliche und beschränkte Haftung | |
Beim Pfandrecht
lässt sich didaktisch anschaulich der Unterschied zwischen persönlicher
und dinglicher oder Sachhaftung aufzeigen. | |
| |
Was meint dingliche Haftung?: Wird bspw die Forderung eines
Gläubigers durch eine Hypothek gesichert, ist zu
unterscheiden: | Was meint dingliche Haftung?: |
| • Zwischen der gesicherten
Forderung (= zugrundeliegende vertragliche Beziehung zwischen Gläubiger
und Schuldner: zB aus einem Darlehens- oder Liegenschaftskaufvertrag)
sowie deren Geltendmachung / Durchsetzung und | |
| •
dem Liegenschaftspfand / der Hypothek und
der dadurch – gesondert – begründeten Sach- oder Realhaftung der
belasteten Liegenschaft. | |
Für die gesicherte Forderung
und ihre Durchsetzung gelten die allgemeinen Rechtsvorschriften
des Verfahrens- und Zwangsvollstreckungsrechts. Erlangte der Gläubiger
für seine persönliche Forderung (gegen seinen Schuldner) einen Exekutionstitel
auf Zahlung – zB durch Urteil oder gerichtlichen Vergleich; vgl
§ 1 EO, so berechtigt ihn dieser je nach gewählter Exekutionsart
zur Exekution in das gesamte Vermögen des Schuldners → KAPITEL 19: Exekutionsverfahren. | |
Übersicht: „Exekutionsarten”
| |
| • Exekution auf das unbewegliche
Vermögen: §§ 87–248 EO | | | • Exekution auf das bewegliche Vermögen:
§§ 249–345 EO | |
| |
Was
meint persönliche Haftung heute? – Der Schuldner
haftet mit seinem ganzen – auch seinem künftigem – Vermögen. | Persönliche
Haftung meint heute |
Historisch hatte das Nichtbezahlen einer
Schuld lange Zeit Folgen für Leib und Leben oder doch die Freiheit
des Schuldners – Tötung, Schuldknechtschaft/ Versklavung, Schuldturm;
Reste bestanden noch bis ins 19. Jhd. Den entscheidenden Schritt
hatte aber schon
Solon in
Athen (594/3 v.C.) gesetzt, als er den historisch nötigen Ausgleich der
Stände (zwischen Adel und Volk) dadurch herbeiführte, dass er die
Bürgerschaft, das betraf vornehmlich Bauern, entschuldete (sog Lastenabschüttelung
/ Seisáchtheia) und dabei auch das „Leihen auf den Körper” für alle
Zunkunft verbot. Da er seinem Gesetze rückwirkende Kraft verlieh,
gelang es ihm, die in Attika weit verbreitete Schuldknechtschaft,
als Quelle zahlreicher sozialer Missstände, zu beseitigen. Solon
führte für Attika also ua eine Art „Bauernbefreiung” durch, bei
der er dem Grundsatz folgte: „Gemeinnutz geht vor Eigennutz” (H.
Bengtson). | |
Bei reiner Sachhaftung für
eine Schuld / Forderung haftet nur – also ausschließlich! – eine
bewegliche oder unbewegliche Sache, nicht aber das sonstige Vermögen
des Schuldners. | |
 | |
Das österreichische
Privatrecht kennt aber grundsätzlich keine reine Sachhaftung. Neben
der verfangenen Sache – bspw dem bestellten Pfand – haftet daher
immer auch noch der Schuldner weiterhin persönlich. – Anders das
SchwZGB:
Gült (Art
847 ff) und das dtBGB:
Grundschuld
(§§ 1191 ff). Hier haftet der Liegenschaftseigentümer nur mit
der Sache, aber nicht mehr persönlich, dh nicht mit seinem restlichen
Vermögen. – Es wäre bedenkenswert, auch in Österreich (wenigstens
für bestimmte Fälle) eine reine Sachhaftung zu ermöglichen. | Gült, Grundschuld |
Eine
(zusätzlich) begründete Sach- oder Realhaftung gewährt vorrangige
Vollstreckung in die Pfandsache. Andernfalls läuft ein
Gläubiger nämlich Gefahr, dass ihm andere Gläubiger zuvorkommen
oder dass er im Falle einer Insolvenz des Schuldners mit allen anderen
Gläubigern „teilen” muss. | „Sinn” zusätzlicher Sachhaftung |
Das
Geltendmachen der dinglichen Sachhaftung durch den Gläubiger setzt
aber Pfandreife voraus, worunter zB Fälligkeit
der Hypothek(arforderung) zu verstehen ist. Nunmehr kann sich der
Gläubiger zB aus der Liegenschaft befriedigen. Voraussetzung dafür
ist aber wiederum, wie bei der persönlichen Haftung, ein Vollstreckungstitel;
zur Pfand(rechts)verwertung → Pfandverwertung –
Die Begründung der Sachhaftung allein reicht also noch nicht hin,
um sich aus der Pfandsache befriedigen zu können; keine Privatvollstreckung (wie
in alter Zeit). Antike Rechte (etwa das griechische) kannten sie
aber. – Wiederum muss der Gläubiger den Schuldner (oder den Eigentümer der
Pfandsache als Pfandbesteller) klagen und damit die Duldung der
Exekution in das Grundstück erwirken. Das Urteil stellt den Exekutionstitel
dar. Erwächst dieses Urteil in Rechtskraft, kann sich der Gläubiger
die Exekution bewilligen lassen; §§ 3 ff EO. Vgl auch → Pfandverwertung
| Pfandreife |
Manche Wirtschaftsbranchen sind hoch verschuldet.
Die Sicherung der Kredite / Darlehen erfolgt häufig durch Hypotheken.
Das trifft etwa auf Österreichs Hoteliers zu, die
mit 10 Mrd ı (bei einem Substanzwert von ca 15 Mrd ı) bei den Banken
„in der Kreide” stehen. – Man nimmt an, dass ein Viertel der Hoteliers
ihre Verbindlichkeiten nie mehr zurückzahlen kann. Der Volksmund
sagt daher nicht unzutreffend, dass viele dieser Betriebe schon
den „Banken gehören”. Bei schlechter Saison drohen zahlreiche Insolvenzen. | |
Der Schuldner muss hier – nach bestimmten Rechtsvorschriften
– für seine Verbindlichkeiten doch nur mit einem Teil seines Vermögens
aufkommen. Wir unterscheiden zwei Systeme: | |
| •
Das System
der Exekutionsbeschränkung: sog ”cum-viribus”-Haftung;
der Gläubiger kann nicht in das ganze Vermögen des Schuldners, sondern
nur in eine bestimmte Vermögensmasse Exekution führen; zB: Minderjährige
haften für persönlich eingegangene Verpflichtungen nur mit dem Teil
ihres Vermögens, das ihnen zur Verfügung überlassen wurde (§ 39
Abs 1 Z 3 EO). | |
| •
Das System der Betragsbeschränkung:
sog ”pro-viribus”?Haftung; der Schuldner haftet
mit seinem ganzen Vermögen, aber nur bis zu einem bestimmten Betrag;
zB: der Übernehmer eines Vermögens haftet bis zu dessen Wert; §
1409 ABGB → KAPITEL 14: Vermögens-
oder Unternehmensübernahme. – Vgl auch die Haftungs-Höchstbeträge
bei abgeschlossenen (Haftpflicht)Versicherungen (EKHG) → KAPITEL 9: §§
15, 16 EKHG: Haftungshöchstbeträge. | |
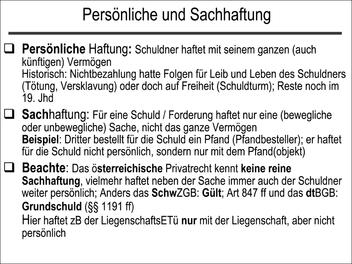 | Abbildung 15.24: Persönliche und Sachhaftung |
|
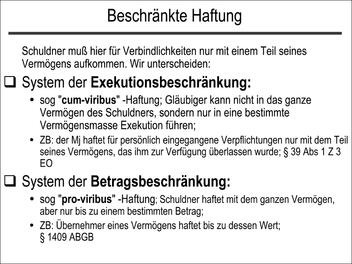 | Abbildung 15.25: Beschränkte Haftung |
|
3. Zur wirtschaftlichen
Bedeutung des Pfandrechts | |
Pfandrecht
ist Sicherungsrecht. Ein ganzer Wirtschaftssektor – der Bankenbereich
– bedient sich der Möglichkeit der dinglichen Besicherung für vielfältige
Geldgeschäfte und Wirtschaftstransaktionen. Die Wirtschaft nützt
dieses Rechtsinstitut zur Geldbeschaffung und Finanzierung. Aber
auch der normale Bürger greift zu den vom Pfandrecht gebotenen Möglichkeiten,
wenn größere Ausgaben zu tätigen sind; sei es ein Hausbau, Renovierungsarbeiten
oder der Kauf teurer Konsumgüter. Das Pfandrecht – in all seinen
Formen – fördert die Kreditgewährung. Gläubiger wären
andernfalls auf persönliche Sicherheiten oder das bloße Vertrauen
in ihre Schuldner angewiesen. | Sicherungsrecht |
Zur weiten Verbreitung des Pfandrechts hat
auch beigetragen, dass es an beweglichen und unbeweglichen Sachen,
aber auch an Forderungen begründet werden kann. | |
Wir unterscheiden folgende Arten der Kreditgewährung: | Arten der
Kreditgewährung |
| •
Personal-
und Realkredit: Beim Personalkredit vertraut der
Gläubiger auf die persönliche Leistungsfähigkeit und –willigkeit
seines Schuldners; beim Realkredit dagegen auf den Wert von Sachen
(bewegliche, unbewegliche oder Forderungen), an denen ihm ein Pfandrecht
eingeräumt werden soll. | |
| •
Mobiliarkredit:
Hier werden bewegliche Sachen als Pfand für gewährte Kredite gegeben. | |
DorotheumsG
1978, BGBl 66/1979 | Pfandleihanstalt: |
Nach dem DorotheumsG 1978 umfassen die Aufgaben
des Dorotheums: | |
1. „die Gewährung von Darlehen gegen Übergabe beweglicher
Sachen (Pfandleihgeschäft); | |
2. die Veranstaltung von Versteigerungen und den Betrieb
des Verwahrungsgeschäftes; | |
3. nach Maßgabe der Erlaubnis den Betrieb von Bankgeschäften
aller Art (ausgenommen die Ausgabe von Schuldverschreibungen). | |
Dabei
gewähren Kreditinstitute Kredite oder Darlehen gegen gleichzeitige
Verpfändung von Waren, Wertpapieren oder Edelmetallen (insbesondere
Gold). | Lombardgeschäft |
| •
Immobiliarkredit:
Liegenschafts- oder Hypothekarkredit. Das Hypothekenrecht besitzt
nach wie vor größte wirtschaftliche Bedeutung. | |
Unterschieden
werden verschiedene Arten von Hypotheken: | Arten von Hypotheken |
| |
-
Höchstbetragshypothek
→ KAPITEL 2: Ausnahmen
vom Spezialitätsgrundsatz:
§ 14 Abs 2 GBG gewährt sie in den beiden Formen der
Sicherungshypothek
(für Forderungen aus einem Krediteröffnungsvertrag) und der
Kautionshypothek
(für eine übernommene Geschäftsführung oder aus dem Titel der Gewährleistung
oder des Schadeneresatzes etc). | |
- Unbekannt ist dem österreichischen Recht (im Gegensatz
zum römischen Recht) die
General
hypothek am
gesamten Vermögen → Prinzipien
des Pfandrechts
| |
| |
| |
- Ertragspfand
oder
Revenuenhypothek:
Hier stehen dem Pfandgläubiger nur die abreifenden Erträge / Früchte
der pfandverfangenen Sache zur Verfügung, nicht dagegen die (belastete)
Sache selbst → Unerlaubte
Pfandabreden Es kommt hier zur Zwangsverwaltung oder
Zwangsverpachtung. | |
| |
| |
| |
Rechtsgrundlagen: §§ 447-470 und §§ 1368-1374
(Pfandvertrag) ABGB. – Das HGB kennt die gesetzlichen Pfandrechte
des Handelsrechts: Kommissionär (§ 397 HGB), Spediteur (§ 410 HGB),
Lagerhalter (§ 421 HGB), Frachtführer (§ 440 HGB). – Die EO regelt
die Pfandverwertung im bürgerlichen Recht; für die handelsrechtliche
gilt nach Art 8 Nr 14 der 4. EVHGB das dtBGB. – Eine Vereinfachung
ist überfällig! | |
„Das Pfandrecht ist das dingliche Recht, welches
dem Gläubiger eingeräumt wird, aus einer Sache (Pfand), wenn die
Verbindlichkeit ... nicht erfüllt wird, ... Befriedigung zu erlangen”;
§ 447 ABGB. | |
Das Pfandrecht dient zur Sicherung einer
Forderung, in dem es dem Gläubiger zur Befriedigung aus
dem Pfand bei Nichtbezahlung der Forderung verhilft; sog Pfandverwertung → Pfandverwertung Das Pfandrecht
ist nämlich ein Wertrecht. Daher kann als Pfand
nur dienen, was vermögensrechtlichen Wert besitzt und daher ver-wert-bar
ist; daher stellen Urkunden, Reispässe oder Geburtsurkunden keine
tauglichen Pfandobjekte dar. | Sicherung und
Befriedigung |

|
SZ
55/112 (1982): Verpfändung eines
Motorradtypenscheins ? – Der für ein Kfz ausgestellte Typenschein
steht nicht „im Verkehr” und kann daher nicht Gegenstand einer Verpfändung
sein. Wohl aber kann daran ein vertragliches Zurückbehaltungsrecht
( → Das
Zurückbehaltungsrecht: § 471 ABGB) begründet werden. In der E übergab der
Kläger sein Motorrad, eine „Laverda 1000” samt Typenschein dem Motorradhändler
zur Vermittlung eines Verkaufs. Der Händler übergab den Typenschein
(des Klägers) samt einem gefälschten Kaufvertrag seiner Bank zur
Sicherstellung für einen von ihm aufgenommenen Kredit. Das Motorrad
gab er dem Kläger nach erfolgloser Vermittlung zurück. Der Kläger
forderte nun von der Bank seinen Typenschein heraus und die beklagte
Bank wendete ein, sie habe durch die Übernahme des Typenscheins
gutgläubig Pfandrecht am Motorrad erworben, da sie an der Verfügungsberechtigung
des Händlers nicht zweifeln musste. – Fragen: Wurde das Motorrad
nach den §§ 426-428 ABGB gültig verpfändet? Kann ein Typenschein
verpfändet werden? (§ 448 ABGB) Erfolgte ein gutgläubiger Pfandrechtserwerb
nach § 456 ABGB? (Dazu → KAPITEL 8: Gutgläubiger
Pfandrechtserwerb)
Kann ein Zurückbehaltungsrecht gutgläubig nach § 471 ABGB oder §
369 HGB erworben werden? | |
|
Gesichert werden können schon bestehende,
das ist der Normalfall, oder auch künftige Forderungen;
letztere aber nur bei entsprechender Konkretisierung (der Forderung):
dh die Parteien, der Rechtsgrund und die Forderungshöhe müssen bekannt
sein. – Zur Sicherung
sog Nebengebühren gleich unten → Prinzipien
des Pfandrechts:
Prinzipien des Pfandrechts. | |
| Abgrenzung des Pfandrechts von anderen dinglichen
Rechten: |
| • Das
Pfandrecht gewährt, anders als die Servituten (→ KAPITEL 8: Die
Servituten),
aber kein Nutzungs- oder Gebrauchsrecht; | |
| • es verpflichtet aber dazu, letztlich die Befriedigung
aus der Pfandsache zu dulden und nicht wie die Reallast
(→ KAPITEL 8: Reallasten) zu einem positiven Tun; | |
| • es gewährt – anders als das Retentionsrecht
→ Das
Zurückbehaltungsrecht: § 471 ABGB –
schließlich Befriedigung aus der Pfandsache. Das handelsrechtliche
Retentionsrecht der §§ 369 ff HGB gewährt aber – neben dem Zurückbehaltungsrecht
– auch ein Befriedigungsrecht, und entspricht dadurch funktional
dem Pfandrecht. | |
| • der Eigentumsvorbehalt (→ KAPITEL 8: Eigentumsvorbehalt
als Warensicherungsmittel)
sichert ebenfalls die Forderung des Verkäufers und begründet ein
(effizient ausgestaltetes) dingliches Anwartschaftsrecht auf das
Vollrecht; überdies wird – anders als beim Pfandrecht – dem Käufer
bereits ein Gebrauchsrecht eingeräumt; | |
| • die Sicherungsübereignung (Sicherungseigentum → KAPITEL 8: Die
Sicherungsübereignung)
überträgt dingliches Vollrecht zu Sicherungszwecken, das aber im
Innenverhältnis treuhändisch beschränkt ist und nach hA nur nach
den Regeln des Pfandrechts begründet werden kann; dem Überträger
verbleibt aber ein gewisses Gebrauchsrecht. | |
| |
Wir
unterscheiden: | Arten und Gegenstände des Pfandrechts |
| • Das
Faust- oder
Handpfand wird an
beweglichen körperlichen Sachen begründet (Faustpfandprinzip); | |
| •
beim
Forderungspfand ist das Forderungsrecht,
also eine unkörperliche Sache iSd § 292 ABGB, Gegenstand des Pfandrechts; | |
| • die
Hypothek oder das
Grundpfand wird
an unbeweglichen Sachen / Liegenschaften oder an einem Baurecht
begründet. | |
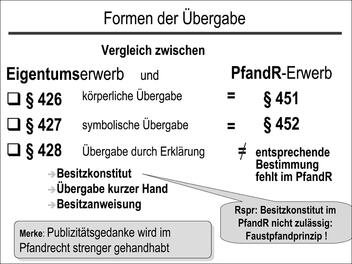 | Abbildung 15.26: Formen der Übergabe |
|
5. Begründung
und Erwerb des Pfandrechts | |
Der
Pfandrechtserwerb folgt der Lehre von Titel und Modus; § 380 ABGB → KAPITEL 2: Die
Lehre von Titel und Modus. Wie
bei anderen dinglichen Rechten ist auch zum Erwerb eines gültigen
Pfandrechts sowohl ein Titel, wie die nötige Übergabs- oder Erwerbungsart
(Modus) erforderlich. | |
Gültiger Titel des Pfandrechtserwerbs ist
entweder: | |
| •
ein Pfandbestellungsvertrag =
Ver-pfändung (§
1368 ABGB: Realkontrakt). Man spricht in diesem Fall von Vertragspfand. | |
Heute wird auch ein bloß auf Konsens beruhender
Pfandbestellungsvertrag als zulässig erachtet. – Vgl damit: Darlehen
<-> Kreditvertrag. | |
| • Oder eine Pfandrechtsbegründung
durch Richterspruch =
Pfändung; und schließlich | |
gibt es auch
das gesetzliche Pfandrecht; zB das des Vermieters
(§ 1101 ABGB) oder von Rechtsanwälten nach § 19 Abs 4 und § 19a
RAO. – Hier ist das Gesetz Titel des dinglichen Rechtserwerbs. | |
Eine Übersicht der gesetzlichen Pfand- und
Vorzugsrechte sowie zum richterlichen Pfandrecht findet sich bei Dittrich
/ Tades, ABGB34, S. 488 f bei § 450
ABGB. | |
Als Modus oder taugliche Erwerbungsart
für eine Pfandrechtsbegründung dient: | |
| |
bei Liegenschaften die Intabulation; | |
Modus
für das Pfändungspfandrecht (bei Exekutionen) ist die Eintragung
ins Pfändungsprotokoll (bewegliche Sachen) oder
ins Grundbuch (für Liegenschaften). | |
| |

|
OGH 26. 2. 2002, 1 Ob 32/02s, JBl 2002, 523 = EvBl 2002/119:
Die Betreiberin einer Pfandleihanstalt nimmt als Sicherheit für
einen Kredit an einen Kunden den
Typenschein seines Pkw entgegen. Dieser meldet
den Typenschein bei der Bundespolizeidirektion als verloren und
lässt sich einen neuen ausstellen. Die Behörde ließ sich entgegen
§ 30 Abs 5 KFG den Verlust des alten Typenscheins nicht bescheinigen. Die
Klägerin klagt nach AHG auf Schadenersatz. – OGH verneint Rechtswidrigkeitszusammenhang:
§ 30 Abs 5 KFG sei zwar eine Schutznorm iSd § 1311 ABGB, sie bezwecke
aber nicht den Schutz zivilrechtlicher Ansprüche eines Darlehensgebers,
der zur Sicherung der Rückzahlungsverpflichtung den Typenschein
in seine Gewahrsame nimmt. Vielmehr soll die Bestimmung im öffentlichen
Interesse ganz allgemein den Gefahren vorbeugen, die durch den Betrieb
nicht typengerechter Fahrzeuge im Straßenverkehr hervorgerufen werden. | |
|
|
|
OGH 25.8.1999,
3 Ob 308/97h, JBl 2000, 32 (Austausch eines Porsche Carrera 911
gegen einen Audi 100 Quatro als Pfandobjekt): Soll
an die Stelle einer im vorbehaltenen Eigentum des Verkäufers und
idF des Finanzierers (Bank) stehenden Sache (Porsche) eine andere
treten (Audi), die dem Käufer gehört, so bedarf es neben dem entsprechenden
Vertrag, der insofern einen tauglichen Titel bildet, für die Begründung von
Sicherungseigentum der körperlichen Übergabe des Austauschobjekts
und nicht nur der Übergabe des Typenscheins. Im Falle des Konkurses
des Käufers steht daher der Bank kein Herausgabeanspruch nach der
KO zu, weil nach hA Sicherungseigentum nur nach den Regeln der gültigen
Pfandrechtsbegründung erworben werden kann. | |
|
| |
Pfändung
körperlicher Sachen – § 253 EO | |
(1)
Die Pfändung ... körperlicher Sachen wird dadurch bewirkt, daß das
Vollstreckungsorgan dieselben in einem Protokolle verzeichnet und
beschreibt;
Pfändungsprotokoll
| |
(2) Die Pfändung kann nur für eine ziffernmäßig
bestimmte Geldsumme stattfinden. | |
(3) Behaupten dritte Personen bei der Pfändung
an den im Protokolle verzeichneten Sachen solche Rechte, welche
die Vornahme der Exekution unzulässig machen würden [zB Eigentum: Exszindierung ],
so sind diese Ansprüche im Pfändungsprotokoll anzumerken. | |
(4) Der Beschluß, durch welchen die Pfändung
bewilligt wurde, ist dem Verpflichteten bei Vornahme der Pfändung
zuzustellen. | |
| |
6. Das Pfandrecht
als Zwei- oder Dreipersonenverhältnis | |
Der persönliche Schuldner kann eine eigene Sache verpfänden,
wodurch er sowohl Pfandbesteller, als auch Pfandschuldner wird.
In diesem Fall ist das Pfandrecht ein: | |
| •
Zwei-Personen-Verhältnis
| |
| • Dingliche Sicherheit in Form eines Pfandrechts
kann dem persönlichen Gläubiger aber auch dadurch eingeräumt werden,
dass ein Dritter für den Schuldner eine Sache als
Pfand bestellt. Dann stehen dem persönlichen Gläubiger, der zugleich
Pfandgläubiger ist, auf der einen Seite nach wie vor der persönliche
Schuldner gegenüber und andererseits ein Dritter als Pfandbesteller und
Pfandschuldner. | |
| |
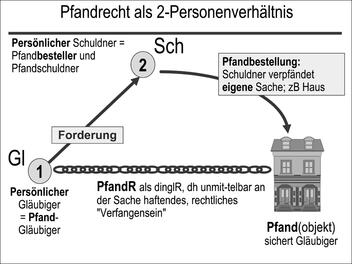 | Abbildung 15.27: Pfandrecht als 2-Personenverhältnis |
|
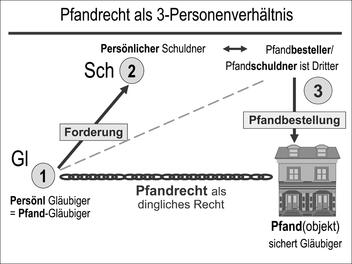 | Abbildung 15.28: Pfandrecht als 3-Personenverhältnis |
|
 | |
7. Verpfändung
und Pfändung von Forderungen oder Rechten | |
Nach
§ 448 ABGB kann als Pfand „jede [!] Sache dienen, die im Verkehr
steht”. Sie muss nur als Vermögensobjekt verwertbar sein → Mehr
zum Pfandrecht Zum
Sachbegriff des ABGB zählen auch Rechte und Forderungen. Sie sind
unkörperliche Sachen → KAPITEL 8: Körperliche
und unkörperliche Sachen und
ebendort , S.. Auf unkörperliche Sachen finden aber die Regeln des
Sachenrechts grundsätzlich keine Anwendung. Die Übertragung des
Vollrechts an einer Forderung erfolgt daher nicht nach den §§ 426
ff ABGB, sondern nach den Zessionsregeln der §§ 1392 ff ABGB. | |
Dennoch lässt man, mag
das auch einen Systembruch darstellen, die Pfandrechtsbegründung sowohl
an | Systembruch |
| •
Forderungsrechten (also
schuldrechtlichen Ansprüchen), wie | |
| •
dinglichen Rechten (zB Fruchgenuss,
Pfandrecht: Pfandrecht am Pfandrecht = Afterpfandrecht – §§ 454
f ABGB) und | |
| •
absoluten Rechten (zB Patentrechten)
zu. | |
Dabei sind weiters
zu unterscheiden (wobei die Regeln von Titel und Modus
auch hier zu beachten sind): | Weiters zu unterscheiden |
| • Forderungen, die
in Inhaber- oder Orderpapieren verbrieft
sind, werden durch die Übergabe des jeweiligen (Wert)Papiers verpfändet; | |
| •
(offene) Buchforderungen können
auch durch einen deutlichen Vermerk in den Geschäftsbüchern des
Pfandbestellers verpfändet werden; und | |
| •
die Verpfändung sonstiger Forderungsrechte erfolgt
iSd § 424 ABGB (symbolische Übergabe, Übergabe durch Zeichen), zumal
eine körperliche Übergabe von Forderungen ausscheidet. Zur formlosen
(Titel)Vereinbarung zwischen Pfandgläubiger und Pfandschuldner iSd
§ 1368 ABGB hat aber hier noch die Drittschuldnerverständigung zu
erfolgen, die zu enthalten hat, welche Forderung, an wen verpfändet
wurde. | |
Von der Begründung eines Pfandrechts
an einer Forderung ist die Sicherungszession ( → KAPITEL 14: Sicherungszession)
zu unterscheiden, die allerdings vergleichbaren Regeln folgt. –
Der Unterschied liegt aber darin, dass die Sicherungszession (nur)
das obligatorische Vollrecht an einer Forderung überträgt; wenngleich
unter der treuhändischen Einschränkung, über die Forderung nur im
Sicherungsfall zu verfügen, also sich daraus zu befriedigen. – Das
Pfandrecht dagegen überträgt immer nur ein beschränktes und kein
Vollrecht, allerdings ein (quasi)dingliches Recht. | Unterscheide:
Sicherungszession |
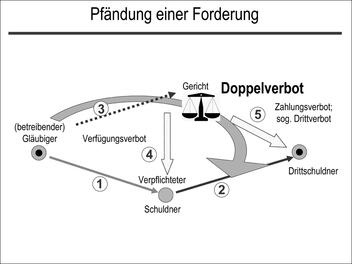 | Abbildung .28: Pfändung einer Forderung (s. Zession!) |
Wird eine Forderung gepfändet (zB Sparbuch, Gehalt)
kommt noch der sog Drittschuldner (= Schuldner der gepfändeten Forderung)
hinzu. |
|
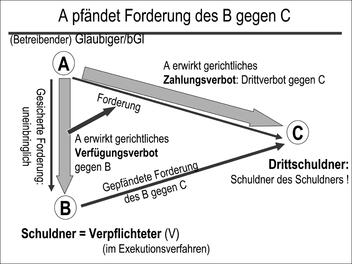 | Abbildung 15.29: A pfändet Forderung des B gegen C |
|
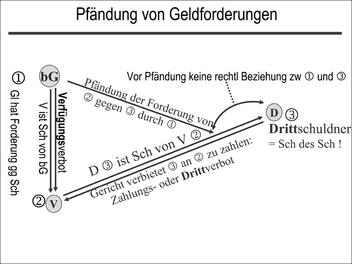 | Abbildung 15.30: Pfändung von Geldforderungen |
|
8. Prinzipien
des Pfandrechts | |
| |
Auch das Pfandrecht ist ein dingliches Recht,
das an der Sache haftet und das mit absoluter Wirkung ausgestattet
ist. – Es zählt zu den beschränkten dinglichen Rechten. | |
Entstehung und Weiterbestand des Pfandrechts hängen vom
Bestand der gesicherten Forderung ab, dessen Nebenrecht das Pfandrecht
ist; Akzessorietät. Erlischt die gesicherte Forderung, erlischt auch
das Pfandrecht. | |
Das Pfandrecht muss für Dritte (insbesondere andere Gläubiger)
erkennbar sein. Dafür sorgen das Faustpfand- und das bücherliche
Intabulationsprinzip. Beim Forderungspfand sorgen andere Akte für
seine Publizität; Drittschuldnerverständigung oder Buchvermerk. | |
Dabei sind zwei Aspekte (der Spezialität) zu unterscheiden: | |
| • Einerseits kann ein
Pfandrecht nur an bestimmten Sachen begründet werden
und in der Folge bestehen. Es gibt also bei uns keine Generalpfandrechte!
Weder am gesamten Vermögen (etwa in Form einer Generalhypothek),
noch in der Form der Verpfändung eines ganzen Unternehmens oder
einer sonstigen Gesamtsache → KAPITEL 8: Gesamtsachen.
Pfandrechtsbegründung und Veräußerung – zB eines Unternehmens –
gehen unterschiedliche Wege. | |
War eine Liegenschaft mit einer Hypothek belastet
und brennt das darauf stehende Haus ab, erfasst das Pfandrecht nunmehr
die (Feuer)Versicherungssumme; bei Enteignungen erfasst
das Pfandrecht die Entschädigungssumme und bei Verarbeitung der
Pfandsache belastet das Pfandrecht künftig die neue Sache. Man spricht
hier von einer Wandlung des Pfandrechts oder Pfandrechtsmodifikation.
– Der Gedanke der Spezialität wird dadurch kaum beeinträchtigt. | |
| •
Andrerseits
kann nach § 14 Abs 1 GBG ein Pfandrecht nur für ziffernmäßig
bestimmte Geldforderungen eingetragen werden; eine Ausnahme
bildet aber die Höchstbetragshypothek nach
§ 14 Abs 2 GBG → KAPITEL 2: Ausnahmen
vom Spezialitätsgrundsatz. | |
| |
Werden an einem Pfandgegenstand
mehrere Pfandrechte begründet, was für Liegenschaften praktische
Bedeutung besitzt, richtet sich ihr Rang – und damit die Reihenfolge
der Befriedigung aus dem Pfand – nach der Reihenfolge ihrer Begründung;
vgl auch → Priorität
oder Rangprinzip Das jeweils ältere Recht geht vor; Priorität. | Priorität
oder Rangprinzip |
Vgl die Rechtssprichwörter: „Wer zuerst kommt,
mahlt zuerst”; oder: römisches Recht: „prior tempore potior iure”. | |
Eine
Änderung erfährt der Grundbuchsrang dadurch, wenn bei mehrfacher
hypothekarischer Belastung die Forderung eines Hypothekargläubigers
– etwa des dritten von fünf Rängen – getilgt und die Hypothek gelöscht
wird; vgl § 469 ABGB. In diesem Fall rücken – wenn der Liegenschaftseigentümer
nicht von seinem Verfügungsrecht nach § 469 ABGB
Gebrauch macht, und kein Rangvorbehalt (§ 58 GBG) begründet wird
und es zu keiner bedingten Pfandrechtseintragung (§ 59 GBG) kommt
– die Nachhypothekare jeweils eine Stelle vor: der vierte wird dritter
und der fünfte vierter usw. Man nennt dies Vorrückungsprinzip. | Vorrückungsprinzip |
Zu diesen Bestimmungen gleich unten. | |
| ”Recht an fremder Sache”
und „Grundsatz der ungeteilten Pfandhaftung” |
9. Das
Pfandrecht als Recht an fremder Sache | |
Das Pfandrecht teilt dieses Kriterium mit den
Servituten. Die Rspr lehnt Pfandrechte an eigener Sache grundsätzlich
ab; zu den Ausnahmen gleich mehr. Das Pfandobjekt darf nicht dem
Pfandgläubiger, sondern muss dem Schuldner der (Gläubiger)Forderung
oder einem Dritten als Pfandbesteller gehören. | |
Das Grundbuchsrecht kennt
aber wichtige Ausnahmen, wobei zu beachten ist,
dass in diesen Fällen auch von einem Wiederaufleben des Eigentums
als dinglichem Vollrecht gesprochen werden kann: | Ausnahmen |
Eine Verbindlichkeit
wird nach § 1412 ABGB grundsätzlich durch Zahlung, das ist die Leistung dessen,
was man zu zahlen schuldig ist, erfüllt. Das gilt nach § 469 ABGB
auch für das Pfandrecht. Für Hypotheken statuiert jedoch § 469 Satz
3 ABGB: | §
469 ABGB: Verfügungsrecht des Liegenschaftseigentümers |
„Zur Aufhebung einer Hypothek ist die Tilgung
der Schuld allein nicht hinreichend. Ein Hypothekargut bleibt so lange
verhaftet, bis die Schuld aus den öffentlichen Büchern gelöscht
ist.” | |
Bis
dorthin besteht das Pfandrecht fort. Man spricht vom Verfügungsrecht
des Liegenschaftseigentümers nach Tilgung der Schuld ohne
grundbücherliche Löschung des Pfandrechts; sog forderungsentkleidete
Eigentümerhypothek. – Die Hypothek steht daher, genauer:
das Verfügungsrecht über den Hypothekenrang der getilgten Schuld,
dem Liegenschaftseigentümer als vormaligem Schuldner und Pfandbesteller
zu. | Forderungsentkleidete Eigentümerhypothek |
| |
| •
Auch
beim Rangvorbehalt des § 58 GBG besteht die Möglichkeit, dass der
pfandbestellende Schuldner über den Rang der ursprünglich für den
Gläubiger begründeten Hypothek nachträglich erneut verfügen kann. | |
Abs 1: „Im Falle der Löschung des Pfandrechts
kann der Eigentümer zugleich die Anmerkung im Grundbuch erwirken,
das die Eintragung eines neuen [!] Pfandrechtes im Rang und bis
zur Höhe des gelöschten Pfandrechtes binnen drei Jahren nach der
Bewilligung der Anmerkung vorbehalten bleibt ....” | |
| •
Vgl § 470 Satz 2 (Erlöschen
des Pfandrechts) iVm § 1446 (Vereinigung) ABGB:
Von echter Eigentümerhypothek wird deshalb gesprochen, weil die
Stellung des Pfandgläubigers und jene des Pfandschuldners (in einer
Person) zusammenfallen; etwa dadurch, dass der (Pfand)Gläubiger, die
ihm als Pfand dienende Liegenschaft kauft. Die gesicherte Forderung
besteht auch dann weiter; als Pfandobjekt dient nunmehr aber die
eigene Liegenschaft. Vgl den Text des § 470 ABGB. | Echte oder forderungsbekleidete Eigentümerhypothek |
| •
Bedingte Pfandrechtseintragung | |
Vgl insbesondere Abs 1: „Der Eigentümer
einer Liegenschaft kann begehren, dass im Rang und bis zur Höhe
eines auf der Liegenschaft [bereits] haftenden Pfandrechtes das
Pfandrecht für eine neue [!] Forderung mit der Beschränkung eingetragen
werde, dass es Rechtswirksamkeit erlangt, wenn binnen einem Jahr
nach der Bewilligung der Eintragung des neuen Pfandrechtes die Löschung
des älteren Pfandrechtes einverleibt wird.” Nach Abs 2 ist der Eintritt
dieser Bedingung im Grundbuch anzumerken. | |
Diese
Möglichkeit dient in der Praxis der Umschuldung.
– So, wenn ein gewährter teurer Kredit oder ein solches Darlehen
gegen günstigere Kredite oder Darlehen „ausgetauscht” werden soll.
Das geht allerdings nur mit Zustimmung des Hypothekargläubigers.
An die Stelle der Hypothek für das alte Darlehen, soll der gleiche
Rang künftig das günstigere neue Darlehen sichern. Ist der alte Hypothekargläubiger
einverstanden, zahlt der Liegenschaftseigentümer, der zugleich Pfandbesteller
ist, Zug um Zug gegen Aushändigung einer Löschungsquittung den Darlehensbetrag
an den Altgläubiger zurück. Würde die Althypothek gelöscht und nicht
von der Möglichkeit einer bedingten Pfandrechtseintragung Gebrauch
gemacht, würden allfällige Nachhypothekare rangmäßig nachrücken
und die hypothekarische Sicherung des günstigeren Kredits könnte
nur im Rang nach den bereits eingetragenen Pfandrechten, also im
letzten Rang, erfolgen. Das hätte wiederum Auswirkungen auf die
Kreditkonditionen. | Umschuldung §
59 GBG: Bedingte Pfandrechtseintragung |
| •
Vgl in diesem Zusammenhang auch das gesetzliche
Pfandrecht des Kommissionärs nach den
§§ 397 ff HGB: Nach § 398 HGB kann sich der Kommissionär, „auch
wenn er Eigentümer des Kommissionsguts ist, für die in § 397 bezeichneten
Ansprüche ... aus dem Gute befriedigen.” | Pfandrecht
des Kommissionärs |
10. Grundsatz
der ungeteilten Pfandhaftung | |
Das bestellte
Pfand(recht) haftet für die gesamte Forderung; und zwar für die Hauptforderung – zB
die Darlehnssumme – samt Nebengebühren; etwa Zinsen,
seien es gesetzliche oder vertragliche, aber auch Verfahrenskosten
iwS, also Prozess- und Exekutionskosten (§
16 GBG) etc. Nach § 14 Abs 1 GBG muss bei einer verzinslichen Forderung
auch die Höhe der Zinsen eingetragen werden. Dreijährige Zinsenrückstände
genießen nach § 17 GBG „gleichen Rang mit dem Kapital”. Das Pfand
haftet auch für allfällige Schadenersatzansprüche oder
eine Konventionalstrafe. | Hauptforderung
und Nebengebühren |
Zur
(Rang)Sicherung von Nebengebühren bedient sich die Praxis der Nebengebührensicherstellung,
die im Rang der Hauptforderung verbüchert wird. Man spricht auch
von Nebengebührenkaution. | Nebengebührensicherstellung |
Vgl
hinsichtlich unseres Grundsatzes auch die Regelung des § 13 Abs
1 GBG: Bei Alleineigentum belastet die Hypothek
den ganzen Grundbuchskörper, bei Miteigentum den
ganzen Miteigentumsanteil. Eine kleine Ausnahme gestattet § 13 Abs
2 GBG. | Alleineigentum
und
Miteigentum |
Tilgt zB der Pfandschuldner / -besteller
die durch Pfandrecht gesicherte Forderung bloß teilweise, verpflichtet
das den Pfandgläubiger nicht zur Teilrückstellung des Pfandes, was
meist auch praktisch nicht möglich wäre. Anders aber beim Geldpfand.
– Wurde eine Liegenschaft hypothekarisch belastet und wird an ihr
später Miteigentum begründet, bleibt die ursprüngliche Pfandbelastung
der ganzen Liegenschaft grundsätzlich (an allen Teilen) aufrecht. | |
11. Unerlaubte
Pfandabreden | |
§
1371 ABGB erklärt eingangs in einer Generalklausel alle
der Natur des Pfand- und Darlehnsvertrags entgegenstehenden Bedingungen
und Nebenverträge für ungültig. – Danach ist bspw die Sicherungsübereignung
durch Besitzkonstitut unerlaubt, weil dies dem Faustpfandprinzip
widerspricht. | Generalklausel |
Als Beispiele nennt §
1371 ABGB: | Beispiele |
| • Sog
Verfallsklauseln (lex commissoria), also
Abreden, „daß nach der Verfallszeit der Schuldforderung das Pfandstück
dem Gläubiger zufalle”; | |
| • oder, „daß er es [sc das Pfandstück] nach
Willkür, oder in einem schon im voraus bestimmten Preise veräußern,
oder für sich behalten könne;” [Warum verbietet
das Gesetz das wohl?] | |
| • oder, „daß der Schuldner das Pfand niemals
einlösen”, | |
| • oder „ein liegendes Gut keinem andern
verschreiben”, | |
| • oder „daß der Gläubiger nach der Verfallszeit
die Veräußerung des Pfandes nicht verlangen dürfe”. | |
Was unterscheidet das letzte Beispiel von
den vorangehenden? – Beachtet werden sollte die vorbildliche legistische Kombination
von Generalklausel (Satz 1) und in der Folge aufgezählten Beispielen,
die das zunächst allgemein Angeordnete anschaulich und die Rechtsanwendung
zusätzlich flexibel machen. | |

|
EvBl
2000/85 (§ 1371 ABGB, § 24 UrhG) – Fehlende
Rückübertragungspflicht als Verfallsabrede: Eine der
Sicherung des Werknutzungsberechtigten dienende Vereinbarung, die
dessen Pflicht, das Werknutzungsrecht bei Auflösung des Vertrags
(über die Einräumung des Werknutzungsrechts) dem Vertragspartner
rückzuübertragen, auf einen bestimmten Sachverhalt einschränkt und
damit dazu führt, dass das Werknutzungsrecht dem Werknutzungsberechtigten
endgültig verbleibt, wenn sein Vertragspartner die durch die Vereinbarung
gesicherten Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß erfüllt,
ist eine unzulässige Verfallsabrede. | |
|
§
1372 ABGB verbietet es dem Gläubiger, sich die
Fruchtnießung
der verpfändeten Sache auszubedingen; das ist das alte
pactum antichreticum. Hier besteht nämlich die Gefahr verdeckten Wuchers.
Satz 2 unserer Bestimmung gestattet dem Gläubiger aber den „bloße[n]
Gebrauch eines beweglichen Pfandstückes”, wenn dieser ihm vom Pfandbesteller
gestattet wurde; vgl auch § 459 ABGB. Bei Hypotheken ist das aber
nicht gestattet, wenngleich die Praxis es zulässt, dass eine verpfändete
Liegenschaft dem Pfandgläubiger in Bestand gegeben wird; GlU 11.289
(1886): Verpfändung von Zimmern eines Hauses und Einräumung ihrer
Bewohnung an Stelle von Darlehenszinsen. | |
| Ertragspfand |
| |
Das
Pfandrecht ist – wie wir gehört haben – Sicherungsrecht,
aber es gewährt auch ein Befriedigungsrecht. Das
bedeutet letztlich, dass sich der Pfandgläubiger aus dem Pfand –
wenn auch nicht eigenmächtig und unmittelbar – befriedigen kann,
wenn der Schuldner die geschuldete und durch das Pfand gesicherte
Forderung/Leistung nicht erbringt. | |
Der Pfandgläubiger darf aber nach bürgerlichem
Recht das Pfand nicht eigenmächtig veräußern: Das Verfahren der
„Umänderung” des Pfandrechts von einem bloß abstrakten
Sicherungs-, in ein konkretes Recht zur
Befriedigung aus der Pfandsache, heißt Pfandverwertung. Sie erfolgt unter
Einbeziehung des Gerichts. (Die Rechtsgeschichte lehrt uns nämlich,
dass es hier leicht zu Übergriffen des Gläubigers kommen kann.)
Das Verfahren ist relativ kompliziert und nur für Kaufleute – genauer:
wenn der Pfandgläubiger Kaufmann ist – einfacher. In diesem Fall
steht dem Kaufmann zur rascheren Verwertung die Möglichkeit des
außergerichtlichen Verkaufs zu; Art 8 Nr 14 der 4. EVHGB. – Über
angemessene Vereinfachungen sollte nachgedacht werden. | Was heisst
Pfandverwertung? |
Die (normale) Pfandverwertung erfolgt im
Exekutionsverfahren, also durch Zwangsvollstreckung;
§§ 461 ff ABGB und 81 ff EO. – Die §§ 465, 466 ABGB stellen klar,
dass sich der Pfandgläubiger entweder an das Pfand, oder „anderes
Vermögen des Schuldners” oder beides halten kann! Daran zeigt sich
das Zusammenspiel von persönlicher und Sachhaftung. | |
| |
Bezahlt der Schuldner
aber seine Schuld bei Fälligkeit, hat ihm der Pfandgläubiger Zug
um Zug (§ 1052 iVm § 469 Satz 2 ABGB) das Faustpfand zurückzugeben und
der Hypothekargläubiger hat eine Löschungserklärung auszustellen;
§ 1369 Satz 2 und 3. – Ein allfälliger Schaden,
den das Pfand genommen hat, ist vom Pfandgläubiger zu ersetzen. | Erfüllung der
Pfandschuld |
Umgekehrt steht
aber dem Pfandgläubiger nach § 458 ABGB „bei Entdeckung eines unzureichenden
Pfandes” (Marginalrubrik) das Recht zu, vom „Pfandgeber ein anderes
angemessenes Pfand zu fordern.” Aus § 458 ABGB wird der sog Devastationsanspruch des
Pfandgläubigers abgeleitet. Danach kann der Pfandgläubiger den Pfandbesteller
auch auf Unterlassung schuldhaft (§ 458 ABGB fordert „Verschulden
des Pfandgebers“!) schädigender Einwirkungen klagen. Es ist dies
eine
dingliche
Unterlassungsklage (auch) wegen drohender Verschlimmerung
des Pfandes oder nach bereits erfolgterVerschlechterung auf Wiedergutmachung. | |

|
EvBl 1962/56: Bäume fällen; | |
|
|
|
EvBl 1984/119: Abschluss
von Mietverträgen nach Einleitung des Zwangsversteigerungsverfahrens. | |
|
|
|
OGH 24. 2. 2000, 8 Ob 254/99g, SZ 73/40:
Hochverschuldeter (über 20 Mio S) Wohnungseigentümer belastet
seine Zweitwohnung mit einer Hypothek. Kurz darauf vermietet
er sie zu unüblichen Bedingungen: Bestanddauer von 15 Jahren, Mietzins
von 20.000 S jährlich, Mietzins-Vorauszahlung von 300.000/der Mietzinse
der ersten 5 Jahre. Dem Beseitigungsanspruch auf Grund der Devastationsklage (§
458 ABGB) hält der Mieter seine Unkenntnis von der wirtschaftlichen
Situation des Vermieters entgegen; fehlendes Verschulden. – OGH
verlangt vom Mieter unter bestimmten Voraussetzungen (hier: gravierende
Abweichungen von den üblichen Konditionen) Grundbuchseinsicht; um
in seinem Vertrauen geschützt zu sein, mit dem Abschluss des Mietvertrags
nicht in absolut geschützte Rechte Dritter einzugreifen. – Die Linie
des OGH überzeugt nicht, zumal bspw nichtberücksichtigt wird, dass
das Mietobjekt in der Heizungsperiode nicht benutzbar war, was den
Mietpreis ja bereits verdoppelt hätte. Einfachheit sollte auch heute
ein Ziel zivilistischer Praxis bleiben. | |
|
|
|
OGH 20. 12. 2001, 6 Ob 261/01b, EvBl 2002/94:
Nach Anmerkung der Zwangsversteigerung einer hypothekarisch belasteten
Liegenschaft im Grundbuch vermietet der Hypothekarschuldner das
Wohnhaus samt Tischlereiwerkstätte um die Hälfte des angemessenen
erzielbaren Mietzinses mit der Zusatzvereinbarung, der Mieter müsse
die desolaten Räumlichkeiten in Stand setzen. Der Hypothekargläubiger
erhebt die
Devastationsklage (§
458 ABGB). – OGH: Eine Räumung des Mieters kommt nur in Frage, wenn rechtswidrig
und schuldhaft gehandelt wurde. OGH verneint eine Verletzung der
Erkundungspflicht/Schuldhaftigkeit (Einsicht ins Grundbuch) aus
zwei Gründen: Weder sei der Mietvertrag ein solcher über ein üblicherweise
nicht vermietetes Objekt, noch sei er zu unüblichen Konditionen
geschlossen worden (Berücksichtigung der Instandsetzungskosten von
fast 1 Mio S). | |
|
|
|
OGH 24. 4. 2001, 1 Ob 286/00s, EvBl 2001/174:
Gattin wird im Rahmen einer Ehescheidung richterlich nach
§ 87 EheG ein unbefristetes Mietrecht (8.000 S
monatlich) an vormaliger Ehewohnung eingeräumt. Hypothekargläubiger
(Bank) wendet Pfandverschlechterung /Devastation ein
und argumentiert mit „materieller Enteignung”. – OGH: Ein Pfandgläubiger,
der dadurch eine Pfandverschlechterung erfährt, dass die Ehewohnung
an einen früheren Ehepartner vermietet wird, kann eine gerichtlich
angeordnete Vermietung zu üblichen Konditionen nicht verhindern.
OGH weist überdies verfassungsrechtliche Bedenken zurück; keine
willkürliche Verletzung eines dinglichen Rechts. | |
|
Wird
der Pfandgläubiger „nach Verlauf der bestimmten Zeit [= Fälligkeit]
nicht befriedigt; so ist er befugt, die Feilbietung des
Pfandes gerichtlich zu verlangen”; § 461 Satz 1 ABGB. | Fälligkeit der
Pfandschuld |
Nach hA kann ein Hypothekargläubiger
seine (gesicherte) Forderung nur durch Klage (!) geltend machen.
Die Realisierung des Pfandrechts erfolgt mittels Pfandrechts- oder Hypothekarklage. Das
erwirkte Urteil bringt dem Pfandgläubiger den nötigen Exekutionstitel,
der schließlich die Befriedigung durch Zwangsvollstreckung gestattet.
– Die hA verlangt aber dieses umständliche Verfahren, das für Liegenschaften
zu billigen ist, auch für das Fahrnispfand, was problematisch erscheint. | |
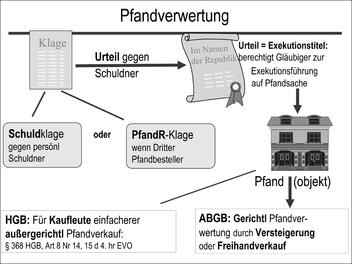 | Abbildung 15.31: Pfandverwertung |
|
13. Erlöschen
des Pfandrechts | |
Grundsätzlich
erlischt ein bestehendes Pfandrecht (an beweglichen Sachen) durch Erfüllung
der (durch das Pfand gesicherten) Schuldforderung;
wurde es an einer Liegenschaft bestellt, bedarf es darüber hinaus
der Löschung im Grundbuch: § 469 ABGB → Das
Pfandrecht als Recht an fremder Sache
| |
| Weitere Erlöschensgründe: |
| • Sonstiger
Untergang der Forderung, | |
| • Verzicht (auf das Pfandrecht), | |
| • Untergang (der Pfandsache, § 467 ABGB), | |
| • Vereinigung (der Pfandgläubiger- und Pfandbestellerstellung,
§ 467 ABGB), | |
| • bedingungslose Rückstellung (der Pfandsache), | |
| • allenfalls durch Zeitablauf (Verjährung: §
1499 und § 1483 ABGB) und schließlich | |
| • gutgläubigen lastenfreien Pfandrechtserwerb;
§ 456 ABGB. | |
14. Verwandte Sicherungsrechte | |
Das Pfandrecht
begründet ein Sicherungs-, kein Nutzungsrecht.
– Daher werden anstelle der Pfandrechtsbegründung immer wieder andere
Sicherungsmittel verwendet; etwa: | Kein Nutzungsrecht |
| • das Sicherungseigentum
→ KAPITEL 8: Die
Sicherungsübereignung; | |
| • die Sicherungsabtretung
→ KAPITEL 14: Sicherungszession; | |
| • der Eigentumsvorbehalt
→ KAPITEL 8: Eigentumsvorbehalt
als Warensicherungsmittel. | |
II. Das
Zurückbehaltungsrecht: § 471 ABGB | |
Das ABGB von
1811 kannte das Zurückbehaltungsrecht noch nicht. Das von Zeiller
in den Ur-Entwurf eingefügte Retentionsrecht wurde in der Revision
des ABGB wieder gestrichen. Pratobevera hatte auf dessen missbräuchliche
Verwendung in Galizien hingewiesen. – So gelangte das Zurückbehaltungsrecht
erst durch die III. TN (Vorbild: § 273 Abs 2 dtBGB) ins ABGB, wo
es nunmehr in § 471 geregelt ist. | |
| |
Mit Gschnitzer
ist das Zurückbehaltungsrecht als dingliches Recht anzusehen;
Sachenrecht 235 (19852): Es haftet
an der Sache! | Dingliches Recht |
In der Rechts- und Wirtschaftspraxis spielt das Zurückbehaltungs-
oder Retentionsrecht keine allzu große Rolle. Allein es ist für
manche Konstellation praktisch. – Beim Zurückbehaltungsrecht spielt das
(Rechts)Prinzip der Gegenseitigkeit, das wir in
Kapitel 2 ( → KAPITEL 2: Zug
um Zug-Leistung) kennen gelernt haben, eine funktional
wichtige Rolle → Druckmittel
| |
2. Gesetzliche
oder vertragliche Begründung | |
Das
Zurückbehaltungsrecht besteht schon kraft Gesetzes.
Es kann aber auch vertraglich begründet werden;
vgl SZ 55/112 (1982) → Mehr
zum Pfandrecht Nach
dem Gesetz dient es – dem Pfandrecht vergleichbar – der Sicherung
einer (fälligen) Forderung. – Neben der gesetzlichen Regelung in
§ 471 kennt das ABGB noch weitere Anordnungen; vgl § 970c ABGB → KAPITEL 3: Zurückbehaltungsrecht
¿ § 970c ABGB. | |
§ 471 ABGB Abs 1 bestimmt:
„Wer zur Herausgabe einer Sache verpflichtet ist, ... kann sie zur
Sicherung seiner fälligen Forderung wegen des für die Sache gemachten
Aufwandes oder des durch die Sache ihn verursachten Schadens mit
der Wirkung zurückhalten, daß er zur Herausgabe nur gegen die Zug
um Zug zu bewirkende Gegenleistung verurteilt werden kann.” | |
Abs
2 unserer Bestimmung legt fest, dass ein „Zurückbehaltungsrecht
... durch Sicherheitsleistung abgewendet werden”
kann. | |
 | |
3. Anwendung auf
bewegliche und unbewegliche Sachen | |
Die weite Formulierung des Gesetzestextes – „… Herausgabe einer
Sache …” – gestattet es, das Zurückbehaltungsrecht auf bewegliche und unbewegliche
Sachen anzuwenden. Das tut die Praxis auch; vgl SZ 48/9
(1975): Liegenschaftsschenkung der Ehegattin an ihren Gatten im
Rahmen der Eheschließung → KAPITEL 5: Ungerechtfertigte
Bereicherung.
Nach dem HHB 80 (III. TN) ist es aber auf körperliche Sachen beschränkt.
Dafür spricht auch der Regelungsort im Sachenrecht; systematische
Interpretation. | |
| |
Das
Zurückbehaltungsrecht des ABGB dient als Druckmittel, darüber hinaus
aber auch zur Beweissicherung; es gewährt aber kein
Befriedigungsrecht wie das Pfandrecht. – Anders das handelsrechtliche
Retentionsrecht der §§ 369 ff HGB; nach § 370 HGB kann dieses auch
wegen nicht fälliger Forderungen geltend gemacht werden kann. | |
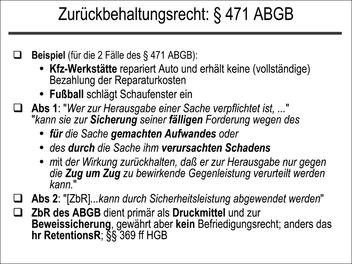 | Abbildung 15.32: Zurückbehaltungsrecht: § 471 ABGB |
|
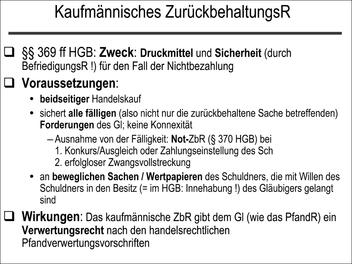 | Abbildung 15.33: Kaufmännisches ZurückbehaltungsR |
|
III. Das
Bauträgervertragsgesetz / BTVG | |
Von Wiltrud Priglinger | |
Ein wichtiges
SicherungsG der jüngsten Vergangenheit ist das
BauträgervertragsG /
BTVG 1997, BGBl I 7. – Das BTVG findet auf den Kauf von zu errichtenden
oder durchgreifend zu erneuernden Eigentumswohnungen und Reihenhäusern
Anwendung. –
Bauträger ist,
wer sich verpflichtet, einem Erwerber die angeführten Rechte einzuräumen.
Bauträger kann jede natürliche oder juristische Person sein, wobei
es auf eine Gewerbsmäßigkeit nicht ankommt. – Die Anwendbarkeit des
BTVG ist zusätzlich daran geknüpft, dass der Erwerber vor der Fertigstellung
vereinbarungsgemäß Zahlungen von mehr als 145 /m² Nutzfläche zu
leisten hat. – Ziel des BTVG ist der Schutz der
Käufer vor dem Verlust ihrer Vorleistungen im Fall der Insolvenz
des Bauträgers. Wesentlich ist, dass die Bestimmungen des Bauträgervertragsgesetzes
nicht zum Nachteil des Erwerbers abbedungen werden können, wenn
dieser Verbraucher (§ 1 Abs 1 Z 2 KSchG) ist; zwingendes Recht. | Voraussetzungen und Ziele |
Die Nichteinhaltung des
BTVG wird mehrfach sanktioniert. So ist der Bauträgervertrag gemäß
§ 4 Abs 1 Z 5 BTVG relativ nichtig, wenn er nicht eines der im BTVG
vorgeschriebenen Sicherungsmodelle oder eine gleichwertige Sicherung
beinhaltet; dazu gleich mehr. Der Erwerber kann gemäß § 14 Abs 1
BTVG sämtliche Leistungen hoch verzinst zurückfordern, die er entgegen
den Bestimmungen des BTVG erbracht hat. Überdies begeht der Bauträger,
der Zahlungen entgegen dem BTVG vereinbart, fordert oder entgegennimmt,
eine Verwaltungsübertretung und es drohen ihm Geldstrafen bis zu
28.000 ı; §§ 17 BTVG. | Sanktionen |
Trotz dieser Sanktionen werden laut Auskunft
des Vereines für Konsumenteninformation die Bestimmungen des BTVG
häufig nicht eingehalten, oder es wird versucht, das BTVG zu umgehen → KAPITEL 11: Die
(Gesetzes)Umgehung. | |
| |
Der
Bauträgervertrag bedarf nach § 3 BTVG der Schriftform. | |
In
§ 4 BTVG wird der Mindestinhalt eines Bauträgervertrags vorgeschrieben;
danach müssen geregelt sein: | Mindestinhalt |
| • der bestimmt bezeichnete
Vertragsgegenstand samt Plänen und Ausstattungsbeschreibung, | |
| • das vom Erwerber zu zahlende Entgelt und dessen
Fälligkeit, | |
| • der späteste Übergabetermin, | |
| • die vom Erwerber allenfalls zu übernehmenden
Lasten, | |
| • die Art der Sicherung des Erwerbers (dazu sogleich)
und | |
| • die Person des beim grundbücherlichen (§§ 9,
10) und pfandrechtlichen Sicherungsmodell (§ 11) zu bestellenden
Treuhänders. – Es kann dies nur ein Notar oder Rechtsanwalt (und
eine Rechtsanwalts-Partnerschaft) sein. | |
Werden
die angeführten Punkte nicht in den Bauträgervertrag aufgenommen,
so steht dem Erwerber gemäß § 5 BTVG die Möglichkeit des Rücktritts
von seiner Vertragserklärung zu, die innerhalb einer Woche ab Erhalt
einer Kopie des Vertrags und der Belehrung über das Rücktrittsrecht
ausgeübt werden kann. | Rücktrittsrecht |
| |
§ 7 BTVG sieht vor, dass
die Sicherung entweder: | § 7 BTVG |
| •
durch schuldrechtliche Sicherung
(§ 8 BTVG), | |
| • durch grundbücherliche Sicherstellung
des Rechtserwerbs auf der zu bebauenden Liegenschaft iVm der Zahlung
nach Ratenplan (§§ 9 und 10 BTVG) oder | |
| •
durch pfandrechtliche Sicherung
(§ 11 BTVG) erfolgen kann. | |
Die Bestimmungen über die Sicherungspflicht gelten aber
auch dann als erfüllt: | |
| • wenn eine inländische Gebietskörperschaft Bauträger
ist oder dem Erwerber für seine allfälligen Rückforderungsansprüche
unmittelbar haftet (§ 7 Abs 6 Z 1 und 2 BTVG); oder | |
| • wenn eine inländischen Gebietskörperschaft
eine den §§ 7 ff BTVG gleichwertige Sicherheit leistet,
die insbesondere in Förderungsregelungen vorgesehen ist, deren Einhaltung
von der Gebietskörperschaft überwacht wird (§ 7 Abs 6 Z 3 BTVG);
oder | |
| • bei Einrichtung eines
Treuhand-Baukontos (§
7 Abs 6 Z 4 BTVG). | |
Diese Aufzählung
ist demonstrativ. – Entscheidend ist, dass der
Sicherungszweck erfüllt ist. | Demonstrative Aufzählung |
Vor Vorliegen einer tauglichen
Sicherung werden Ansprüche des Erwerbers nicht fällig.
– Die Sicherungspflicht des Bauträgers endet mit
der tatsächlichen Übergabe des fertiggestellten Vertragsobjekts
und der Sicherung der Erlangung der vereinbarten Rechtsstellung
des Erwerbers. | Fälligkeit |
3. Das
schuldrechtliche Sicherungsmodell des § 8 BTVG | |
Das schuldrechtliche
Sicherungsmodell ist in erster Linie darauf ausgerichtet, dass der
Erwerber im Insolvenzfall des Bauträgers seine Investitionen rasch
und zur Gänze zurückbekommt; „ Geld-zurück-Garantie”.
– Die Bankgarantie ist die in der Praxis häufigste Sicherungsvariante.
Die Bankgarantie ist ihrem Wesen nach materiell abstrakt; dazu → Garantievertrag
und Bankgarantie Wichtig
ist, dass die Sicherstellung auch die rückständigen Zinsen für drei
Jahre in Höhe von 6 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz umfassen
muss. | „Geld-zurück-Garantie” |
4. Das grundbücherliche Sicherungsmodell
des § 9 BTVG | |
Das grundbücherliche Sicherungsmodell kommt nur in Betracht,
wenn der Bauträgervertrag auf den Erwerb des Eigentums, Wohnungseigentums oder
des Baurechts gerichtet ist. | |
Mit der bücherlichen Sicherstellung gemäß
§ 9 BTVG ist das nach Bauabschnitten prozentual festgelegte Zahlungsschema,
der Ratenplan gemäß § 10 BTVG, untrennbar verbunden. Der Ratenplan
sieht die einzelnen Bauabschnitte, bei denen eine Rate fällig gestellt
werden kann, zwingend vor. Die Ratio der grundbücherlichen Sicherung
liegt darin, dem Erwerber durch eine rangwahrende Anmerkung
im Grundbuch (zB § 40 Abs 2 WEG- Anmerkung) die Verschaffung der
vertraglich vereinbarten Rechte an der Liegenschaft zu sichern.
Die bezahlten Beträge sollen dem Erwerber als Wertzuwachs seines
Grundstücks letztlich wirtschaftlich zugute kommen und seine Rückforderungsansprüche
– sollte das Bauwerk nicht fertiggestellt werden können – sollen im
Fall der Versteigerung der Liegenschaft zum größten Teil Deckung
finden. | §
9 BTVG |
§ 40 Abs 2 WEG regelt, dass der WE-Organisator
vor der Anmerkung der Zusage der Einräumung von Wohnungseigentum
Zahlungen weder fordern noch annehmen darf. Das Verbot wird durch
einen Anspruch auf Rückforderung und spürbare Verzinsung des Kapitals
effektuiert und geht insofern seit dem WEG 2002 mit dem BTVG konform. | |
Es ist bei
dieser Sicherung verpflichtend, einen Treuhänder zu
bestellen, der über die wesentlichen Vertragsinhalte, vor allem
über die Belastungen und die Art der Sicherung in rechtlicher Hinsicht zu
belehren hat und die Einhaltung des Ratenplans überwachen soll;
Belehrungs- und Überwachungstreuhänder, nicht Abwicklungstreuhänder. |
Treuhänderbestellung |
Das
grundbücherliche Modell stellt jedoch keineswegs sicher, dass der
Käufer im Fall der Insolvenz des Bauträgers mit
vertretbarem Kostenaufwand die Fertigstellung „seiner Wohnung” durchsetzen
können wird. Sollte eine Fertigstellung scheitern, muss der Käufer
zur Rückgewinnung seiner eingezahlten Beträge seine Liegenschaftsanteile verwerten,
was im Regelfall zu weiteren Kosten führen wird. | Insolvenz des Bauträgers |
Das pfandrechtliche Sicherungsmodell und
das
Baukontomodell sind
aus praktischer Sicht nicht zu empfehlen und werden in der Praxis
auch nie vereinbart. | |
| |
Von Viktor Thurnher | |
Die Treuhand ist ein uraltes Rechtsinstitut, das seit Jahrtausenden
in der Rechtspraxis Anwendung findet. Auch heute erfüllt die Treuhand
außerordentlich wichtige Funktionen im täglichen Rechts- und Wirtschaftsleben.
In zahlreichen Anwendungsfällen wurde die Treuhand gesetzlich
verankert: zB § 225a Abs 2 AktG: Treuhändige Abwicklung
der Anteilsübertragung bei einer Verschmelzung, vgl auch § 2 UmwG
oder § 114 Abs 4 AktG: Ermächtigung der Bank, die Stimmrechte aus
den in ihren Depots liegenden Aktien wahrzunehmen. – In anderen
Fällen hat sich die Kautelarpraxis des Instituts
der Treuhand bedient und überaus nützliche Konstruktionen entwickelt. | |
1. Weiter Anwendungsbereich | |
So wird
etwa ein Großteil der Liegenschaftstransaktionen,
insbesondere bei Fremdfinanzierung, unter Einschaltung eines Treuhänders
abgewickelt; zum Liegenschaftskauf → KAPITEL 2: Besonderheiten
des Liegenschaftskaufs.
Da aufgrund der für den Eigentumsübergang erforderlichen Eintragung
in das Grundbuch das Zug-um-Zug-Prinzip nicht (so einfach) eingehalten
werden kann, soll der Treuhänder den für alle Beteiligten mit Unsicherheiten
behafteten Zeitraum überbrücken, indem er zB den Kaufpreis treuhändig
übernimmt, die für die grundbücherliche Durchführung erforderlichen
Urkunden und Erklärungen einholt und nach Eintragung der Rechtsänderungen
den Kaufpreis an den Verkäufer aushändigt. | Liegenschaftstransaktionen |
 | |
 | |
Judikaturbeispiele belegen aber auch, dass
auch „untreue” Treuhänder tätig werden. | |

|
OGH 7.9.2000, 8 Ob 13/99s, JBl 2001, 175:
A wendet sich an die Bank B und begehrt einen Kredit zur Finanzierung
des Erwerbs einer Eigentumswohnung. B räumt den gewünschten Hypothekarkredit
ein. Im Gegenzug soll ein Höchstbetragspfandrecht im ersten Rang
auf der zu erwerbenden Liegenschaft einverleibt werden. Der vom
Verkäufer (V) der Liegenschaft bestellte Treuhänder T übernahm die
Kreditvaluta mit dem Auftrag, diese für Rechnung des A an den V
zu zahlen, sobald die für die grundbücherliche Durchführung der
Eigentumsübertragung und der Pfandrechtsbestellung erforderlichen
Urkunden vorliegen. Nach Unterzeichnung des Kaufvertrags und der
Kreditvereinbarung überwies B die Kreditvaluta an T. „In der Folge
ist der Treuhänder mit dem von [B] an ihn überwiesenen Betrag verschwunden,
ohne die genannten Aufträge ausgeführt zu haben”. Entgegen seiner
früheren Rspr nimmt der OGH nunmehr – zutreffend – eine gleichmäßige
Risikoverteilung unter den beteiligten Parteien vor. Eine eindeutige
Zuordnung des Vermögens während der Abwicklung der Treuhandschaft
sei ausgeschlossen, die treuhändige Abwicklung erfolge im Interesse
aller Beteiligten, daher haben sie auch gemeinsam das Risiko zu
tragen. | |
|
Auch bei gesellschaftsrechtlichen
Abwicklungen werden häufig Treuhänder eingeschaltet, sei
es zur Vermeidung unerwünschter Steuernachteile, sei es um die wahren
wirtschaftlichen Berechtigten (Handelnden) nicht offen zu legen,
sei es aus Vereinfachungsgründen (etwa zur Bündelung von Unterbeteiligungen
an Mitunternehmeranteilen). | Gesellschaftsrecht |
Neben
diesen zahlreichen legalen und durchaus zweckmäßigen Anwendungsfällen
der Treuhand, wird dieses Institut jedoch auch zur
Gesetzesumgehung eingesetzt;
dazu → KAPITEL 12: Geschäftsbesorgung. Die vertraglichen Regelungen sind in solchen
Fällen zumeist mit Nichtigkeitssanktion bedroht: zB Erwerb einer
Liegenschaft durch einen Treuhänder, um die grundverkehrsrechtliche
Genehmigung zu erlangen; Übernahme eines Gesellschaftsanteils durch
einen Treuhänder, weil der Treugeber bei einer direkten Beteiligung
gegen ein Wettbewerbs- oder Konkurrenzverbot verstoßen würde; Erwerb
einer geförderten Eigentumswohnung durch einen „förderungswürdigen” Treuhänder
für Rechnung eines „förderungsunwürdigen” Treugebers. | Gesetzesumgehung |
2. Anwendungsfall
der Geschäftsbesorgung | |
Die
Treuhand ist ein Anwendungsfall der Geschäftsbesorgung ( → KAPITEL 12: Der
Auftrag).
Ihr liegt also ein Auftrag des Treugebers an den
Treuhänder zu Grunde, Rechte des Treugebers im eigenen Namen aber
auf der Grundlage der vertraglichen Bindung (
Treuhandabrede)
auf bestimmte Weise auszuüben. – Werden dabei die Rechte auf den
Treuhänder übertragen spricht man von einer
Vollrechtstreuhand (Fiduzia). Wird der Treuhänder
hingegen nur ermächtigt, liegt sog
Ermächtigungstreuhand vor.
Im Rechtsleben überwiegt die Fiduzia. | Arten der Treuhand -Treuhandabrede |
Der Treuhänder
hat im Hinblick auf das ihm anvertraute Treuhandgut eine Rechtsposition,
die über den mit der Treuhandabrede verfolgten Zweck hinaus reicht.
Er hat also überschießende Rechtsmacht: „Er kann mehr, als er darf.”
Dieses „fiduziarische Element” findet sich aber auch in anderen
Rechtsinstituten; etwa bei der Verwahrung, der Kommission, der Leihe
etc. Bei manchen Geschäften tritt dieses Element so stark in den
Vordergrund, dass man von Anwendungsfällen der Treuhand spricht;
etwa bei der Sicherungsübereignung ( → KAPITEL 8: Die
Sicherungsübereignung)
und der Sicherungsabtretung (Sicherungszession → KAPITEL 14: Sicherungszession). | Überschießende Rechtsmacht |
Da
bei diesen Geschäften die Sicherungsfunktion im Vordergrund steht,
die auch (oder vielleicht überwiegend) im Interesse des Sicherungsnehmers
(Treuhänders) steht, spricht man in diesem Zusammenhang auch von
eigennütziger
Treuhand im Gegensatz zur herkömmlichen
fremdnützigen
Treuhand, bei der die Wahrnehmung der Interessen des Treugebers
durch den Treuhänder im Vordergrund steht. | Eigennützige und fremdnützige Treuhand |
3. Unterscheidung
von „formeller” und „materieller” Berechtigung | |
Charakteristisch bei der Treuhand ist das Auseinanderfallen
von Rechtszuständigkeiten zwischen dem „formal” berechtigten
Treuhänder und dem „materiell” oder „wirtschaftlich” berechtigten
Treugeber. Augenscheinlich wird das Problem im Fall der
Insolvenz
des Treuhänders. Das nach außenhin dem Treuhänder zustehende
Vermögen zählt nicht zur Befriedigungsmasse seiner Gläubiger. Der
Treugeber hat Anspruch auf Aussonderung (im Fall der Exekutionsführung
gegen den Treuhänder: Exzindierung → Die Treuhand)
seines Eigentums und zwar unabhängig davon, ob für die Gläubiger
erkennbar war, dass es sich um „Eigentum” des Treugebers handelte
( offene
Treuhand) oder nicht ( verdeckte Treuhand;
Durchbrechnung des sachenrechtlichen Publizitätsgrundsatzes). | |
4. Abgrenzung der
Treuhand von anderen Rechtsinstituten | |
Die Abgrenzung der Treuhand von anderen Rechtsinstituten
(Stellvertretung, Verwahrung) bereitet im Allgemeinen keine Schwierigkeiten.
Eine Abgrenzung von der mittelbaren Stellvertretung ( → KAPITEL 13: Die
indirekte Stellvertretung)
kann in Wahrheit nicht gelingen, weil idente Sachverhalte vorliegen: Auch
der mittelbare Stellvertreter nimmt fremde Rechte im eigenen Namen
wahr; er „unterscheidet” sich vom Treuhänder nur durch eine andere
Bezeichnung. Auch der
Strohmann ist typischer Treuhänder. | |
Unerfindlich
ist daher, warum ein Aussonderungs- und Exszindierungsanspruch des
(mittelbar) Vertretenen gegen die Gläubiger des mittelbaren Stellvertreters
von der Rspr verwehrt wird, während die Ansprüche auch des verdeckten
Treugebers gegenüber den Gläubigern des Treuhänders gewahrt werden.
Diese Diskrepanz in der Judikatur blieb bislang unbegründet. | Ungereimtheiten in der Rspr |

|
GesRZ 1978, 30: Eine Bank gewährte Autoreparaturkredite.
Die Forderungen gegen die Kreditnehmer wurden zu 100 % als Forderungen
der Bank gegen die jeweiligen Kreditnehmer verbucht. Die Kreditmittel stammten
aber nur zu 50 % von der Bank, die restlichen 50 % kamen von der
A-KG. Die Kredite wurden ausnahmslos im Namen der Bank gewährt,
die A-KG schien den Kreditnehmern gegenüber nicht auf. Die Bank
verfiel in Konkurs, die A-KG begehrte die Aussonderung von 50 %
der von der Bank (Gemeinschuldnerin) eingezogenen Kreditforderungen.
Der OGH ging vom Bestand einer Innengesellschaft aus und meinte,
eine solche könne sich nicht durch einen Bevollmächtigten vertreten
lassen. Daher komme nur indirekte Stellvertretung in Frage. Der
indirekte Stellvertreter erwerbe aber nur für sich, nur er würde persönlich
berechtigt und verpflichtet. Die an die Bank rückfließenden Beträge
seien daher in ihr Alleineigentum gelangt und nicht aussonderungsfähig. | |
|
|
|
RdW 1990, 911: Eine Liegenschaft
wurde exekutionsweise versteigert. A ging mit Exzindierungsklage gegen
das Exekutionsverfahren vor und machte geltend, dass der Liegenschaftseigentümer
S diese aufgrund der vor einigen Jahren abgeschlossenen Treuhandvereinbarung
nur als Treuhänder des A erstanden habe. Der OGH gesteht dem Treugeber
den Exzindierungsanspruch zu, stellt allerdings Anforderungen an den
Nachweis des Bestands des Treuhandverhältnisses. | |
|
|
|
BGH, ZIP 1993, 1185: Die Ehegattin hat
ein Widerspruchsrecht gegen die Zwangsvollstreckung in ein
Bankkonto ihres Ehemannes, wenn der Mann das Konto als
Treuhandkonto für Rechnung seiner Gattin führt: „Für das Widerspruchsrecht
des Treugebers nach § 771d ZPO (= § 37 EO) ist die Publizität des
Treuhandkontos … nicht zwingend erforderlich”. Dem BGH genügt bereits,
wenn an den Nachweis des Treuhandverhältnisses „nicht nur verbal,
sondern tatsächlich strenge Anforderungen gestellt werden”. | |
|
 | |
| |
 A. (Privat)Rechtliche Sicherungsmittel A. (Privat)Rechtliche Sicherungsmittel |
 C. Sicherungsmittel
iwS C. Sicherungsmittel
iwS |
| |

