Kapitel 18 | |
| |
| |
| |
Die Kapitel 18 und 19
wurden für diese Auflage neu gestaltet. Punkt B. des alten Kapitels
18, er behandelte die Rechtsdurchsetzung (ZPO, EO, KO, AO etc),
wurde zum neuen Kapitel 19. Neu in das Kapitel 18 dieser Auflage
aufgenommen wurden die Fragestellungen „Rechtswissenschaft als Sozialwissenschaft?”
sowie eine Teilfrage aus diesem Kontext: die „Rechtstatsachenforschung”. Sie
bilden nunmehr Punkt B. dieses Kapitels. Dieser Punkt fragt nach
dem Verhältnis der Rechtswissenschaft zu den benachbarten Sozialwissenschaften
und plädiert für eine substanzielle – dh inhaltliche wie methodische
– Öffnung des Rechtsdenkens gegenüber diesem wichtigen nachbarlichen
Wissenschaftsbereich. Das erscheint auch dadurch gerechtfertigt,
weil der (Mit)Begründer der modernen Rechtssoziologie und Rechtstatsachenforschung
der Österreicher Eugen Ehrlich war. – Der neue Punkt C. (dieses
Kapitels) enthält (wenngleich aus Platzgründen weitgehend nur als
internet-link) einen Abriss zur lehrreichen, wenngleich umstrittenen
Thematik der Organtransplantation, an der sich rechtsphilosophische,
rechtsethische, aber auch genuin rechtliche Fragestellungen darlegen
und studieren lassen. Anhand dieser medizinrechtlichen Fragestellung
wird auf den auch für andere Fragestellungen wichtigen Zusammenhang
von Weltbild, Menschenbild und Menschenwürde eingegangen; interdependente
Begriffe, die mehr als bloße Begriffe sind. Denn die Rechtsphilosophie
– unter deren Ägide das gesamte Kapitel steht – will im Rahmen des
Rechtsdenkens das Erkennen tieferer Zusammenhänge fördern, will
Durchblicke schaffen, was in unseren komplizierten Gesellschaften
der Moderne immer schwieriger wird und von Herrschenden nicht gefördert
wird. So ist es nicht als Zufall anzusehen, dass im Rahmen der ideologisierenden
Privatisierung in Österreich auch die „Statistik der Rechtspflege”
aufgegeben wurde und wir künftig weder über ernstzunehmende „facts”
noch „figures” unseres Rechtswesens verfügen werden, wodurch die
ohnehin schwach entwickelte Selbsterkenntnis der Rechtswissenschaft
und der Rechtspraxis erneut leiden wird. Das Land Eugen Ehrlichs
ist nun endgültig zum rechtstatsächlichen Entwicklungsland geworden,
das über sich und seine Entwicklung nichts mehr oder doch nur mehr
wenig wissen will. Für die Politik ist das bequem, für die Wissenschaft
dagegen fatal! | Überblick |
Da ich während meines Studiums kaum etwas substantielles
über Rechtsphilosophie und die Gerechtigkeit hörte und auch das
Studium der Rechtswissenschaft heute eine klare Orientierung an der
Rechtsidee (der Gerechtigkeit) vermissen lässt und zudem das dafür
nötige Fächerangebot immer mehr zurückgedrängt oder nunmehr im neuen
Bereich des (Innsbrucker) Wirtschaftsrechts sogar ganz beseitigt
wird, soll diesem Kapitel ein kleiner Exkurs zu dieser Herausforderung
und Leitvorstellung des Rechtsdenkens insgesamt und des Privatrechts
im besonderen vorangestellt werden. Dabei wird auch auf die wichtigen
begrifflichen und inhaltlichen Versatzstücke des Gerechtigkeitsdenkens,
nämlich Rechtsbegriff und Rechtsidee, eingegangen (A.). – Ist es
nicht bezeichnend, dass diese wichtige Orientierungsmarke jeder
Gesellschaft, die Gerechtigkeit nun einmal ist, auch bei bedeutenden
und grundlegenden (innen)politischen Debatten wie der sogenannten
Pensionsreform gar nicht mehr auftaucht und bestenfalls marginale
Erwähnung findet? – Das mit dieser Auflage neu konzipierte Kapitel
18 ist aber keineswegs abgeschlossen, sondern soll vielmehr, wenn
sich die Möglichkeit dazu bietet, künftig wachsen und weitere Fragestellungen
aufnehmen. Die Internetvariante des Lehrbuchs bietet hier (über
„links“) neue Möglichkeiten. Denn nur eine lebendige Rechtswissenschaft,
die auf der Höhe ihrer Zeit steht, vermag die vielfältigen Aufgaben
ihrer gesellschaftlichen Verantwortung zu erfüllen. Rechtsdogmatik
allein vermag das nicht. – Sowohl die Rechtsphilosophie, als auch
sozialwissenschaftliche Disziplinen wie die Rechtstatsachenforschung
und die Rechtssoziologie dienen der Selbsterkenntnis der Rechtswissenschaft, was
auch für neue Zweige des Rechtsdenkens gilt; zB das Alten- oder
Medizinrecht, die zwar nicht in diesem Kapitel, aber doch im Lehrbuch
angesprochen werden. | |
A.
Recht und Gerechtigkeit |
 | |
Nachdenken
über Recht bedeutet, nachzudenken über den Menschen,
seine Ziele, Wünsche und Hoffnungen, aber insbesondere auch über
den Zusammenschluss der Menschen in Staat und Gesellschaft,
was heute wie früher nur möglich ist, wenn das Individuum Rechte
an diese übergeordnete Gemeinschaft abtritt und der Staat sich grundsätzlich
als Rechts-Staat ( → KAPITEL 1: Der Rechtsstaat)
versteht. Denn das Recht ordnet und vermittelt zwischen dem Ganzen
und seinen Teilen, den Einzelnen und der Gesellschaft. | Nachdenken über Recht |
Interesse am Recht verlangt daher nach
lebendiger Anteilnahme an Staat, Gesellschaft und Politik, was nicht
gleichbedeutend damit ist, selbst politisch tätig zu sein. Diejenigen
aber, die mit dem Staate und dem von und in ihm geschaffenen Rechte
(beruflich) zu tun haben, sollten sich auch dafür interessieren,
was das Recht (eigentlich) ist, wie es entsteht, sich wandelt, angewandt
wird und vergeht; kurz: welche Aufgaben es im Staate wahrzunehmen
hat und was es für die Einzelnen bedeutet. Mit diesem Hinterfragen
von Recht sind wir bei der
Rechtsphilosophie angelangt,
die über diesem Kapitel steht und die nicht zufällig aus zwei Wortteilen
zusammengefügt wurde: „ Recht” und „ Philosophie”.
Rechtsphilosophie ist nichts anderes, als Philosophie, die auf das Recht
angewandt wird; ist logisches, analytisches, aber auch (rechts)historisches,
(rechts)vergleichendes und – nicht zuletzt – rechtspolitisches (Nach)Denken
über das Recht. Es ist ein Rechtsdenken in philosophischer Tradition,
also einer Tradition von der die Rechtswissenschaft im antiken Griechenland
ihren Ausgang genommen hat. Philosophie, als Liebe zur Weisheit
und zur Erkenntnis von allem, was für den Menschen von Bedeutung
ist, meint, auf das Recht angewandt, dessen Regeln und Abläufe,
die „Gesellschaft” erst möglich machen, zu verstehen, zu hinterfragen und,
wenn nötig, zu kritisieren, um sie verbessern und umgestalten zu
können. Man könnte auch sagen: Rechtsphilosophie ist das
Gewissen, das sokratische Daimonion, des Rechts;
oder sollte es doch sein. Rechtsphilosophie hat sich nämlich immer
wieder Klarheit darüber zu verschaffen, ob das Recht einer Gemeinschaft
jene hohe Aufgabe erfüllt, auf die schon kurz hingewiesen wurde: Gesellschaft
möglich zu machen, was stets auch bedeutet, die Einzelnen zu fördern,
um ihre Menschwerdung, als Ziel unseres Menschseins, angemessen
zu unterstützen. Sie hat aber auch Anteil zu nehmen an der rechtlichen
Gestaltung der Gesellschaft und das wissenschaftliche Rechtsdenken
als Ganzes zu leiten, wie uns das die Griechen der Antike als Begründer
des europäischen Rechtsdenkens gelehrt haben. Rechtsphilosophie
sollte sich daher auch zu aktuellem Geschehen äußern. Und zwar grundsätzlich
zu allem, was in einer Gesellschaft geschieht, das von gewisser Bedeutung
ist. Vor allem aber zu rechtlichen und politischen Vorgängen in
einer Gemeinschaft. Zum Wohle des Ganzen und seiner Teile. Denn
nahezu alles, was in einer Gesellschaft geschieht, wirkt auf jene
Regeln ein, die eine Gesellschaft zusammenhalten, konstituieren,
eben das Recht. Jüngste Entwicklungen erzwingen dies beinahe; Stichworte
dazu müssen hier genügen: akzelerierter gesellschaftlicher Wandel
und eine zunehmende Bedrohung der Umwelt, der Arbeitswelt, neue
Möglichkeiten und Gefahren der Bio- und Informationstechnologie,
aber auch Gefährdungen von Demokratie und Rechtsstaat durch eine
rücksichtslose Machtpolitik auf nationaler wie auf internationaler
Ebene uvam. Denn wir alle wissen, dass Entwicklungen nicht immer
nur zum Guten führen (können), weil der Mensch nicht nur selbstlos
und gemeinschaftsförderlich denkt und handelt, sondern auch selbstsüchtig
persönliche oder Gruppenziele verfolgt. Macht, Einfluss, Geld, aber
auch das Recht und seine Möglichkeiten, stellen für ihn (und alles
was er geschaffen hat), immer wieder Verlockungen dar, die das Ganze,
wie seine Teile gefährden und manipulieren können. Aufgabe der Sozialnormen in einer Gesellschaft,
zu denen das Recht gehört ( → KAPITEL 1: Sitte
/ Brauch, Moral <-> Recht: Sozialnormen),
ist es, diese gesellschaftlichen Gefährdungen von Teil und Ganzem zu
erkennen und idF dagegen ankämpfen zu können. Vor einem solchen
Hintergrund nimmt es sich anders aus, wenn ein Finanzminister von
einer mächtigen und vermögenden Interessenvereinigung eine hohe
Summe erhält, um damit seine Homepage zu finanzieren, mag dafür
auch ein eigens gegründeter Verein zuständig sein. | Rechtsdenken
und Philosophie |
Was im alten Griechenland und
in Rom, die uns in vielem immer noch als Vor-, aber auch als Zerrbild
dienen können, noch selbstverständlich war – nämlich sich handelnd
für die Gemeinschaft einzusetzen, ist es heute längst nicht mehr,
weshalb es in Erinnerung gerufen werden soll. Denn von einem Rückzug
in den privaten Schmollwinkel profitieren gerade jene,
die meinen den Staat rücksichtslos für ihre Zwecke instrumentieren
und ausbeuten zu können. – Ratsam für den Kontakt mit der nicht
nur für Juristen/innen wichtigen Rechtsphilosophie erscheint auch
die Lektüre von Primärliteratur. Daher die Hinweise auf Platon,
Aristoteles, Kelsen und andere. | Sich für die
„Gemeinschaft“ einsetzen |
Wichtig
erscheint es aber auch, die Anliegen der Rechtsphilosophie
ins Privatrecht zu tragen und hier mehr als bisher über
grundlegende Fragen des Rechts nachzudenken. Zu fordern ist daher eine
„
Privatrechtsphilosophie“,
denn auch das Privatrecht sollte sich nicht mit blosser Rechtsdogmatik
und steriler Systematik zufrieden geben. Ein Schuss
Ideologiekritik kann
dabei ebensowenig schaden, wie – über die Philosophie hinaus, Rechtsgeschichte,
Rechtsvergleichung und eine sozialwissenschaftliche Betrachtung
privatrechtlicher Fragen. – Auch didaktisch wäre das von Vorteil,
zumal dadurch die Relativität rechtlicher Lösungen oder gar von
Theorie besser erkannt und dadurch Kritik und Diskussion gefördert
werden können. Diskursives Denken wird in der juristischen Ausbildung
ohnehin vernachlässigt. Nur auf die verba magistri zu
schwören ist langweilig. Nicht nur für Studierende. | Privatrechts-Philosophie |
I. Das Ziel des
Rechtsdenkens – Was will Rechtsphilosophie? | |
| |
Von Platon (Politeia 444c) stammt der schöne
Vergleich, dass die Gerechtigkeit für die Seele das sei, was die
Gesundheit für den Leib darstellt, und Ungerechtigkeit für die Seele
das bedeute, was Krankheit für den Leib. | |
Recht und Gerechtigkeit
haben aber auch zu tiefst mit den Grundwerten Freiheit, Gleichheit (vor dem Gesetz)
und dem Schutz
Schwacher zu tun. Erst ihr sinnvolles Verknüpfen weist den Weg zu einer
zeitgemäßen Annäherung an Gerechtigkeit. Anwendung und Verständnis
des Rechts leben zudem davon, dass eine korrekte Rechtsanwendung,
unabhängig von der Person und der Sache, um die es geht, gesichert
ist. Das meinte Karl Anton von Martini, wenn er
– was nicht als Härte oder Unmenschlichkeit missdeutet werden darf
– ausführte: | |
„Die Gesetze hingegen sind taub und unerbittlich;
bey ihnen gilt kein Ansehen der Person; sie schützen den Schwachen
gegen den Stärkern; von ihnen hat der Mächtigste keine Schonung
zu erwarten.” (Allgemeines Recht der Staaten. Zum Gebrauch der öffentlichen
Vorlesungen in den k. k. Staaten; Wien, 1799. Übersetzung der lateinischen Ausgabe
aus dem Jahr 1773.) | |
Schon für die sehr staatstragend denkenden alten Ägypter diente
der Staat vornehmlich dazu, um unter den Menschen Recht und Gerechtigkeit
zu verwirklichen. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Nur
unsere Vergesslichkeit ist grösser geworden. | |
Dazu J. Assmann,
Der Tod als Thema der Kulturtheorie (es 2157, 2000). | |
Heute
wird in der juristischen Ausbildung zu wenig Wert auf diese grundlegenden
Zusammenhänge gelegt, weil man glaubt, mit ökonomischem Wissen und
Werten, die durchaus ihren Stellenwert in der Ausbildung haben sollen,
das Auslangen finden zu können. Aber eine nur ökonomische Ausrichtung
des juristischen Denkens verkennt die Aufgabe der Juris-Prudenz und verrät
die Rechtsidee. | Juristen/innen brauchen mehr als „Ökonomie“ |
| |
Das
Vorwort des anregenden Bändchens von Theo Mayer-Maly, „Rechtsphilosophie”
(2001), beginnt mit der Feststellung: | Rechtsdenken – eine unendliche „Geschichte“ |
„In der Rechtsphilosophie geht es um die
Frage, warum Recht gilt und weshalb ein
bestimmter Satz als Rechtssatz gelten soll. Sie ist Nachdenken
über Rechtliches. Ihr Argumentationshorizont wird nicht einem bestimmten
geltenden Recht, sondern der Vernunft und der Erfahrung entnommen.” | |
Das lässt erahnen, dass das Thema Rechtsphilosophie eine unendliche ”Geschichte”
ist. Was aber nicht entmutigen sollte, mag man sich dabei auch wie
in dem von Augustinus stammenden Vergleich als kleiner Junge fühlen,
der, am Meeresstrande sitzend, das Meer ausschöpfen will. – Das Kapitel
will Interesse für grundlegende Fragen des Rechts wecken,
nicht mehr, aber auch nicht weniger. Nach Einsteins Zielsetzung
soll dabei alles so einfach wie möglich gesagt werden, aber eben
nicht einfacher. Rechtsphilosophie verlangt Hingabe an das
Rechtsdenken und als Teil der Philosophie, auch Liebe zu
deren Fragestellungen. Damit aber auch zur Rechtsgeschichte, Rechtsvergleichung,
Rechtstatsachenforschung und Rechtspolitik, also Disziplinen aus
denen die europäische Rechtswissenschaft im antiken Griechenland
entstanden ist. | |
II. Gerechtigkeit
und Gesellschaft – Die ‚Idee’ der Gerechtigkeit als ‚Rechtsidee’
| |
1. Zum Gerechtigkeitsverständnis | |
Gerechtigkeit spielt wenigstens dem
Namen nach in allen möglichen Bereichen moderner Gesellschaften
eine mehr oder minder wichtige Rolle: Die Ökonomie spricht – oder
sollte es tun – von
Verteilungsgerechtigkeit oder einem
gerechten Steuersystem; auch in der Gesundheitspolitik wäre
Gerechtigkeit gefordert; zB keine Zweiklassenmedizin, ein Recht
auf Gesundheit für alle, nicht nur für Zusatzversicherte und Reiche.
Und überhaupt wird, wenn auch immer seltener, gesellschaftspolitisch
soziale
Gerechtigkeit eingemahnt. Auf die Gerechtigkeit zurückgegriffen
wird mitunter auch in den Debatten um eine angemessene
Entwicklungshilfepolitik zwischen
dem reichen Norden und dem armen Süden, zwischen Jung und
Alt (sog Generationenvertrag, Renten- und Arbeitsmarktproblematik)
oder im Rahmen der Bemühungen um
Chancengleichheit
zwischen den Geschlechtern. | Erscheinungsformen
der Gerechtigkeit |
Gerechtigkeit ist
daher nicht nur eine „Frage” der Rechtswissenschaft,
sondern ein gesamtgesellschaftliches Anliegen, wenngleich viele
dieser Fragestellungen darauf hinauslaufen, die jeweils eingeforderte
Maßnahme mittels rechtlicher Programme umzusetzen. – Darin liegt
eine besondere wissenschaftliche Verantwortung der Rechtswissenschaft
als „Umsetzungsdisziplin“ für die Gesellschaft. | Auch andere Disziplinen interessieren sich für
die Gerechtigkeit |
 | |
2. „Rechtsidee” und „Rechtsbegriff” | |
Wenn
wir heute von der „Rechtsidee” sprechen und damit
die Orientierung des Rechts(denkens) am hohen Ziel der Gerechtigkeit
meinen, sollten wir uns des Umstandes bewusst sein, dass diesem Denken Platons Ideenlehre
zugrunde liegt, die in diesem Feld ihre Aktualität bewahren konnte.
Auf das Verhältnis von Recht und Gerechtigkeit passt in der Tat
Platons bildhafter Vergleich im 7. Buch seiner „Politeia” (Höhlengleichnis)
gut, wonach sich „Idee” und ihr „reales
Abbild” in der Wirklichkeit unterscheiden und das Abbild,
das Urbild nie zu erreichen vermag. – So verhält es sich auch mit
dem Recht und der Rechtsidee: Menschliches Recht vermag
bestenfalls gute Annäherungswerte an die Rechtsidee zu erreichen,
nicht aber diese selbst, denn das würde bedeuten, eine
absolute
Gerechtigkeit verwirklichen zu können. Das aber erscheint
– jedenfalls bis auf weiteres – unmöglich. Denn wie G. Radbruch
formulierte: | Rechtsidee und Rechtswirklichkeit |
„Recht ist Menschenwerk und kann wie jegliches Menschenwerk
nur aus seiner Idee begriffen werden”; Rechtsphilosophie 11. | |
Gustav Radbruch (1878-1949),
ein noch heute interessanter und bedeutender Rechtsdenker, schloss
daraus, dass „eine zweckblinde, d. h. wertblinde Betrachtung eines
Menschenwerks … unmöglich, und so auch eine wertblinde Betrachtung
des Rechts oder irgendeiner einzelnen Rechtserscheinung” ausscheide;
ebendort. – Radbruch geht auch auf den Rechtsbegriff ein,
der im Zusammenhang mit der Rechtsidee von Bedeutung ist und meint,
dass er „nicht anders bestimmt werden [könne] denn als die Gegebenheit,
die den Sinn hat, die Rechtsidee zu verwirklichen. Recht kann ungerecht
sein (summum
ius – summa iniuria), aber es ist Recht nur, weil es den Sinn hat, gerecht
zu sein.” Die Rechtsidee selber sei das „konstitutive Prinzip” und
zugleich „der Wertmassstab für die Rechtswirklichkeit”; aaO 12.
Die Rechtsidee sei eine Schöpfung menschlich „bewertenden Verhaltens”.
– Damit wird die Rechtsidee geschickt von praepositiven-transzendentalen
Bezügen freigehalten, ohne sie deshalb einem positivistischen Verständnis
auszuliefern. | Rechtsidee
und
Rechtsbegriff |
Andere
verstehen unter Rechtsidee, die
Lehre
vom
„richtigen Recht”; vgl K. Engisch, Auf der Suche
nach der Gerechtigkeit (1971), der dabei auf älteres Denken zurückgreift.
Es geht dabei um die „Suche nach Maßstäben, anhand
derer wir beurteilen können, ob das positive Recht (das heutigentags
meist als Gesetzesrecht in Erscheinung tritt und in ‚Geltung’ steht)
gut oder schlecht, bewahrungs- oder verbesserungswürdig, überhaupt
‚wahres’ Recht und nicht vielmehr bitteres Unrecht, ja darum womöglich
null und nichtig ist”; Engisch, aaO 187. Aus einer negativen Beurteilung
wäre wenigstens – so Engisch – eine Reformforderung ableitbar, die
dann ebenfalls der Rechtsidee zugehörte: | Lehre vom „richtigen Recht” |
„Nur ein extremer ‚Positivismus’, wie er
heute kaum noch anzutreffen ist …, wird die Frage nach der Rechtsidee, …
als müßig, sinnlos, für den Juristen uninteressant und höchstens
den Politiker angehend betrachten.” | |
Engisch meint auch, dass die Geschichte des philosophischen
Nachdenkens über das richtige Recht mit der Geschichte der
Rechtsphilosophie identisch sei; aaO 189. Allein es geht
wohl heute zu weit, ein solches Denken nur der Rechtsphilosophie
zu überlassen und das einfache juristische Denken davon zu dispensieren. | |
Schon
Studierende der Rechtswissenschaften sollten daher diese beiden
– wertungs- und erwartungsmäßig stark aufgeladenen – Begriffe, die
nicht nur für die Rechtsphilosophie von Bedeutung sind, kennen,
um sie im Bedarfsfall argumentativ verwenden zu können. Das gilt
für die (Rechts)Politik ebenso, wie für das praktische Rechtsleben
als Verwaltungsbeamter, Anwalt, Notar oder Richter. Und selbstverständlich
ist auch die Rechtswissenschaft gefordert, immer wieder Überlegungen
zur Rechtsidee anzustellen. – Das lehrt uns, dass die Rechtsphilosophie
auch einen praktisch-argumentativen Anwendungsbereich besitzt. Auch
in der Politik und der Rechtspraxis vermag uns das Begriffspaar
„Rechtsidee” und „Rechtsbegriff” eine Orientierungshilfe zu sein. Beide
Begriffe helfen auch dabei, die Zielsetzungen und die funktionale
Umsetzung des Rechtsdenkens einer Epoche zu ergründen; etwa den
Rechtsbegriff und die Rechtsidee im antiken Griechenland oder in
Rom oder zur Zeit der großen Privatrechtskodifikationen in der zweiten
Hälfte des 18. Jahrhunderts. | Praktisch-argumentativer Anwendungsbereich der Rechtsphilosophie |
Die
antike griechische Rechtsidee ist Teil eines bereits reifen Menschen-
und Weltbildes und im Spannungsfeld zwischen Einzelnem und Gemeinschaft
angesiedelt. Sie kann weder als idealistisch überhöht, noch als
bloß positivistisch nüchtern angesehen werden. Vielmehr versteht
sie den Menschen als Teil der Gemeinschaft und ist bestrebt, diese
um des Menschen willen zu stärken. Gegründet wird die griechische
Rechtsidee seit Solon
auf der unverrückbaren
Freiheit aller (Polis)Bürger, zu der
sich früh – nämlich schon seit Solon – für den Bereich des Privatrechts
die bürgerliche Rechtsgleichheit (
Isonomia) gesellt; und in der
Folge die Weichen in Richtung politische Gleichheit und Teilhabe
am politischen (Staats)Geschehen stellt. Das Recht duldet seit dieser Zeit
weder Verletzungen der körperlichen Unversehrtheit, noch der Ehre
(
Hybrisklage!),
zumal ein solches Verhalten nicht nur für den Einzelnen nachteilig,
sondern auch für die Gemeinschaft der Polis gefährlich und zerstörerisch
ist. Ein Aspekt der heute kaum mehr verstanden wird. Der Schutz
der
Menschenwürde ist
seit der Mitte des 5. Jahrhunderts v. C. (Perikles) weit entwickelt und
umfasst, anders als meist kolportiert, alles Menschliche (!): Freie
wie Sklaven, Frauen und Männer, Kinder und Alte, Griechen und Fremde
sowie Arm und Reich. Mögen vielleicht auch noch Anspruch und Wirklichkeit
noch nicht zur Deckung gelangt sein. Die junge athenische Demokratie benötigte
diesen egalitären Schutz, mag er auch schon nur wenige Jahrzehnte
später zunächst ins Wanken geraten und in der Folge vorübergehend
wieder fast ganz verloren gegangen sein. – Und die griechische Idee
vom Recht erfasst bspw nicht nur den Ehrenschutz lebender Personen,
sondern auch den Verstorbener; latinisiert:
De mortuis
nihil nisi bene. Das ist bereits solonisch. Schon die griechische
Rechtsidee sichert somit die fundamentalen Rechtswerte Freiheit
und Gleichheit, wozu früh die politische Teilhabe am Staatsgeschehen
kommt, die schließlich Demokratie
ermöglichte. – Bereits damals standen Weltbild, Menschenbild und
Menschenwürde in enger Beziehung zur Rechtsidee und diese Bereiche
beeinflussten sich gegenseitig. Auch heute sollten wir auf diese Zusammenhänge
achten. | Zur antiken griechischen Rechtsidee |
 | |
3. Gerechtigkeit
und Gesellschaft | |
Gerechtigkeit zielt letztlich darauf ab, Gesellschaft
– und zwar für alle (!) – möglich zu machen, was heißt: Wo nötig
auszugleichen und immer wieder nach Neuem und Besserem Ausschau
zu halten, weil gerade moderne Gesellschaften sich rasch wandeln
und ein solcher Wandel neue (System)Verlierer und Gewinner hervorbringt.
– Als Juristin oder Jurist kann man sich daher nicht auf vermeintlich
Endgültigem ausruhen. Die Jurisprudenz verlangt vielmehr nach ständiger Bewegung
und Achtsamkeit. Dabei erscheint es gerade im Bereich des Rechtsdenkens
und der Jurisprudenz mitunter sinnvoll, strukturkonservativ zu denken
und zu handeln; dies iS eines Bestehenlassens alter und vertrauter
Formen, ohne dabei den inneren Wandel zu vernachlässigen. | Gesellschaft durch Recht möglich
machen |
Der us-amerikanische
Philosoph
Richard
Rorty sprach anschaulich davon, dass die gesellschaftlichen
Werte Freiheit, [Gleichheit?], Gerechtigkeit und Demokratie für
uns zur
Zivilreligion werden
müssen, soll es gelingen unsere Gesellschaften zu stabilisieren.
ME könnte auch eine nur menschlich begründete Rechts-Ethik zu einem
wichtigen Bestandteil der Rechtsidee werden. – Daraus wird deutlich:
Gerechtigkeit ist nicht nur ein rechtlicher, sondern ein (gesamt)gesellschaftlicher
Wert. Aufgabe des Rechts ist es, zur Erreichung dieses wichtigen
gesellschaftlichen Ziels, Umsetzungs-Hilfe zu leisten. Das ist heute
nicht anders als zur Zeit der alten Griechen. Ein gesellschaftsfernes
Rechts- und Gerechtigkeitsdenken ist demnach ein Widerspruch in
sich. Mag es auch für alle rechtlich Tätigen wichtig sein, die innere
wie äußere Unabhängigkeit zu bewahren. Geld und Macht versuchen
nämlich immer wieder, Recht und Gerechtigkeit für ihre Zwecke zurechtzubiegen.
Und man muss zugestehen: Sie sind dabei zur Zeit „erfolgreich“. | Zivilreligion? |
4. Die Idee der
Gerechtigkeit | |
Juristen – freilich nicht nur sie
(vgl etwa auch N. Luhmann, Das Recht der Gesellschaft: 1993) – reagieren
eher befremdet, oft gelangweilt, wenn sie ein Buch über die Gerechtigkeit
in die Hand bekommen, was übrigens selten vorkommen dürfte. Und
seien es hochkarätige, wie die der Amerikaner John
Rawls, Michael
Walzer oder Ronald
Dworkin. Bei uns
existiert keine Literaturgattung dieser Art und das Studium stellt
dafür keine Weichen. Die Vorbehalte gehen häufig in die Richtung,
dass derlei Bücher letztlich nichts brächten, weil sie zu allgemein
gehalten seien und kaum jemand an derart abstrakten Themen interessiert
sei. – Stimmt das, oder handelt es sich hier um eine berufliche
Schutzbehauptung, die davor bewahren soll, eingefahrene Denkmuster
verlassen oder doch in Frage stellen zu müssen? | Eingefahrene
Denkmuster verlassen |
Andererseits wird immer wieder versucht,
die Idee der Gerechtigkeit als ewig und allgemeingültig hinzustellen,
was „so” unzutreffend ist, mag das auch für manche (Einzel)Fragen
(eher) zu bejahen sein; zB grundsätzliches Tötungsverbot, Schutz
Schwacher, faires Verfahren, Notwehrrecht, pacta sunt servanda.
– Aber warum wird immer wieder der transitorische Charakter von
Recht und Gerechtigkeit verkannt? Es lohnt, darüber nachzudenken. | Gerechtigkeit –
ein Ewigkeitswert? |
5. Michael Walzer
und John Rawls | |
Das Amerika der zweiten Hälfte des
20. Jahrhunderts weist große Vertreter des Rechts- und Gerechtigkeitsdenkens
auf, von denen zwei hier kurz vorgestellt werden sollen, zumal sie
uns immer noch manches zu sagen haben. – Dass die USA die Heimat
dieser Denker ist, hat vielleicht auch damit zu tun, dass dieses
große und mächtige Land noch weiter als wir in Europa von der Idee der
Gerechtigkeit entfernt ist, was uns nicht dazu verleiten sollte,
uns auf unseren Lorbeeren auszuruhen. Zudem ist nicht zu übersehen,
dass derzeit bei uns in Österreich wie in anderen Ländern Europas
die Regierungen drauf und dran sind, vieles – und zwar ohne Verständnis
für Erreichtes – zu zerstören. Aber auch politische Lausbubenstücke
und Dummheiten wie wir sie derzeit in Österreich erleben, sind schwer
auszubügeln. – Zusammen mit R. Dworkin (* 1931)
haben die Amerikaner J. Rawls und M. Walzer den Rechtspositivismus intellektuell gehörig
in die „Mangel” genommen – was freilich von seinen österreichischen
Vertretern kaum zur Kenntnis genommen wurde – und dadurch der „Rechtsidee”
erneut einen breiteren Entwicklungsraum eingeräumt. | Rechtspositivismus
als Allheilmittel? |
Es
sei wenigstens darauf hingewiesen, dass diese wichtigen Kontroversen
zwischen Vertretern naturrechtlicher und rechtspositivistischer
Positionen in Österreich teilweise bereits vor etwa 200 Jahren in
der Auseinandersetzung zwischen K.A.v. Martini und F.v. Zeiller einen
Vorläufer hatten, was bis heute nicht anständig (privat)rechtsphilosophisch
aufgearbeitet wurde. Vgl dazu wenigstens kurz: Barta,
in: Barta/ Palme/ Ingenhaeff (Hg),
Naturrecht und Privatrechtskodifikation 54 ff (1999). – Zeillers
Überschätzung ist ebenso weit verbreitet wie das Nichterkennen des historischen
Umstands, dass er einer der Wegbereiter des Positivismus in Österreich
war. Martinis rechtsphilosophisch wesentlich fundierterer Position
entspricht weithin die der ebenso griechisch inspirierten Amerikaner,
insbesondere der R. Dworkins, der übrigens auch starke (bisher offenbar
unbemerkte) Parallelen zu Eugen Ehrlich aufweist. | Zeiller versus Martini |
Der
Amerikaner M. Walzer holt die „Idee” der Gerechtigkeit
in griechischer Manier aus dem sehr oft zu abstrakten kontinentaleuropäischen
Ideen-Himmel herunter auf die Erde und macht dadurch ihren zeit-
und situationsgebundenen, aber dennoch hohen praktischen Wert bewusst.
Das Rezept ist einfach: Es werden verschiedene Facetten der Gesellschaft
– zB Einwanderung, Einkommen/Verdienst, Ansehen, öffentlicher Dienst,
Schule, medizinische Versorgung, Soziales uam – behandelt und idF
diskutiert, wie diese Felder der Gerechtigkeit gesellschaftlich
sinnvoll organisiert und gelebt werden können. Und das Ergebnis
dieser Diskussionen, gleichsam das überschießende Ganze, ergibt
mehr als seine Teile, nämlich die Idee der jeweiligen – gegenwärtig
gelebten, lebbaren und konkreten – gesellschaftlichen Gerechtigkeit,
die es also für sich alleine genommen, als Abstraktion, gar nicht
gibt und die ständig in Bewegung ist. – Wir können daraus lernen: Gerechtigkeit
muss immer wieder konkret werden. Sterilität des Rechtsdenkens
und auch der Rechtsphilosophie ist die Folge, wenn diese Maxime
nicht beachtet wird. | Gerechtigkeit muss „konkret“ werden |
Walzer
wird auch in der Theorie immer wieder konkret, denkt transitorisch,
während wir Europäer gerne abstrakt und damit unverbindlich bleiben,
Ewigkeit anstreben und dadurch den Bezug zu den drängenden Lebensproblemen
leicht verfehlen. Auch Interesse und Verständnis lassen sich europäisch-ewig-abstrakt
nur schwer vermitteln. Ganz anders der konkret, bildhaft-ruhige
und beispielreiche Zugang Walzers. Walzer ist Sozialwissenschaftler,
sein US-Herausforderer in Sachen Gerechtigkeit, John Rawls, Philosoph.
– Wo bleiben, so lässt sich fragen, die Juristen? Glauben die nicht
an die Gerechtigkeit oder zweifeln sie bloß an der Sinnhaftigkeit
sich mit ihr auseinandersetzen zu können? Oder verhindert das Aufgehen
im juristischen Alltag die Hinwendung zu den höchsten Fragen des
eigenen Fachs? Walzer macht erneut deutlich – was schon die alten
Griechen vorgelebt haben, dass das eigentliche Fragen nach den Grundlagen
der Gerechtigkeit nicht nur eines der Juristen ist, als vielmehr
auch der Philosophen, Ökonomen, Soziologen und anderer. | Europäer denken gerne „abstrakt“ |
J. Habermas übernimmt in seinem Buch „Geltung und Faktizität”
(1992) diesen Gedanken aus der anglo-amerikanischen Diskussion.
Als – rechtlich – gerecht angesehen werden kann daher nur etwas,
was zuvor von diesen vorgelagerten Sphären als gerecht und das heißt
auch gemeinschaftskonstituierend aufbereitet und erkannt wurde.
Offensichtlich kommt heute dem Rechtsdenken auch in dieser zentralen
– und nur scheinbar ureigensten juristischen – Frage bloß noch eine
vermittelnde „Umsetzungsfunktion” zu. Aber das müsste nicht so sein. | |
 | |
Läßt sich mit Gerechtigkeit experimentieren? – Zu John
Rawls und seinem berühmten rechtsphilosophischen Werk soll
hier nur so viel angemerkt werden: Versuchen Sie einmal das gedankliche Gerechtigkeitsexperiment nachzuvollziehen,
das dieser amerikanische Rechts- und Gesellschaftsphilosoph in seinem
berühmten Buch „Eine Theorie der Gerechtigkeit” (1971, 20012)
angestellt hat. | |
Aber
zuvor sei noch eine konkrete Rawlssche Frage vorausgeschickt: Ist
es als gerecht anzusehen, wenn Kozernchefs 4 Mio ı jährlich und
– wie die Tiroler Tageszeitung schon vor mehreren Jahren berichtete
– manche Medizinprofessoren in Innsbruck (neben ihrem Professorengehalt,
ihren Einnahmen aus betriebener Privatpraxis und zum Teil aus namhaften
zusätzlichen Einkommen aus der Betreuung von Patienten/innen aus
Südtirol etc) etwa 2 Mio ı (~25 Mio S) verdien(t)en, während die
Gehälter von Jungmedizinern/innen (ähnliches gilt für Juristen/innen)
bei 1000 ı und oft noch darunter liegen? Sind Manager wirklich so
gut und andere gesellschaftlich so uninteressant? – Wir können daraus
entnehmen, dass Fragen der Gerechtigkeit nicht nur weltferne und
abgehobene Fragen sind, sondern Fragen, die in unseren Gesellschaften
immer wieder zu beantworten und zu stellen sind. Und es muss auch
erwähnt werden, dass die Antwort auf diese Fragen schwieriger ist, als
es scheinen mag. | Lebensnahe Fragen zur Gerechtigkeit |
Doch nun zu Rawls’
Gerechtigkeitsexperiment,
das von Th. Assheuer in der deutschen Wochenzeitung
„Die Zeit” vorbildlich knapp und verständlich zusammengefasst wurde: | Rawls’
Gerechtigkeitsexperiment |
„Angenommen, eine Gruppe von Menschen könne
noch einmal ganz von vorn anfangen und sich gemeinsam die Prinzipien
einer gerechten Gesellschaft ausdenken – also ohne zu wissen, ob
der Einzelne später als Konzernchef oder Tellerwäscher, Glücksritter
oder Pechvogel seinen Platz in der Gesellschaft finden wird. Auf
welche idealen Gerechtigkeitsgrundsätze könnte sich die Gruppe im
‚Urzustand’ wohl verständigen?” – Kurz: „Rawls war überzeugt, hinter
dem ‚Schleier des Nichtswissens’ würden sich alle Beteiligten auf
eine Gesellschaft einigen, in der jeder, ob reich oder arm, eine
faire Chance besitzt, seine Begabung und seine Interessen zu verwirklichen.
Diese wohl geordnete Gesellschaft wird die Grundgüter – berufliche
Stellung und Vorrechte, Einkommen und Besitz – gerecht verteilen
und Ungleichverteilung nur dann als legitim erachten, wenn der Schlechtestgestellte
daraus einen Vorteil bezieht. Der Einkommensunterschied zwischen
einem Pförtner und einem Manager wäre also nur dann gerecht, wenn
die ungleiche Entlohnung den Pförtner besser stellt. Die bessere
Bezahlung ist für den Manager ein Anreiz, und so haben am Ende alle
mehr Geld zur Verfügung, als es der Fall wäre, wenn alle gleich
entlohnt würden.” | |
 | |
6. Gerechtigkeit
(und Rechtsphilosophie) als ‚Prozess’ | |
um GerechtigkeitNur ein Verständnis der Gerechtigkeit
als kontinuierlicher sozialer und vernunftorientierter ‚Prozess’–
zu dem iSv Hans Kelsen auch gesellschaftliche
Toleranz gehört –
wird ihrer Aufgabe, als Grundlage von Gemeinwesen zu dienen, gerecht.
Jede Zeit muss erneut darum ringen. Hier berühren sich modernes
Rechtsdenken und das vernunftrechtliche Denken des aufklärerischen Naturrechts
sowie der philosophische Aufbruch der Griechen im 5. und 4. Jahrhundert
v. C. Naturrecht sollte nämlich heute weder ontologisch (dh: im
Sein begründet, zB der Natur des Menschen), noch eschatologisch
(insbesondere religiös, von Gott ausgehend) begründet werden, sondern
nur voraussetzungslos vernunftrechtlich iS eines (weithin, wenngleich
nicht ausschließlich) relativen Naturrechts. – Gerechtigkeit ist
demnach nicht ein für allemal vorgegeben, sondern wandelbar in Raum
und Zeit und ein Produkt echten gesellschaftlichen Bemühens. | Ständiges
Bemühen |
In
der griechischen Mythologie sind Dike
(Recht / Gerechtigkeit), Eunomia
(die gute gesellschaftliche Ordnung oder Gerechtigkeit) und Eirene (Frieden) Schwestern.
Als Töchter des Zeus und
der Themis (Göttin von
Sitte und Ordnung) sind sie die drei Horen. | Themis, Dike etc |
Die historische Dimension rechtsphilosophischen
Denkens ist deshalb so wichtig, weil das Entstehen von Ideen, Konzepten
und Grundhaltungen sonst nicht richtig verstanden werden kann. –
Vor allem das griechische Rechtsdenken ist unverzichtbar, zumal
es bis heute nachwirkende Grundlagen gelegt hat. So entsteht mit
Solon das
Rechtssubjekt als
autonomer Träger subjektiver Rechte, einer normativen
„Beziehung”, die bis heute nichts an Bedeutung verloren hat. Mit
Solon beginnt der Schutz der Menschenwürde, beruhend auf der von
ihm geschaffenen unverbrüchlichen Freiheit der Bürger und
(!) der von ihm bereits weithin, wenn auch politisch noch nicht vollständig
geschaffenen politischen Gleichheit/Isonomia. Dieser Rechtsschutz seit
Solon ist bereits ein institutioneller und eine Einschränkung der
genannten Grundrechte Freiheit und Gleichheit zu der noch die privatrechtliche Vertragsfreiheit
und Privatautonomie trat, ist nur noch durch die konkurrierenden
Rechte anderer Bürger möglich. Das lehrt uns, das das von Kelsen
zu Unrecht so bekämpfte Konzept der subjektiven Rechte aus dem öffentlichrechtlichen
Bereich stammt und erst in der Folge auf das Privatrecht übertragen
wurde. | |
Das moderne Gewaltverbot,
die Ablöse der Blutrache
und Selbsthilfe,
die noch Gewalt mit Gegengewalt, Mord und Tötung vergelten, war
gesellschaftlich und rechtlich ein enormer Fortschritt; vgl damit
noch die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen der griechischen Tragödie,
etwa der „Elektra” des
Sophokles,
wo Agamemnons Kinder – Elektra und Orestes, den von der Mutter (Klytaimnestra)
ermordeten Vater durch die Tötung der Mutter und ihres Liebhabers
Aigisthos sühnen.
Aischylos merkt
dazu in seiner Orestie aber schon fragend an: | Modernes Gewaltverbot |
„Wo hört es wohl auf, wo endet der Lauf,
besänftigt, das Wüten des Unheils?” | |
| |
Das lehrt uns, dass es rechtlich darum „geht”, dem durch
eigenes erlittenes Unrecht entstandenen Bedürfnis nach Rache durch
die Idee der Gerechtigkeit Grenzen zu setzten und nicht erneut Unrecht
durch weiteres – selbst begangenes – Unrecht zu vergelten. Hier
steht uns die sokratisch-platonische Formel zur
Verfügung nach der es besser ist, Unrecht zu erleiden, als (selber)
Unrecht zu tun. | |
III.
Arten der Gerechtigkeit | |
Epikur, der das Glück
des Einzelnen ins Zentrum seines Denkens rückte und auch nicht mehr
an die alten Götter glaubte, dachte auch realistisch über Recht
und Gerechtigkeit, wenn er – gegen Platons Ideenlehre gerichtet
– meinte: | |
„Gerechtigkeit an sich hat es nie gegeben.
Alles Recht beruhte vielmehr stets nur auf einer Übereinkunft zwischen Menschen,
die sich in jeweils verschieden großen Räumen zusammenschlossen
und sich dahin einigten, dass keiner dem anderen Schaden zufügen
oder von ihm erleiden soll.” | |
Heute unterscheiden wir, um die Schattierungen des Gedankens
der Gerechtigkeit zu veranschaulichen, zwischen verschiedenen Arten
der Gerechtigkeit, die idF angesprochen werden sollen. | |
1.
Absolute
und relative Gerechtigkeit | |
Recht und Gerechtigkeit
sind demnach nicht identisch. Das macht auch Hans Kelsens vorangestelltes
Motto deutlich. Anzustreben gilt es aber immer wieder Annäherungswerte
an die Gerechtigkeit. Das ist jeder Epoche zur Aufgabe gestellt.
Gustav Radbruch
etwa meinte: | |
„Die Idee des Rechts kann nun keine andere
sein als die Gerechtigkeit.” | |
| Was ist Gerechtigkeit? |
Verschiedene
Vertreter des Naturrechts, etwa G. W. Leibnitz oder Christian Wolff ( → KAPITEL 1: Zur Entstehung des
ABGB),
vertraten noch die Ansicht eines absoluten Naturrechts,
das göttlichen Ursprungs sein sollte. Diese Meinung, die schon griechische
Vorläufer hat, wurde zu Recht aufgegeben, zumal die Abhängigkeit
des Rechtsdenkens von Zeit und Raum immer mehr erkannt wurde. Schon
im Altertum. – Auf der anderen Seite müssen wir konzedieren, dass
gewisse Rechts- und damit auch Gerechtigkeitspositionen zumindestens
in die Nähe einer absoluten Geltung zu rücken sind: zB das
Tötungsverbot,
heute wohl auch die
Menschenrechte mit der Menschenwürde
in ihren Zentrum, aber auch das
Notwehrrecht und vielleicht
auch noch andere Rechts-Werte. |
Absolutes Naturrecht? |
Die seit dem Altertum anhaltenden Debatten
um die Richtigkeit von Naturrechts- und rechtspositivistischen Positionen lehren
uns vielleicht eines, mag das auch als persönliche Formel zu verstehen
sein: Die Frage nach einem „Entweder-Oder” dieser beiden rechtsphilosophischen
Positionen erscheint falsch gestellt. Müssen wir uns nicht eingestehen,
dass wir heute selbstverständlich zu 90-95 Prozent Positivisten
sein müssen, dass aber auf der anderen Seite der verbleibende Teil eines
naturrechtlichen Korrektivs, das dem Positivismus inhaltlich-materiale
Grenzen setzt, ebenso selbstverständlich sein sollte? | Naturrecht oder
Rechtspositivismus? |
Hier,
im Bereich der relativen Gerechtigkeit, schließt sich auch der Kreis
zur Anthropologie, Sozialpsychologie und Psychoanalyse: | Interdisziplinäre Einsichten |
„Freud hat darauf hingewiesen, dass ...
Triebregungen – die Triebregungen des Menschen wie natürlich auch
diejenigen jedes anderen Lebewesens – an sich weder gut noch böse
sind, sondern dass sie als gut oder böse nur erlebt werden können
im Kontext eines Kulturverhaltens. Es ist also in verschiedenen
Kulturen das, was als gut und was als böse angesehen wird, etwas
sehr Verschiedenes. Es gibt kein Absolutum in dieser Hinsicht.”
– A. Mitscherlich, Massenpsychologie
(1972) | |
2.
Materielle
und formelle Gerechtigkeit | |
Dazu kommt, und deshalb
finden sich diese Ausführungen im folgenden Kapitel 19 (Rechtsdurchsetzung),
dass „Recht haben” (nach dem materiellen Recht)
und „Recht bekommen /erlangen” (im Prozess und
überhaupt in rechtlichen Verfahren) zweierlei sind. – Kann ich nämlich
mein Recht nicht beweisen, erhalte ich es auch nicht zugesprochen,
mag sich auch alles tatsächlich so zugetragen haben, wie von mir
behauptet. Das verletzt zwar die materielle Gerechtigkeit,
nicht aber notwendigerweise die formelle oder Verfahrensgerechtigkeit.
Denn auch Rechtsanwender sind keine Hellseher und können nur zusprechen,
was beweisbar ist. Viele Rechtsakte werden daher nur durch ein korrektes
Verfahren legitimiert; N. Luhmann, Legitimation
durch Verfahren (1969). Das bedeutet zwar eine Einbusse in Bezug
auf die materielle Gerechtigkeit, muss aber als Folge der menschlichen
Unzulänglichkeit hingenommen werden. | „Recht
haben” und „Recht bekommen” |
Recht, Moral und Sitte ( → KAPITEL 1: Normen
als ¿Wegweiser¿ ¿ Recht, Sitte, Moral)
bestimmen für jede Gesellschaft, was in ihr „gut und gerecht” (=
erlaubt), und was „schlecht” (= unerlaubt) ist. Dabei lassen sich
von Land zu Land Übereinstimmungen wie Differenzen feststellen.
Das ist die Erklärung für Michel de
Montaignes (1533-1592) berühmten
Satz: „Was ist das für eine Wahrheit [Gerechtigkeit], die bei diesem Bergzug
endet und für die Welt dahinter Lüge [also Unrecht] ist”, der Blaise
Pascal (1623-1662) zu
seinem Ausspruch animierte: | Sozialnormen
als Kulturnormen |
„Verité en decà des Pyrénées, erreur au
delà.” | |
Dennoch existieren wichtige und weitläufige rechtliche Gemeinsamkeiten:
Für das Privatrecht bspw die Persönlichkeitsrechte,
aber auch zugefügten Schaden ersetzen und Verträge zuhalten zu müssen;
für das öffentliche Recht etwa die Grund- und Menschenrechte;
für das Verfahrensrecht die Ausrichtung an einem
fairen Verfahren, wie es in Art 6 EMRK gefordert wird oder das schon Aischyleische
Prinzip des audiatur
et altera pars; und für das Strafrecht die ebenfalls
auf griechische Wurzeln zurückgehende Regel des in dubio pro reo. | |
3.
Austeilende
und ausgleichende Gerechtigkeit | |
 | |
Die Rechtsphilosophie
unterscheidet seit Aristoteles (5. Buch der Nikomachischen Ethik)
zwei Arten der Gerechtigkeit: | Zwei Arten der
Gerechtigkeit |
| •
die austeilende
Gerechtigkeit (iustitia distributiva), gewährt jedem, was ihm
zusteht; | |
| •
die ausgleichende Gerechtigkeit (iustitia commutativa)
versucht, das Gleichgewicht rechtlich wieder herzustellen, wenn
es gestört wird. Sie verfolgt damit ein Ziel, das für jede Gesellschaft von
Bedeutung ist: Recht soll Gesellschaft möglich machen. – Wer andere
schädigt, muss dies wieder gutmachen; dh Schadenersatz leisten oder
Strafe hinnehmen. Wer sich ungerechtfertigt bereichert, hat das
dabei Erlangte herauszugeben. | |
Die ausgleichende
Gerechtigkeit – deren Göttin in der griechischen Mythologie
Nemesis, die Rache, war – wird im Strafrecht durch die Strafe charakterisiert,
im bürgerlichen Recht etwa durch das Schadenersatzrecht; die austeilende
Gerechtigkeit durch die berühmte Ulpian-Formel des „Suum cuique”. – Es stellt
einen unüberbietbaren Zynismus dar, dass die Nationalsozialisten
die Gerechtigkeitsformel Ulpians – „Jedem das Seine” – als Aufschrift über dem Eingang
des KZ-Buchenwald anbrachten. | Beispiele |
Kant (Rechtslehre, Methaphysik
der Sitten) ordnet die austeilende Gerechtigkeit dem öffentlichen Recht,
die wechselseitige / erwerbende oder ausgleichende dem Privatrecht
zu und zählt zu letzterer auch die beschützende Gerechtigkeit (iustitia tutatrix);
dies iSv Schutzgesetzen: vgl heute MRG, KSchG, WEG, Arbeitsrecht,
BTVG etc. – Dieser Ansatz erscheint aus heutiger Sicht nicht unwichtig. | iustitia
tutatrix |
IV.
Gerechtigkeit
als Tugend | |
| |
Die Gerechtigkeit (iustitia) bildet mit der Klugheit (prudentia), der Selbstbeherrschung / Mäßigkeit (temperantia) und der Tapferkeit/Seelengröße (fortitudo) die vier Kardinaltugenden, die
es für jedes Individuum – und wie Platon (von dem diese Überlegungen
stammen) in seiner „Politeia” klarstellt – aber auch für den Staat
zu erstreben gilt. (Die lateinischen Begriffe sollten nicht darüber
hinwegtäuschen, dass diese Lehre griechischen Ursprungs ist.) –
Gerechtigkeit ist danach das Ergebnis des Gelingens und Erreichens
der anderen, vorgelagerten Tugenden, was später immer wieder verzeichnet
wurde. | |
Die platonische Lehre von den Kardinaltugenden
wurde im Rahmen der griechischen Philosophieentwicklung vor allem
von der
Stoa aufgegriffen
und modifiziert. Eine Schrift des
Panaitios von Rhodos (~180-100 v. C.),
er bildet mit seinem berühmten Schüler Poseidonios die
mittlere Stoa (~150-0), diente
Cicero als Vorlage für dessen Schrift „De
officiis”/„Über die Pflichten”. Die politische Propaganda der Augustuszeit
übernimmt die Lehre der Kardinaltugenden ebenso wie später das Christentum
(Ambrosius, Augustinus, Thomas von Aquin). | |
Gerechtigkeit
ist also nach der ursprünglichen Lehre nicht nur ein individuell-persönlicher,
sondern auch ein kollektiv-staatlicher, also ein Gemeinschaftswert,
ohne den kein Gemeinwesen auf Dauer bestehen kann. Gerechtigkeit
ist zudem kein statischer Zustand, sondern kontinuierlich in Entwicklung
begriffen, kurz: dynamisch angelegt. – Das Recht ist dabei jenes
Mittel, das – einem Transmissionsriemen vergleichbar – die Strebungen
von kollektiven und individuellen Gerechtigkeitsbemühungen verbindet
und so – vor allen andern Mitteln – den Bestand des Staates und
das Wohl und Glück der Einzelnen (Eudaimonia) sichert. | Gerechtigkeit gilt für Staat und Individuum |
2. Gerechtigkeit
– keine Domäne des Rechtsdenkens | |
Dieser – hohe wie tiefe – Stellenwert der Gerechtigkeit
und damit des Rechts erklärt auch, warum sich nicht nur die Rechtswissenschaft
mit der Frage der Gerechtigkeit befasst, sondern auch zahlreiche
andere Disziplinen, allen voran die Philosophie. Das beginnt bei
Platon und seinen Schülern, insbesondere Aristoteles, und reicht
bis Rawls, Habermas, Walzer uam; vgl schon oben → Gerechtigkeit
und Gesellschaft – Die ‚Idee’ der Gerechtigkeit als ‚Rechtsidee’
– | |
Ein solches Verständnis der Gerechtigkeit macht
zudem klar, wie wichtig in einem Staate ein breiter politischer
und wissenschaftlicher Diskurs ist.
Persönlicher Ehrgeiz und politisch-ideologisches Machtstreben haben
aber noch nie ausgereicht, um einen Staat politisch glücklich zu führen.
Dabei wissen wir seit den alten Griechen wie wichtig es für politische
Fragen ist, sie „nach beiden Seiten zu diskutieren” (Cicero), um
dann sicher(er) entscheiden zu können. Noch viel wichtiger ist ein
solcher Diskurs aber dafür, dass er den Menschen eines Staates zeigt,
dass die handelnden Politiker bestrebt sind, das Beste für alle
– nicht nur für sich selbst (!), ihre Klientel und ihr politisches
Überleben – zu tun. Das setzt allerdings die Reife einer Regierung
und auch der Opposition voraus, zu zeigen, dass es ihnen nicht nur
darum geht, Recht zu behalten. Erst daraus vermag sich verbindende
Gemeinsamkeit und Wohlfahrt
zu entfalten. – Wie aber soll ein Staat seine Bürger und Bürgerinnen
dazu anhalten nach gesellschaftlicher Vollkommenheit zu streben und
sittliche Persönlichkeiten zu werden, wenn seine Repräsentanten
die dafür nötigen Fähigkeiten und Charaktereigenschaften kaum vom
Hörensagen kennen? Ehrgeiz und Geltungssucht lassen aber auch Wissenschaftler
immer wieder vergessen, dass es nicht ihre Aufgabe sein kann, mit solcher
Politik zu kooperieren. Allein: Der Opportunismus ist meist stärker,
mag auch längst an die Stelle des Willens zu gesellschaftlicher
Reform, der zu narzistischer Zerstörung getreten sein. | Gerechtigkeit braucht politischen und wissenschaftlichen
Diskurs |
B.
Rechtswissenschaft
als Sozialwissenschaft? |
Der folgende Einführungstext (Pkt B. I.)
wurde vor 30 Jahren geschrieben. Anlass war damals die Vorlage eines Entwurfs
für ein neues juristisches Studiengesetz. Meine Hoffnung bestand
damals darin, dass es gelingen könnte, das disziplinäre Verhältnis
der Rechtswissenschaft (ReWi) zu den Sozialwissenschaften
(SoWi) zu verbessern. Heute sehen wir sehr deutlich, dass sich diese
Hoffnung nicht erfüllt hat. Daher besitzt dieser Text weiterhin
seine Berechtigung. Die Innsbrucker Studentenzeitung „Neue Freie
UNIPress” lud damals zu einer Stellungnahme ein und sicherte deren
Veröffentlichung zu. – Der hier abgedruckte Artikel erschien in
der Nr. 2, Nov./Dez. 1973. – Hinzugefügt wurden nur wenige Bemerkungen. | |
I. Selbstzufriedene
Rechtswissenschaft? | |
Die traditionell eher satte disziplinäre
Selbstzufriedenheit der Rechtswissenschaft (ReWi) erreicht hinsichtlich
ihres Verhältnisses zu den Nachbarwissenschaften – vornehmlich den
Sozialwissenschaften (SoWi) – immer noch ein beachtliches Ausmaß,
scheint aber allmählich einer gewissen Unsicherheit über den tatsächlichen
Stellenwert des „eigenen Fachs” zu weichen. Dieser – für Österreich
eher schmeichelhafte – Befund spiegelt vor allem die Situation in
der BRD wieder und wird ua durch ein rapides Ansteigen kritischer
Publikationen indiziert. Österreich wird (vielleicht) mit einem
gewissen time-lag folgen. Noch aber lebt ein beachtlicher Teil von
Österreichs Juristen im Land der Phäaken. Dabei hätte man sich spätestens
im Rahmen der Begutachtung des Entwurfs eines Bundesgesetzes über
das Studium der Rechtswissenschaft mit derart grundlegenden Fragen eingehend
beschäftigen müssen, geht es doch um Weichenstellungen für Jahrzehnte! | ReWi und
Nachbardisziplinen |
1. Worin liegt
das Problem? | |
Vielleicht
helfen uns schon einige Titel unlängst erschienener Publikationen
weiter: „Soziologie vor den Toren der Jurisprudenz” (Lautmann, 1971),
„Rechtswissenschaft als Sozialwissenschaft” (Rottleuthner, 1973),
„Richterliches Handeln. Zur Kritik der juristischen Dogmatik” (Rottleuthner, 1973),
„Rechtssoziologie und Rechtspraxis” (Nauke/Trappe, 1970), „Theorie
der Interdependenz. Ein Beitrag zur Reform der Theorie der Rechtsgewinnung
durch Öffnung der Rechtswissenschaft zu den Sozialwissenschaften”
(Wittkämper), „Rechtswissenschaft und Nachbarwissenschaften” (Grimm,
Hg, 1973), „Über die juristische Relevanz der Sozialwissenschaften”
(Naucke, 1972). | Wegweisende Publikationen |
Es
geht also um das Verhältnis der ReWi zu ihren Nachbarwissenschaften,
pauschal den SoWi, das sich künftig ändern muss. Darüber hinaus
geht es um die Gewinnung eines neuen, realistischen Selbst(wert)verständnisses
der ReWi. Getragen wird diese Entwicklung von der Erkenntnis, dass die
ReWi die ihr aufgegebenen gesellschaftlichen Probleme allein nicht
(mehr) zu bewältigen vermag. – Um dies zu verschleiern wurde in
der Jurisprudenz bereits viel Scharfsinn aufgewandt. – Aus der Distanz
von drei Jahrzehnten betrachtet, zeigt sich, dass dieser Entwicklungsschritt
versäumt wurde, ja dass die ReWi drauf und dran ist, sich vollständig
der Wirtschaft und ihren Zielsetzungen zu unterwerfen, was einer
Selbstaufgabe gleichkommt. – Die disziplinäre Autonomie der ReWi
ist schwer gefährdet! | Neues Selbstverständnis der ReWi? |
Die ReWi verhielt sich in
der Vergangenheit den SoWi gegenüber – ohne erkennbaren
Grund – immer wieder hochmütig. Transferiert man
das gegebene Verhältnis von ReWi und SoWi metaphorisch auf eine
familiäre Ebene, könnte man sagen: Die ReWi versuchte, den in ihrem
Randgebiet angesiedelten sozialwissenschaftlichen Disziplinen eine
autoritäre Vaterfigur – freilich ohne echte Autorität – vorzuspielen.
Nach anfänglichen Schwierigkeiten der SoWi – was aber vornehmlich
sachlich, also gegenstandsmäßig bedingt war (vgl G.C. Homans, Was
ist Sozialwissenschaft?, 19722; vgl
auch: P. Lazarsfeld, Am Puls der Gesellschaft. Zur Methodik der
empirischen Soziologie [1968] und derselbe, Soziologie. Hauptströmungen
der sozialwissenschaftlichen Forschung [1970]; N. Luhmann, Legitimation
durch Verfahren [1969]) – haben sich die „Kinder” emanzipiert und
versuchen nun einerseits ihre wissenschaftliche Ebenbürtigkeit und
Brauchbarkeit zu dokumentieren; andererseits sind sie bestrebt,
die für sie lange Zeit traumatische”Vaterfigur ReWi”
mit den ihnen eigenen, im Hinblick auf wissenschaftliche Exaktheit
überlegenen Instrumentarien auf Schwachstellen hin abzuklopfen.
Die Hohltöne sind dabei nicht zu überhören, was wiederum viele Juristen
nicht wahrnehmen wollen oder zumindest schmerzlich berührt. – Wissenschaftliche
Freude an disziplinärer Selbsterkenntnis war ja nie der Juristen
starke Seite. | Traumatische
„Vaterfigur ReWi”? |
Vgl dagegen: Th. W. Adorno / H. Albert /
R. Dahrendorf / J. Habermas / H. Pilot / K. R. Popper, Der Positivismusstreit
in der deutschen Soziologie (1969). | |
Ich will versuchen, das bisher Gesagte
anhand eines weiteren Beispiels zu verdeutlichen: Noch vor nicht
allzu langer Zeit zweifelten nur wenige daran, dass der Richter
das Recht wirklich objektiv, ohne Vorverständnis”findet”,
eine wertfreie Entscheidung fällt. Es ist unbestreitbar das Verdienst der
Verfahrens- und Richtersoziologie, dass heute nur mehr wenige daran
glauben; vgl R. Wassermann, Der politische Richter (1972) sowie
Th. Rasehorn, Recht und Klassen (1974). Nicht zuletzt deswegen kam
es auch im Bereich juristischer Dogmatik zu einer Reflexion
über Wert und Unwert traditioneller juristischer Methodologie.
Als Beispiel hierfür ist J. Essers Buch „Vorverständnis und Methodenwahl
in der Rechtsfindung” (1970; 19722)
zu nennen. | „Vorverständnis
und Methodenwahl” |
Vorangegangen waren diesem Buch andere bedeutende
Publikationen J. Essers: – Wert und Bedeutung der Rechtsfiktionen
(1940); – Grundsatz und Norm in der richterlichen Fortbildung des
Privatrechts (1956, 19904); – Wertung,
Konstruktion und Argument im Zivilurteil (1965) uam. | |
Auslösendes Moment dafür, dass derartige Bücher überhaupt
geschrieben werden konnten, war der – das juristische Selbstverständnis
immer mehr unterminierende – zunehmende wissenschaftliche Druck
seitens sozialwissenschaftlicher und philosophischer Disziplinen,
vornehmlich aber der Soziologie, auf die Vertreter der ReWi. | |
Vgl etwa: J. Habermas, Theorie und Praxis
(1971); derselbe, Zur Logik der Sozialwissenschaften (1967); derselbe, Erkenntnis
und Interesse (1971). – Etwas später erschien P. Feyerabend, Wider
den Methodenzwang (1976). – Vgl idF auch: J. Habermas, Faktizität
und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats
(1992) und derselbe, Die Zukunft der menschlichen Natur. Auf dem
Weg zu einer liberalen Eugenik? (2001). | |
 | Abbildung .1: Bedeutung der RTF und
RS für die ReWi (1) + (2) |
|
Das gegenwärtige Neben- und meist Gegeneinander
von ReWi und SoWi ist wissenschaftlich unerfreulich. Was
es zunächst herzustellen gilt, ist echte Diskussionsbereitschaft.
Das bedeutet keineswegs eine Pflicht zu unkritischer und unreflektierter
Rezeption. Man sollte aber nicht – wie etwa Naucke (ein Jurist)
es tut – den SoWi vorwerfen, sie hätten der ReWi noch viel zu wenige konkrete
und konstruktive Lösungen zu bieten. Ich verweise hier nur auf die
seit Jahrzehnten vorliegenden Ergebnisse der Rechtstatsachenforschung
(RTF), deren Begründer, Eugen Ehrlich, ein Österreicher war. Er
gilt übrigens – gemeinsam mit Max Weber – auch als Begründer der
modernen Rechtssoziologie (RS). – Vgl dazu →
Rechtstatsachenforschung
| Gegeneinander von
ReWi und SoWi? |
Aus heutiger Sicht muss ich feststellen:
Obwohl Österreich mit Eugen Ehrlich den Begründer der modernen RS
und RTF hervorgebracht hat, ist es auch in den vergangenen 30 Jahren
nicht gelungen, das wissenschaftsdisziplinäre Verhältnis von ReWi
und SoWi zu verbessern. Wir haben bislang nicht einmal das Niveau
erreicht, das für Aristoteles und Theophrast (als Begründern dieser
Disziplinen und vor allem auch der europäischen ReWi in der Antike) selbstverständlich
war. – Wer an Zufälle glaubt, ist selber schuld. | |
Mancher
Vorwurf ist nämlich einerseits nur bedingt richtig und wohl zudem
– ja vornehmlich – auf die bisher mangelnde juristische Kooperationsbereitschaft zurückzuführen.
Der aufgeschlossene Jurist weiß aber mitunter doch besser, wo der
Schuh drückt, weshalb ein Zusammenwirken unverzichtbar ist. | Mangelnde juristische Kooperationsbereitschaft |
Ich habe das Problem für mich so gelöst,
dass ich bspw in meiner Habilitationsschrift: Kausalität
im Sozialrecht (Berlin, 1983 – 2 Bde) auch die SoWi eingehend
berücksichtigt und dafür eine Lehrbefugnis/Venia für „Bürgerliches Recht
samt dessen Bezügen zum Sozialrecht sowie Rechtstatsachenforschung”
erworben habe. – Ich vergebe seither Diplomarbeiten und Dissertationen
aus dem Bereich RTF. Die Habilitationsschrift selbst arbeitete ua
zahlreiche höchstrichterliche Entscheidungen auf und untersuchte
diese auch inhaltsanalytisch; vgl J. Ritsert, Inhaltsanalyse und
Ideologiekritik. Ein Versuch über kritische Sozialforschung (1972). | |
2. Wünschenswerte
Konvergenz | |
Eines ist jedoch gewiss: Die notwendige und wünschenswerte Konvergenz
von ReWi und SoWi wird durch eine, dieses Ziel nicht gebührend berücksichtigende
Studienreform vereitelt, zumindest aber in unverantwortlicher Weise
verzögert. Der vorliegende Entwurf (1973!) scheint diesen Weg zu
gehen. Studierende werden wie bisher am Beginn des Studiums ihren
Blick vornehmlich in die Vergangenheit richten müssen und auch später
keinen nennenswerten Kontakt mehr mit sowi-Disziplinen bekommen.
Man fragt die Studierenden freilich nicht, ob sie das auch so wollen,
was zumindest zweifelhaft erscheint. | |
Ich halte aber die
Rechtsgeschichte für
ein wichtiges, lehrreiches und interessantes Fach, meine jedoch,
dass sie in der juristischen Ausbildung meist nicht so eingesetzt
wird, wie sie eingesetzt werden sollte. – Persönlich habe ich immer
wieder auch rechtswissenschaftliche Arbeiten mit dem Ziel verfasst,
vertiefte Einsichten durch rechtshistorische Bezüge zu erlangen:
Vgl etwa: – Barta / Palme / Ingenhaeff (Hg),
Naturrecht und Privatrechtskodifikation (1999); – Zur Geschichte
und Entwicklung des Wohnungseigentums in Österreich, in: Havel/ Fink/ Barta, Wohnungseigentum
– Anspruch und Wirklichkeit 183 ff (1999) oder demnächst: – „Graeca
non leguntur”? – Zum Ursprung des europäischen Rechtsdenkens im
antiken Griechenland (in Vorbereitung: 2005). | |
Dem
Entwurf (des Jahres 1973) – gleiches gilt etwa für den neuen Studienplan
2001 der Innsbrucker Rechtswissenschaftlichen Fakultät – ist es
jedenfalls nicht gelungen eine sinnvolle Integration von
ReWi und SoWi – wenn man diesen Gegensatz noch beibehalten
will – vorzunehmen. Dass der Entwurf dem leider noch immer weit
verbreiteten juristischen Segregationsdenken (
legal isolationism)
entgegenkommt, zeigt ua die freundliche Aufnahme, die er in juristischen
Professorenkreisen gefunden hat. So nimmt es denn auch nicht Wunder,
dass juristische Fakultäten im Begutachtungsverfahren zu den hier
angeschnittenen Problemen wenig bis nichts zu sagen haben. | Sinnvolle Integration von ReWi und SoWi |
Das gilt grundsätzlich auch für einen anderen
wichtigen fachlichen Bezug des Rechtsdenkens: Den zur Philosophie, der
in seiner Synthese zur Rechtsphilosophie führt,
die heute wie vor 30 Jahren eine wichtige Ergänzung der ReWi darstellt.
Auch sie ist bis heute ein Stiefkind rechtswissenschaftlichen
Denkens geblieben. Vgl aber das zum Nachdenken anregende
Bändchen „Rechtsphilosophie” (2001) von Theo Mayer-Maly, der an
unserer Universität lehrt. | |
Diese Haltung des Rechtsdenkens gegenüber bestimmten sowi-Fächern
(insbesondere RS und Politikwissenschaft) hat sich im Wesentlichen
bis heute nicht geändert. Die Situation hat sich
aber insofern sogar noch verschlechtert, als mittlerweile
auch Rechtsgeschichte und Rechtsphilosophie neben der Rechtssoziologie
immer weiter zurückgedrängt werden und zu befürchten ist, dass diese Fächer
in absehbarer Zeit ganz verschwinden werden. – Zum Wohle der Wirtschaft,
die als sowi-Disziplin kaum Verständnis für ihre Schwesterdisziplinen
aufbringt. Das Unverständnis in juristischen Professoren- und Assistentenkreisen
ist bedauerlich gross. | |
Man hat nicht
den Eindruck, als hätten sich die „Väter” des Entwurfs auch nur
marginal an der in der BRD sehr regen Curriculum-Diskussion beteiligt;
vgl neben Grauhahn/Narr (Leviathan 1973, 90 ff) auch R. Wiethölter,
Rechtswissenschaft (1968). Die Erstellung neuer Studiengänge scheint in
der Tat – um eine Formulierung von Grauhahn/Narr zu gebrauchen –
„zur Zeit der verbliebene Rest einer universitären Reformdiskussion
zu sein, die im Hinblick auf fast alle strukturellen Probleme gestrandet
ist”. | Curriculum-Diskussion |
Es dürfte schwer
von der Hand zu weisen sein, dass die ReWi durch den offenbar immer
noch schneller werdenden sozialen Wandel verstärkt auf die Hilfe
anderer Disziplinen angewiesen ist. Aber „die” ReWi will das nicht
wahrhaben. | Sozialer Wandel |
Der andere Weg, den die ReWi seit alters
her (= römisches Recht + Rechtspositivismus) gegangen ist, ist jener
des legal isolationism, also der Abspaltung des Rechtsdenkens von
der gesellschaftlichen Wirklichkeit. Er ist längst (und war von
Anfang an) überholt, was aber von der ReWi kaum bemerkt wird! So
ist der Rechtspositivismus bei uns in Österreich (auch bei vermeintlich
fortschrittlich Denkenden) immer noch (zu) hoch im Kurs. – Einen
anderen Fluchtweg bietet die „reine” Theorie, die sich die Hände
nicht durch empirische Recherche oder auch nur ein Nachdenken darüber
schmutzig oder auch nur staubig machen will. | |
Dieser
Tatsache sollte auch in der Ausbildung Rechnung getragen werden.
– Das darf aber nicht damit verwechselt werden, die ReWi
an andere Disziplinen auszuliefern. Gerade das fördert
aber nunmehr – das ist ein Schwenk in die Gegenwart – der neue Innsbrucker-Studienplan
2003 für ein eigenes „Wirtschaftsrechtsstudium”
als Diplomstudium. Dieser Studienplan zollt zwar dem gegenwärtig
in Österreich so fühlbaren konservativen Zeitgeist Tribut, zählt
aber weder die Rechtsphilosophie, noch die Rechtsgeschichte oder
die Rechtstatsachenforschung oder gar die Rechtssoziologie zu seinen
Fächern. | ReWi nicht an andere Disziplinen ausliefern |
Dem Problem ist
nicht nur durch ein verstärktes Heranziehen von Sachverständigen
beizukommen. Der Jurist / die Juristin selbst
müsste über grundlegende sozialwissenschaftliche Kenntnisse verfügen
und diese bei seiner / ihrer Arbeit einsetzen. Der Einwand, die Verwertbarkeit
sozialwissenschaftlicher Erkenntnisse sei noch zu gering,
um ihr echte juristische Relevanz verschaffen zu können, verkennt
ua den künftigen möglichen Stellenwert der SoWi in der ReWi, zumal
sich der Ertrag der SoWi (im Gegensatz zu dem der ReWi?) noch gar
nicht absehen lässt. – Ein verstärkter Einsatz der SoWi im Gesetzgebungsverfahren,
überhaupt dem gesamten Bereich der Rechtspolitik, dem Strafrecht
oder der öffentlichen Verwaltung, im Handels-, Arbeits- und Sozialrecht
– um nur einige Beispiele zu nennen, wäre heute notwendiger denn
je. Das Zivilrecht könnte dadurch bspw zu einem vertieften Problem-
und exakteren Methoden- und Relevanzbewusstsein erwachen, das die
SoWi – trotz mancher Spreu – auszeichnet. Und auf dem Boden der Tatsachen
zu stehen, ist doch etwas Erstrebenswertes! | Verwertbarkeit
sozialwissenschaftlicher Erkenntnisse |
Während
es im dtBMdJ seit Jahrzehnten eine Abteilung
für RTF gibt, fehlt eine solche Einrichtung in Österreich.
Die Konsequenz: Statistiken und Daten zum österreichischen Rechtswesen werden
immer spärlicher und schlechter. Es fehlt an jeder ernsthaften Aufbereitung.
Die Schwarz-Blaue-Regierung hat es geschafft, die freilich schon
bisher dürftige – „
Statistik
der Rechtspflege” aufzulassen. Die sog Privatisierung zerstörte
selbst diesen schwächlichen Ansatz einer österreichischen
Justizstatistik.
Betroffen davon ist in besonderer Weise das Zivilrecht. Wir haben
nun endgültig den Stand einer rechtstatsächlichen Bananenrepublik
erreicht. – Auch das ist kein Zufall. | Abteilung für RTF im dtBMdJ |
 | |
Das dtBMdJ gibt
auch seit Jahrzehnten eine
Buchreihe „Rechtstatsachenforschung”
heraus in der viele interessante Publikationen erschienen sind,
etwa (Auswahl): | Buchreihe „Rechtstatsachenforschung” |
 | |
Man darf auf der anderen Seite
aber nicht verschweigen, dass die juristische Arbeit durch
den Einsatz sozialwissenschaftlicher Methoden nicht immer
bequemer würde. Gefällte Entscheidungen und dogmatische
Konzepte würden uU leichter oder überhaupt erst nachprüfbar, die Relevanz
des Lehrstoffs verifizierbar. – Das mag mit ein Grund sein, sich
gegen eine sozialwissenschaftliche „Infiltration” zu sträuben. Es
hat überhaupt den Anschein, als müsste – immer noch – das Image
mancher sowi Disziplin von beträchtlichen emotionalen und ideologischen
Vorurteilen seitens der Juristen und der Politik gereinigt werden. | Bequeme und
willfährige Juristen? |
Man mag sich auch immer noch darüber uneins sein, ob die ReWi (auch) eine
SoWi Disziplin ist oder nicht. Bei aller Bedeutung, die
terminologischen Fragen auch in diesem Zusammenhang zukommen mag,
dürfte es letztlich auf eine gegenseitige fachliche Öffnung (und
damit eine mögliche Bereicherung) ankommen, wobei die Jurisprudenz
eher der nehmende, als der gebende Teil sein wird. Die Lektüre des
immer noch beachtlichen und interessanten Werks von Eugen Ehrlich legt
dies nahe; vgl die folgenden Literaturangaben und die Ausführungen
in → Gerechtigkeit
und Gesellschaft – Die ‚Idee’ der Gerechtigkeit als ‚Rechtsidee’
| |
 | |
Ich halte auch
den möglichen Einwand gegen eine solche Annahme für nicht stichhaltig,
wonach ein Verständnis der ReWi als SoWi gegen das
Wertfreiheitsgebot von
Max Weber verstößt. Auch die SoWi kommen nämlich nicht ohne Wertungen
aus. Schon für die SoWi bedarf es demnach einer Korrektur dieser
Weberschen Forderung. – Für die ReWi kann das nur bedeuten, dass
der Rechtsanwender iwS nicht subjektive Werte in die vorgegebenen
normativen Wertungen einbringen darf; damit verbleibt und eröffnet
sich aber immer noch, durchaus unter Beachtung der Normtreue, ein flexibler,
dem sozialen Wandel Rechnung tragender, Interpretationsspielraum,
der keinen Verstoß gegen ein Wertfreiheitspostulat bedeutet. – Webers
Wertfreiheitspostulat kann heute nur als Aufforderung zu einem wissenschaftlich
bewusst offenen und realistischen Umgang mit Wert(urteil)en verstanden
werden! Andernfalls droht Wertfreiheit zur Weltfremdheit zu werden. | Wertfreiheitsgebot |
Schließlich sei noch kurz auf einen
Einwand eingegangen, der häufig von juristischer Seite (!) erhoben
wird. Man plädiert dafür keine Erörterungen mehr ernst zu nehmen,
die sich mit so allgemeinen Begriffen wie „die“ SoWi, „die“ Jurisprudenz,
„die“ Juristen, „das“ Recht, „die“ Dogmatik etcbegnügt
(Naucke, Struck). Ich glaube, dass dies letztlich nur als Vorwand
dient, um die beginnende Annäherung der beiden Disziplinen zu verhindern.
Mag es auch pauschalierend sein, von SoWi, der ReWi, der Dogmatik
etc schlechthin zu sprechen; die Verwendung dieser allgemeinen Begriffe
erfolgt aber gewiss nicht deshalb, weil man nicht wüsste, was damit
gemeint ist oder wo im juristischen Bereich sozialwissenschaftliche
Erkenntnisse gezielt eingesetzt werden könnten. Der Grund ist vielmehr
der, dass es zunächst – jedenfalls in Österreich – grundsätzlich
darum geht, den tiefen wissenschaftlichen Graben zwischen ReWi und
SoWi einzuebnen. Es gilt überkommene Vorurteile und generelle methodisch-disziplinäre
Barrieren abzubauen. Zudem, und auch das sei erwähnt, weiß man sehr
wohl, welche sozialwissenschaftlichen Disziplinen für eine mögliche Zusammenarbeit
mit der ReWi in Frage kämen. | Juristische
„Abwehrmechanismen” |
Vgl etwa die noch von F. Gschnitzer betreute
Diss. Von Jurij Fedynskyj, Rechtstatsachen auf dem Gebiet des Erbrechts
im Gerichtsbezirk Innsbruck 1937-1941 (1968). | |
Die Frage ist freilich nach wie vor die, ob die ReWi eine
solche Zusammenarbeit will. | |
: M. WeberEin Zitat
Max Webers mag abschließend
umreissen , was die ReWi von den SoWi zu erwarten hätte: | Zum Abschluss |
„Eine empirische Wissenschaft vermag niemanden
zu lehren, was er soll, sondern nur, was er kann und – unter Umständen
– was er will.” – Aus: Die ‚Objektivität’ sozialwissenschaftlicher
Erkenntnis (1904), abgedruckt in: M. Weber, Soziologie, Weltgeschichtliche
Analysen, Politik 186 ff/190 (1986). | |
Aber wäre es nicht schon sehr viel, wenn die ReWi wüsste,
was sie tut, kann und was sie will? | |
 | Abbildung .2: Große RS und RT-Forscher
(1) bis (5) |
|
| |
Fast überflüssig zu erwähnen, dass auch unser neuer Innsbrucker-(Diplom)Studienplan
2001 die Chance einer angemessenen Berücksichtigung sozialwissenschaftlicher
Fächer nicht genützt hat. (Nur mit Glück konnten 2 Stunden Rechtsphilosophie
gerettet werden, zumal immer mehr Kollegen diese für überflüssig
halten. Angeblich entspricht das dem Zeitgeist. – Allein, der Weg
in Richtung „Fachhochschule” erscheint vorprogrammiert. Das gilt
allerdings nicht nur für Innsbruck.) Weder die RS, noch die RTF,
noch anderes (zB Rechtspolitik, Legistik, Kautelarjurisprudenz)
wurden gebührend berücksichtigt. | |
II.
Rechtstatsachenforschung | |
| |
| |
Der (Alt)Österreicher Eugen Ehrlich (1862-1922)
– er stammte aus Czernowitz/Bukowina und war dort Professor für
römisches Recht und blieb hier bis zu seinem Tod – gilt neben Max Weber (1864-1920) als Begründer
der modernen Rechtssoziologie/RS und der Rechtstatsachenforschung/RTF;
mag auch der Terminus Rechtstatsachenforschung nicht von ihm, sondern
von Arthur Nussbaum
(1877-1964) stammen, der jedoch nur als Epigone angesehen werden
kann. Ehrlich sprach vor allem vom „lebenden Recht” und stellte
dieses dem (oft toten oder doch viel weniger bedeutsamen) Gesetzesrecht
gegenüber. Er sprach aber – interessant für die künftige Bezeichnung der
Disziplin – bereits von „juristischen Tatsachen” („Über Lücken im
Recht”). Inhaltlich hatte Ehrlich die neue Disziplin bereits vollständig
aufbereitet, ehe andere ihm folgten. – Für Ehrlich war die RTF die
praktisch-empirische Seite der RS. | Eugen Ehrlich |
Überzeugend
die verschiedenen Publikationen von M.
Rehbinder und Th.
Raiser,
Das lebende Recht. Rechtssoziologie in Deutschland 94 ff (19994).
– In der Literatur kam es dagegen zu Ausgrenzungen Ehrlichs und
wissenschaftsgeschichtlichen Verzeichnugen zugunsten Nussbaums;
vgl etwa Büllesbach, in: Kaufmann/Hassemer (Hg), Einführung in die
Rechtsphilosophie und Rechtstheorie der Gegenwart 453 ff (19946)
und insbesondere in: Chiotellis/Fikentscher (Hg), Rechtstatsachenforschung
1 und 78 ff (1985). | Wissenschaftshistorische Verzeichnungen |
Ehrlich gründete
bereits 1910 ein Seminar für „Lebendes Recht”,
das jedoch mit keinerlei finanziellen Mitteln ausgestattet wurde.
– Seine Arbeitsschwerpunkte waren neben der Rechtsgeschichte,
das geltende Privatrecht und die Grundlagen und -fragen des Rechtsdenkens
und der Rechtswissenschaft. Früh warb er in noch
heute interessanten Publikationen für seine Ideen;
vgl „Soziologie und Jurisprudenz” (1906), „Die Tatsachen des Gewohnheitsrechts”
(1906), „Die Erforschung des lebenden Rechts” (1911), „Ein Institut
für lebendes Recht” (1911), „Das lebende Recht der Völker der Bukowina”
(1912) und vor allem in seiner umfassenden, 1913 erschienenen, „Grundlegung
der Soziologie des Rechts”. | Lebendes Recht |
 | Abbildung .3: Eugen Ehrlich: Porträt
(1) bis (9) |
|
1. RTF – Empirischer
Teil Rechtssoziologie | |
Während die RS sich zum
Ziel setzt, die Zusammenhänge von Recht und Gesellschaft im Großen wie
im Kleinen aufzuhellen, geht es der RTF darum, einerseits aufzuzeigen
wie das geltende Recht samt seinen Methoden „lebt” – also bspw aufzuklären,
ob und wie bestimmte Normen angewandt werden oder nicht, ob sie
angenommen werden oder nicht – und andrerseits, darauf aufbauend,
die gewonnenen faktisch-normativen Einsichten für die Kautelarjurisprudenz,
die Legistik, Dogmatik und insbesondere auch die Rechtspolitik zu
verwenden. Beide Disziplinen dienen somit einem besseren Verständnis
des Rechts und seiner Wirkung indem das Recht und seine Erscheinungsformen als
Teile von Kultur und Gesellschaft verstanden werden. Dies ist keineswegs
so selbstverständlich wie es vielleicht erscheinen mag, haben doch
bspw – wenn auch in unterschiedlicher Weise – sowohl das römische
Recht, als auch der Rechtspositivismus versucht, das Recht von seinen
gesellschaflich-kulturellen Wurzeln zu trennen und es als autonome
Disziplin in splendid isolation zu etablieren; legal isolationism.
Ein solches Verständnis wird aber dem Recht und seinen vielfältigen gesellschaftlichen
Aufgaben nicht gerecht. | RS und RTF |
Ehrlich ging
es bei der Erforschung des lebenden Rechts um eine empirische
Ergänzung der RS. Wie M. Rehbinder betont, sollten die
RTF und die soziologische Jurisprudenz Ehrlichs RS vervollständigen: | RTF: Ergänzung der RS |
„Ohne sie wäre die Rechtssoziologie zu einem
Elfenbeinturm-Dasein verurteilt.” | |
Wie nach der späteren, bildhaften Unterscheidung
von Roscoe Pound, ging
es schon Ehrlich darum, nicht nur das „law in the books”,
sondern das „law
in action” zu untersuchen und zu erforschen. Ehrlich schrieb in
dem 1911 in den JBl veröffentlichten Aufsatz „Ein Institut für lebendes Recht”: | law in the books und
law in action |
„Ein Blick in das Rechtsleben zeigt, dass
es ganz überwiegend nicht vom Gesetz, sondern von der Urkunde beherrscht
wird. Das ganze nachgiebige Recht wird vom Urkundeninhalt verdrängt.
In den Ehepakten, Kauf-, Pacht, Baukredit-, Hypothekardarlehensverträgen,
in den Testamenten, Erbverträgen, Satzungen der Vereine und Handelsgesellschaften, nicht
in den Paragraphen der Gesetzbücher muß das lebende Recht gesucht
werden.” (Hervorhebung von mir) | |
Ehrlichs Konzept des „lebenden Rechts”,
das stark vom Rechtsleben der Bukowina beeinflusst ist, fand große
internationale Beachtung. Am wenigsten konnte sich jedoch der deutschsprachige Rechtsraum
mit Ehrlichs Denken anfreunden. Zu stark waren hier reine Dogmatik,
Theorielastigkeit und rechtspositivistisches Gedankengut verbreitet. | Konzept des
„lebenden Rechts” |
 | |
Die RTF fragt auch
danach: Was sind die Tatsachen auf denen das Recht aufbaut? Wie
wird Recht eingesetzt, angewandt, verstanden? Aber auch: Welche
gesellschaftlichen Fakten „setzt” das Recht? – Die Antwort ist gerade
für einen aufgeklärten juristischen Standpunkt schwieriger, als
es erscheinen mag, wie einige Stichworte und Gegensatzpaare veranschaulichen
mögen: | Fragen der RTF |
Naturrecht versus Rechtspositivismus, Sein
und Sollen sowie die daraus abgeleitete Einteilung in Seins- und Sollenswissenschaften,
das Verhältnis von Recht und Gesellschaft, legal isolationism uam.
– Schon Platon erwähnt in seinen „Nomoi”/Die Gesetze, dass ein Gesetzgeber,
der seine Sache ernst nimmt, auch gewisse natürliche Gegebenheiten
und Fakten berücksichtigen müsse: Land und Klima, Binnen- oder Seelage
eines Landes, Wind, Wetter, Geographie, aber auch die Charaktereigenschaften
der Menschen, das Verhältnis der Geschlechter, die politischen und
historischen Rahmenbedingungen (Ausformungen) von Freiheit und Gleichheit,
menschliche Altersgruppen und Zustände (Alte, Schwache, Kinder,
Jugendliche) etc. Heute kennen wir verschiedenste Schutznormen/-einrichtungen:
etwa das Arbeitsrecht, die Adoptionsregeln, KSchG und MRG, PHG oder
Sachwalterschaft, Patientenvertretung und UbG. | |
Vorgegebene Rechts-Tatsachen finden sich demnach in jeder
Rechts-Ordnung und die bunte Vielfalt darauf aufbauender rechtlicher
Lösungen ist auch auf die unterschiedlichen Tatsachen-Voraussetzungen
von Rechtsregeln zurückzuführen. Freilich auch auf die
aus historischen und anderen Gründen unterschiedlich gewachsenen
Rechtskulturen,
denen Ehrlich ebenfalls sein Augenmerk schenkte. | |
Es kann demnach kein Zweifel bestehen, dass Fakten existieren
von denen das Recht auszugehen, die es angemessen zu berücksichtigen
hat, will es seiner Aufgabe gerecht werden. – Neben den unmittelbar
auf der „menschlichen Natur” beruhenden Tatsachen existieren jene
anderen, die durch den Umgang der Menschen miteinander und mit dem
Recht entstehen: Die RTF interessiert sich auch dafür – übrigens
seit der griechischen Antike (Aristoteles, Theophrast), welche Verträge geschlossen
werden, was ihr Inhalt ist, wie die Verfassungen verschiedener Staaten
beschaffen sind, wie und welche Urteile und Bescheide gefällt, wie
Verkehrssitten, Gewohnheitsrecht, rechtlich relevante Sitten beschaffen
sind und festgestellt werden können uvam. Dazu kommt schon bei den
Griechen, die immer wieder diskutierte Frage, ob die Regeln von
Gesellschaften (Recht) sich an der Natur und ihren Gesetzen zu orientieren
haben; sog Nomos-Physis-Problem. – Es wurde daher immer wieder auch
in der Neuzeit danach gefragt, „ob das Recht nach Naturgesetzen
lebt”; vgl F. Gschnitzer, in: FGL 419 ff (1945/1993). | |
 | Abbildung .4: Zum Begriff „Rechtskultur”
(1)-(3) |
|
Die
Lebensferne des Rechtsdenkens stellt/e immer wieder ein Problem
dar. – Die RTF lehrt uns daher auch, dass die Bereiche von Sein
und Sollen keinesfalls, wie das der „Reinen Rechtslehre” vorschwebte,
völlig getrennt und nicht aufeinander bezogen verstanden werden
dürfen. Das zeigt schon die einfache Beobachtung, dass rechtliches
Beurteilen zwischen der Seins- und Sollensebene hin- und herpendelt,
bspw von einer der Seinsebene angehörenden (Rechts)Verletzung ausgeht, diese
rechtlich bewertet und die darauf folgende sanktionierende Sollensanordnung
idR das Ziel verfolgt, erneut eine Änderung des Seinszustands herbeizuführen.
– (Rechts)Empirie fördert zudem das Relevanzempfinden und die Erkenntnisqualität
obendrein. Das wussten schon die Schöpfer der europäischen Rechtswissenschaft:
Platon, Aristoteles und Theophrast. | Lebensferne des Rechtsdenkens |
| |
Die wichtige empirische
Orientierung der RTF dient durch Daten-
und Faktenaufbereitung etwa der Bundes- und Landesgesetzgebung,
aber auch der Politik, Interessenvertretungen und natürlich
auch der Wissenschaft etc. Allgemein können besonders
Rechtspolitik und
Legistik erwähnt
werden. – Der beklagenswerte Zustand des österreichischen Justizstatistikwesens
zeigt uns, wie notwendig eine solide RTF wäre; vgl schon Pkt I.
Der RTF bedürfen aber auch das Rechtsberatungswesen, viele Interessenverbände
sowie Forschung und Wissenschaft, letztere um ihrer kritischen Rolle
gerecht werden zu können. Fehlt die Faktenbasis, die Zahlen, lassen
sich Relevanzaussagen kaum oder überhaupt nicht treffen. Argument
steht dann oft gegen Argument und auch das bessere gewinnt nicht
jene Kraft, die es faktengestützt erlangen könnte. – Der bislang geübte
weitgehende Verzicht von Rechtsdogmatik und (Rechts)Politik auf RTF ist
leider kein zufälliger. RTF vermag Praxis zu erkennen, und zwar
in positiver wie in negativer Hinsicht; wodurch Fehlentwicklungen
rechtzeitig erkannt und beseitigt werden könn(t)en. – RTF ist demnach
auch ein Mittel um Theorie und Praxis einander anzunähern. | Verzicht auf RTF? |
Eugen Ehrlich war sich seiner Pionierstellung
bewusst. In seinem Aufsatz „Soziologie des Rechts” (1913/14) führt
er aus: | Pionierstellung
Eugen Ehrlichs |
„Ich arbeite fast überall auf jungfräulichem
Boden, musste mir oft genug selbst mit der Axt den Weg durch die Dickichte
bahnen; es fehlte an Material, an Vorarbeiten, an Literaturnachweisen;
um nur eine Übersicht über den Stoff zu gewinnen, musste ich fast
alle europäischen Sprachen erlernen und weite Reisen unternehmen.
Aber der Grund dürfte gelegt sein, und wenn darauf zum Teile nur
ein Notbau ausgeführt werden konnte, es werden sich wohl recht bald
andere finden, die den Ausbau im einzelnen übernehmen werden.” | |
Wichtig war Ehrlich
auch die Rolle von RTF und RS für den
Rechtsunterricht.
So wie es Ziel seiner wissenschaftlichen Arbeit war, die Rechtswissenschaft und
die
Rechtspraxis zu
verbessern, hoffte er auch den Lehrbetrieb anregen
und interessanter, lebens- und praxisnäher gestalten zu können.
– Dazu findet sich ein schöner Beleg in seinem Aufsatz „Die Erforschung
des lebenden Rechts” aus dem Jahre 1911: | Rechtsunterricht |
„Es ist bekannt, dass an einigen großen
Universitäten Deutschlands und Österreichs die Hörsäle der juristischen, oder
wie sie in Österreich heißt, der rechts- und staatswissenschaftlichen
Fakultät die eingeschriebenen Hörer gar nicht zu fassen vermöchten.
Trotzdem hat man sie gewiss nur sehr selten überfüllt gesehen. Dem
angehenden Juristen hat eben eine gütige Fee die Fähigkeit in die
Wiege gelegt, die Vorlesungen in seiner Abwesenheit zu hören. Es
gibt kaum ein Gebiet des höheren Unterrichts, wo sich eine solche
Erscheinung annähernd in demselben Masse wiederholte. Im allgemeinen
geizt der Mediziner, der Techniker, der Philosoph nach jedem kostbaren
Tropfen des Wissens, das er sich an der Lehranstalt zu beschaffen
vermag: an der juristischen Fakultät hat der akademische Lehrer
nicht selten das Gefühl, dass ihm seine Hörer einen Gefallen zu
erweisen glauben, wenn sie in seine Vorlesung kommen. Dass der Unterricht
unter solchen Umständen, wenn man von einer kleinen auserlesenen
Schar absieht, keinen glänzenden Erfolg zeitigen kann, ist freilich
zweifellos: ohne werktätige Teilnahme des Schülers kann bekanntlich
der beste Lehrer nicht viel leisten.” – Usw. | |
3. Gesetzliches
und gesellschaftliches Recht | |
Ehrlichs
Forschungen gingen von der Einsicht aus, dass gesetzliches und gesellschaftliches
Recht nicht (immer) übereinstimmen. Das Recht nach dem die Menschen
leben ist oft ein anderes, als das des Gesetzgebers. – Das hat viele
Gründe. Unter anderem den, dass die Gesetze die gesellschaftliche
Wirklichkeit nur unvollkommen und lückenhaft erfassen, was RTF zu
bessern vermag. Dazu treten – für das Rechtsleben und seine Qualität
iSv Lebensverbundenheit – wichtige Verweisungen des Gesetzes auf
ausserrechtliche Normen; vgl § 879 ABGB oder § 242 dtBGB oder §
346 HGB uam. Aber auch klare Gesetzesbefehle bleiben mitunter totes
Recht. Man denke an die Nichtanwendung der §§ 16 ff ABGB bis etwa
1970 für den Bereich des Persönlichkeitsschutzes. Und noch heute
gibt es Juristen, die das nur zögerlich zur Kenntnis nehmen. Wie
zu Zeiten Savignys und Ungers. | |
Man denke auch an das Verständnis der §§
308, 339 oder 364a ABGB oder die Annahme eines dritten Falles der Übergabe
durch Erklärung in § 428 ABGB, der eigentlich aus dem preußischen
ALR stammt. Auch das für Laien kaum zugängliche Verständnis des
§ 429 ABGB (Versendungskauf) gehört hierher, das den Gesetzestext
ins Gegenteil verkehrt. Vgl auch die restriktive Auslegung des §
879 Abs 1 ABGB, das Verständnis der §§ 871, 872 ABGB, die Rspr-Änderung
des § 956 ABGB (Schenkung auf den Todesfall), die aus § 1319 ABGB
gewonnene Analogie auf „Gewachsenes” oder das allzu einengende Verständnis
des wechselbezüglichen Testaments durch die Judikatur. Ganz zu schweigen
davon, dass ganze Rechtsinstitute außergesetzlich entwickelt wurden
und Tag für Tag angewendet, aber vergeblich im Gesetzbuch gesucht
werden. Das gilt für den Eigentumsvorbehalt, die cic, den Wegfall/die
Störung der Geschaftgrundlage uam. | Das Gesetz enthält
nicht alles |
Für Ehrlich war daher die RS die wahre
Rechtswissenschaft. Er übte Kritik an der positivistischen Jurisprudenz
und monierte, wie erwähnt, dass diese das Wesen und die Wirklichkeit
des Rechts nicht wirklich erfasse. Daher ist die herkömmliche ReWi
für ihn eigentlich keine Wissenschaft, sondern blosse Technik und
handwerkliche Kunstlehre für Juristen. – Die RS dagegen erforsche das
Recht als gesellschaftliche Erscheinung, seinen Entstehungs- und
Entwicklungs- sowie seinen Anwendungsprozess. – Daher ist die Jurisprudenz
für ihn auch eine Gesellschafts- oder Sozialwissenschaft; Grundlegung
der Soziologie des Rechts (1913). | RS – wahre
Rechtswissenschaft |
Zur Feststellung des „lebenden Rechts”
dienen
induktive
Methoden der empirischen Sozialforschung: Fragebogen, verschiedene
Arten des Interviews, die Sammlung und Auswertung von Urkunden,
Vertragsformularen, Entscheidungen/Urteilen etc und deren Inhaltsanalyse, aber
auch historisches und zu vergleichendes Material. | Anwendung
induktiver Methoden |
Das
Fruchtbarmachen induktiver Methoden für die Wissenschaft verdanken
wir
Aristoteles,
der aber alles andere als ein Fliegenbeizähler war. Ziel induktiver
wissenschaftlicher Methoden war schon für ihn das Erkennen des Allgemeinen
(im Besonderen) und das wissenschaftliche Aufbereiten von Erfahrungswerten.
– Aristoteles und
Theophrast unternahmen
nicht nur im Bereich der Naturwissenschaften, sondern auch in der
eben erst (durch diese Untersuchungen) geschaffenen griechischen
Rechtswissenschaft umfangreiche empirische Untersuchungen, die von (rechts)geschichtlichen
und (rechts)vergleichenden Betrachtungen begleitet wurden. So untersuchte
Aristoteles bspw 158 griechische Polisverfassungen mit dem Ziel,
die „beste” Verfassung aufzeigen zu können. (Es darf daran erinnert
werden, dass noch heute das Ziel der Rechtsvergleichung in der Suche
nach der „besten” oder doch „besseren” Lösung/en liegt.) Theophrast
erforschte in einer Parallelstudie den Kaufvertrag und die verwendeten Sicherungsmittel
in den griechischen Poleis; insbesondere auch den Kreditkauf. Leider
ist diese wertvolle Studie Theophrasts, mit der die griechische
Privatrechtswissenschaft beginnt, fast vollständig verloren gegangen. | Aristoteles: Schöpfer der wissenschaftlichen Induktion |
Weil
der übliche Rechtsbegriff, der sich idR nur auf
das Gesetzesrecht bezieht, nicht ausreicht, unterscheidet Ehrlich
drei Arten von Recht: |
Ehrlichs Rechtsbegriff umfasst 3 Arten von Recht |
| • (1) Gesellschaftliches
Recht, als die Organisationsregeln der menschlichen Verbände
und deren innere Ordnung; hierher gehören Familie, Vereins- und
Gesellschaftsrecht, RAO, NotO etc. | |
| • (2)
Juristenrecht: Das sind die Entscheidungsnormen/Rechtssätze
und das Verfahrensrecht nach denen die Gerichte Streitigkeiten schlichten
und Anwälte und Notare etc ihre Tätigkeit orientieren. | |
| • (3) Staatliches Recht: Das
sind die Rechtsvorschriften für Polizei, Militär, die Steuergesetze sowie
die Mittel sozialer Gestaltung. | |
Ehrlich schätzt insgesamt die Macht des Staates, sein gesatztes
Recht durchzusetzen, realistisch, gering ein. | |
Den Juristen schreibt
Ehrlich eine bedeutende gesellschaftliche Funktion zu; und zwar
den Richtern, den Vertretern der Rechtswissenschaft, den Anwälten,
den Kautelarjuristen (zB Notaren, Beratungswesen von Kammern, Gewerkschaften,
Vereinen), also all jenen, die später mit dem Begriff des sog Rechtsstabes
bezeichnet wurden. – Den Juristen obliegt es nach Ehrlich auch zwischen
den drei Arten des Rechts zu vermitteln, ihre Regeln zu verflechten
und allenfalls umzuformen. – Gerechte Lösungen zu schaffen ist nach
Ehrlich eine hohe Kunst. Dazu folgender schöner Beleg aus Ehrlichs
Feder: | Bedeutende gesellschaftliche Funktion der Juristen |
„Denn die Gerechtigkeit beruht
zwar auf gesellschaftlichen Strömungen, aber sie bedarf, um wirksam
zu werden, der persönlichen Tat eines Einzelnen. Sie ist darin am
ehesten der Kunst vergleichbar. Auch der Künstler schöpft sein
Kunstwerk, wie wir heute wissen, nicht aus seinem Innern, er vermag
nur das zu formen, was ihm von der Gesellschaft geboten wird; aber
ebenso wie das Kunstwerk, obwohl ein Ergebnis gesellschaftlicher
Kräfte, doch erst vom Künstler mit einem Körper bekleidet werden
muss, so braucht auch die Gerechtigkeit eines Propheten, der sie verkündet;
und wieder gleich dem Kunstwerk, das, aus gesellschaftlichem Stoffe
geformt, vom Künstler den Stempel seiner ganzen Persönlichkeit erhält,
verdankt die Gerechtigkeit der Gesellschaft nur ihren rohen Inhalt,
ihre individuelle Gestalt dagegen dem Gerechtigkeitskünstler, der
sie gebildet hat. Wir besitzen weder eine einzige Gerechtigkeit
noch eine einzige Schönheit, aber in jedem Gerechtigkeitswerk ist
die Gerechtigkeit, ebenso wie aus jedem wirklichen Kunstwerk die
Schönheit zur Menschheit spricht. Die Gerechtigkeit, so wie sie
in Gesetzen, Richtersprüchen, literarischen Werken individuell gestaltet
wird, ist in ihren höchsten Äußerungen das Ergebnis genialer
Synthese der Gegensätze, wie alles Großartige, das je geschaffen
worden ist.” (Grundlegung der Soziologie des Rechts, 1913: Hervorhebungen
von mir) – Damit gibt sich Ehrlich als Vertreter der griechischen
Mesoteslehre (Solon, Platon, Aristoteles), also der Lehre von der
„Mitte” zu erkennen. | |
4. Ehrlichs
Methodenkritik | |
Sein
Wissenschaftsverständnis ließ Ehrlich auch die herrschenden Rechtsanwendungsmethoden seiner
Zeit und insbesondere den Rechtspositivismus kritisieren. Seine
Verwurzelung in der österreichischen (Privat)Rechtsordnung war dabei
prägend. Bedauerlicher Weise ist sein fertiggestelltes (Grundlagen)Werk
zu diesem Fragenkreis – es handelte sich um die überarbeitete und
beträchtlich erweiterte Fassung seiner Programmschrift: „Freie Rechtsfindung
und freie Rechtswissenschaft” von 1903 (dazu gleich mehr) – verloren
gegangen. Sie trug den Titel: „Theorie der richterlichen Rechtsfindung”,
was mE dem, was Ehrlich uns vermitteln wollte, gerechter wird als
der alte Titel, und enthielt auch Ausführungen über die Methoden
und Ergebnisse seiner empirischen Rechtsforschungen; vgl M. Rehbinder,
„Einleitung” zu „Recht und Leben” 7. Dieses Verständnis Ehrlichs wurde
später von R. Dworkin (übernommen? und) fortgeführt. Es wurzelt
signifikant in der österreichischen Rechtsordnung. | „Freie Rechtsfindung und freie Rechtswissenschaft” |
Ehrlich wurde mit
der eben erwähnten Programmschrift zum Begründer und einem der geistigen Galionsfiguren
der sog
Freirechtsschule,
der neben ihm insbesondere auch Hermann
Kantorowicz (1877-1940),
Ernst
Fuchs (1859-1929)
und Hermann
Isay (1873-1938)
angehörten. | Freirechtsschule |
Kritisiert
wurde von der Freirechtsbewegung vor allem das Dogma des Rechtspositivismus
von der
Lückenlosigkeit der Rechtsordnung und
der daraus abgeleiteten Behauptung, die Rechtsordnung halte für
jeden „Fall” bereits eine Lösung bereit, weshalb der Richter bloß
korrekt zu subsumieren brauche; Subsumtionsautomat. – Demgegenüber
betonte Ehrlich, dass der Richter nicht bloß „la bouche, que prononce
la parole de la loi” (Montesquieu) sei, sondern ein eigenverantwortliches Organ
der Rechtsanwendung und Rechtsfortbildung. | Kritik am Dogma der Lückenlosigkeit der Rechtsordnung |
Diese Position Ehrlichs wurzelt im Verständnis
des § 7 ABGB, der von Karl Anton von Martini gegen beträchtliche Widerstände
in den Jahren 1792-1796 durchgesetzt worden war; vgl dazu ua meine
Ausführungen, in: Barta/Palme/Ingenhaeff (Hg), Naturrecht und Privatrechtskodifikation
71 ff (1999). Ehrlichs Orientierung am ABGB wurde gerade von deutschen
Betrachtern übersehen. Falsche und unberechtigte Kritik an Ehrlich
und der Freirechtsschule war die Folge. Der Vorwurf, sie hätte eine
arbiträre Rspr ohne jede Bindung an das Gesetz gefordert, ist aber
falsch. Ehrlich forderte im Gegenteil vom Richter Gesetzestreue,
sofern sich ein Fall aus dem Gesetz entscheiden lasse und vertrat
– wie das ABGB – die Meinung, dass der Richter nur bei Vorliegen
einer Lücke ohne explizite gesetzliche Grundlage jedoch „im Geiste
des bestehenden Rechtes” entscheiden dürfe; vgl „Über Lücken im
Rechte”, in: „Recht und Leben” 80 ff. Auch hier nahm er also keine
normativ ungebundene richterliche Freiheit an, sondern eine iSd ABGB
mittelbar an den Regelungsgehalt des Gesetzes und der Rechtsordnung
(ABGB: „natürliche
Rechtsgrundsätze”) gebundene Entscheidungskompetenz des Richters.
Diejenigen, die Ehrlichs vielleicht nicht ganz glücklich bezeichnete
„freie“ Rechtsfindung und „freie“ Rechtswissenschaft kritisieren,
nehmen für sich oft viel größere Freiheiten in Anspruch, als dies
Ehrlich je in den Sinn gekommen wäre. | Falsche und unberechtigte Kritik
an der
Freirechtschule |
Ehrlich betonte, in der österreichisch-naturrechtlichen
Tradition K. A. v. Martinis stehend, die
schöpferische Richterpersönlichkeit.
Dies auch uH auf England, die USA und Rom. (Das historisch grundlegende
griechische Rechtsdenken bezog er als Römischrechtler nicht in seine
Forschungen ein.) Er schränkte aber zusätzlich ein, wenn er ausführt:
„Die freie Rechtsfindung ist konservativ wie jede Freiheit, denn
Freiheit bedeutet eigene Verantwortung, Gebundenheit wälzt die Verantwortung
auf andere ab.” – Fragen kann man vielleicht, ob eine solche Haltung
das epiteton ornans „konservativ” verdient. | |
Ehrlichs
fundierte und leidenschaftliche (Methoden)Kritik stieß auch auf
die Ablehnung manches Rechtsdogmatikers und der Schuljurisprudenz
sowie – vor allem – des Rechtspositivismus. Es kam ua zu einer eingehenden Kontroverse
mit dem Rechtspositivismus in der Person Hans Kelsens: Vgl
ARSP (Archiv für Rechts- und Sozialpolitik) 1915, 839 (Kelsen);
ARSP 1916, 844 (Ehrlich); ARSP 1916, 850 (Kelsen-Replik); ARSP 1916/17,
609 (Ehrlich-Duplik) und ARSP 1916/17, 611 (Kelsen-Schlusswort). | Kontroverse mit Kelsen |
Inhaltlich richtete sich Ehrlichs
soziologische
Jurisprudenz samt Freirechtsbewegung aber nicht nur gegen
den Rechtspositivismus, sondern auch gegen die im 19. Jahrhundert
starke
Begriffsjurisprudenz,
der es – cum grano salis – um die Ableitung/Deduktion von Rechtssätzen
aus Begriffen (wie Rechtsgeschäft oder juristische Person) ging.
Aus der Existenz solch’ normativer Begriffe wurden weitere rechtlich
relevante Konsequenzen logisch abgeleitet. G. F.
Puchta (1798-1846),
der Nachfolger F. C. v.
Savignys (1779-1861) in der
Führung der Historischen Rechtsschule, B.
Windscheid (1817-1892)
und der jüngere R. v.
Ihering (1818-1892) waren ihre Hauptvertreter.
Begriffe wurden hierarchisch gegliedert, was Puchta „Genealogie
der Begriffe” nannte und Ihering meinte: „Die Begriffe sind produktiv,
sie paaren sich und zeugen neue.” (Geist des römischen Rechts, Bd
I und II, 1866²/1869²). Berühmt-berüchtigt ist Iherings starres
Festhalten an der Verschuldenshaftung noch zu einer Zeit, für welche
die gewerblich-industrielle Entwicklung längst eine effiziente Gefährdungshaftung
benötigte. (Der entscheidende Fortschritt kam daher nicht durch
die Rechtsdogmatik des gemeinsamen Zivilrechts, die in dieser sensiblen
gesellschaftlichen Phase – mangels adäquater Orientierung am gesellschaftlich
Erforderlichen – versagt hatte, sondern durch helle Köpfe der Bismarckadministration.)
Iherings pseudowissenschaftlich an die Naturwissenschaften angelehnte
Formulierung lautete: | Kritik an der
Begriffsjurisprudenz |
„Nicht der Schaden verpflichtet zum Ersatz,
sondern die Schuld – ein einfacher Satz, ebenso einfach wie der
des Chemikers, dass nicht das Licht brennt, sondern der Sauerstoff
der Luft.” | |
Dem fügte der damals methodisch noch verblendete Ihering,
die Quelle seiner Erkenntnis nennend hinzu: | |
„… das Römische Recht führte mich über sich
selbst hinaus, indem es mir Gedanken von allgemein gültiger Wahrheit
entgegenbrachte.” | |
 | |
Das Programm der Begriffsjurisprudenz war
aber insgesamt nicht so reaktionär wie das mitunter dargestellt
wird, aber ihre gesellschaftsfernen logisch-konstruktivistischen
Annahmen bedurften der Korrektur. Ihre Entstehung war wohl auch
eine Folge der in Deutschland fehlenden Kodifikation und der Weigerung
der politisch wie universitätsorganisatorisch starken Historischen Rechtsschule,
Konsequenzen aus der gesellschaftlichen Entwicklung für das Recht
zu ziehen. (Daraus ließe sich manches lernen!) | |
Ihering wandte
sich später von dieser Position ab und ironisierte sie sogar in
seinem Werk „Scherz und Ernst in der Jurisprudenz” (1884); vgl auch
sein Werk „Der Kampf um’s Recht” (1872). Hauptwerk der späteren
Schaffensperiode Iherings ist „Der Zweck im Recht” (2 Bde: 1877/1883), womit
Ihering zum Ahnherrn der
Interessenjurisprudenz wird,
als deren Vertreter Philipp
Heck (1858-1943),
Heinrich
Stoll (1891-1937)
und Rudolf
Müller-Erzbach (1874-1959)
gelten. Diese neue methodisch-theoretische Orientierung bedeutet
auch eine Öffnung des Rechts- und Zivilrechtsdenkens in Richtung
Gesellschaft und der sie bestimmenden Kräfte, worin ein erster Ansatz in
Richtung soziologische Jurisprudenz liegt. | Interessenjurisprudenz |
 | Abbildung .5: Eugen Ehrlich: Freirechtsschule
(1) bis (3) |
|
5. Zur Bedeutung Eugen Ehrlichs | |
Die praktische Wirkung von Ehrlichs Kritik
an der Rechtswissenschaft seiner Zeit war beachtlich. Und sie war
– wie erwähnt – im nichtdeutschsprachigen Ausland noch viel größer
als in Deutschland und Österreich. In seiner – und damit der österreichischen
– Tradition stehen nicht nur die RS und die RTF,
sondern – zum Teil fast unbemerkt – auch die noch heute existente
und anerkannte Interessenjurisprudenz samt neueren
Methodenlehren (J. Esser, K. Larenz, W. Fikentscher; in
den USA weist das Denken R. Dworkins in Bezug auf dessen Verständnis
der Rechtsanwendung eine starke Affinität auf) und die moderne Rspr,
für die Lückenfüllung und moderate richterliche Rechtsfortbildung
selbstverständlich geworden sind. – Man sollte dabei nicht übersehen,
wie modern die Konzeption des ABGB in ihrer harmonischen Verschränkung
von Auslegung und Lückenfüllung von Anfang an gewesen ist und welch’
unfruchtbare Auseinandersetzungen Österreich dadurch erspart blieben.
„Bekämpft” werden musste in Österreich – neben dem Rechtspositivismus
– „nur” die Historische Rechtsschule, deren österreichischer Vertreter
J. Unger war; dazu → KAPITEL 4: Die
Persönlichkeitsrechte:
Persönlichkeitsrechte. | |
Dass es in
Österreich bislang weder ein (Universitäts)Institut, noch im BMfJ
eine Abteilung für RTF gibt, gereicht unserem Land nicht zur Ehre.
– Ein
Eugen-Ehrlich-Institut mit
einem adäquaten Aufgabenbereich ist überfällig. Die Politik ist
aufgerufen, dies so rasch wie möglich nachzuholen. Vgl auch das
unter Pkt I Gesagte. | Eugen-Ehrlich-Institut |
 | Abbildung .6: Max Weber: Porträt
(1) bis (6) |
|
 | Abbildung .7: Max Weber: Vertragsfreiheit (1) bis (10) |
|
 | Abbildung .8: Max Weber: Methode
(1) + (2) |
|
 | Abbildung .9: Max Weber: Konzept des „Idealtypus” (1) bis (4) |
|
 | Abbildung .10: Max Weber: Werturteilsfreiheit
(1) bis (5) |
|
 | Abbildung .11: Arthur Nussbaum: 1877-1964 (1) bis (3) |
|
 | Abbildung .12: Arthur Nussbaum: Pogramm
der RTF (1) bis (6) |
|
 | Abbildung .13: Was will die RTF? |
|
 | Abbildung .14: Wichtigste Anwendungsbereiche
der RTF (1) + (2) |
|
 | Abbildung .15: Aristoteles und Theophrast |
|
 | Abbildung .16: Methoden der RTF (1)
bis (10) |
|
 | Abbildung .17: ”Kausalität im Sozialrecht” (1) bis (5) |
|
 | Abbildung .18: Judikaturanalyse (1)
bis (6) |
|
 | Abbildung .19: RTF und Altenrecht – zusammengestellt von M. Ganner (1) bis
(23) |
|
 | Abbildung .20: J.
Fedynskyj, Rechtstatsachen auf dem Gebiete des Erbrechts im Gerichtsbezirk
Innsbruck 1937-1941 (1968) – zusammengestellt von F. J. Giesinger
(1) bis (13) |
|
 | Abbildung .21: Rechtstatsachen im
Organtransplantationswesen in Deutschland, Österreich und der Schweiz
– zusammengestellt von Elmar Sebastian Hohmann (1) bis (51) |
|
6.
Statistisch-rechtstatsächliche
Hilfsmittel | |
Hier sollen nur einige kurze weiterführende Hinweise gegeben
werden, was trotz der
Justiz-Daten-Misere in Österreich ”gefunden”
werden kann. Ich beschränke mich dabei auf eine Internetdarstellung,
weil das Angebot wahrlich keine Bäume ausreißt: | |
 | Abbildung .22: Statistische Hilfestellungen
in Österreich |
|
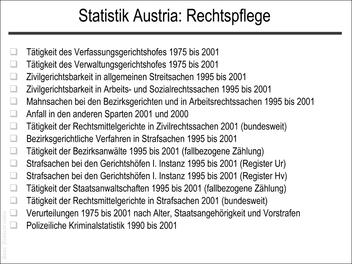 | Abbildung 18.23: Statistik Austria: Rechtspflege |
|
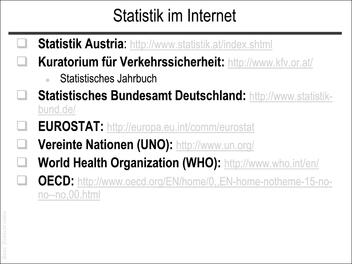 | Abbildung 18.24: Statistik im Internet |
|
C.
Weltbild, Menschenbild und Menschenwürde – Zur
Rolle der Medizin in modernen Gesellschaften |
I. Weltbild
und Menschenbild im Spannungsfeld von Recht und (Transplantations)Medizin | |
Wie die Generationen
vor uns, haben auch wir unser Weltbild aufzubauen,
das immer weniger dem unserer Vorfahren gleicht. Teil dieses Weltbildes
ist das Menschenbild und – daraus fließend – das Verständnis
der Menschenwürde. Zu unserem Menschenbild und
unserem Verständnis der Menschenwürde zählen auch die über den Tod
hinaus reichenden Persönlichkeitsrechte auf ein würdevolles Sterben
(§ 5a KAKuG) und einen pietätvollen Umgang mit dem toten menschlichen
Körper; §§ 16, 17 ABGB iVm § 62a Abs 1 KAKuG. Dazu tritt der strafrechtliche
Schutz der Totenruhe nach § 190 StGB. | |
Mit dem Weltbild – das ebenfalls keine
statische Größe darstellt – ändern sich auch seine Teile und umgekehrt.
– Fragen von Recht und Medizin reichen tief in diese Sektoren hinein,
was für uns von Bedeutung ist. Auch die Rechtsphilosophie ist
gefordert, schweigt aber zu oft. – Weltbilder werden von Gesellschaften
nicht autoritativ vorgefertigt, mag es auch (vor)herrschende Strömungen
und Antworten geben. Wir alle sind gefordert, einen Beitrag zum
gegenwärtigen Weltbild sowie zu den Konturen des Menschenbildes
und der Menschenwürde zu leisten. Bestehen diese Begriffe doch aus
Versatzstücken kollektiver und individueller Provenienz. | Die Rechtsphilosophie
ist gefordert |
1. Medizin und
Menschenbild | |
Die Medizin bräuchte ein ganzheitliches Menschenbild auf
der Höhe der Zeit. Aber Medizin- und Bioethik greifen immer wieder
zu kurz. Der Begriff des Menschenbildes wird zwar mitunter bemüht,
aber meist zur Rechtfertigung eigenen Handelns. In Frage gestellt
wird meist zu wenig. Ergänzt wird das oft noch durch den Hinweis
auf einen persönlichen religiösen Hintergrund, was die Sache nicht
einfacher macht. – Dazu kommt: Entscheidungen in diesem wichtigen
Bereich menschlicher Existenz sollten nicht im Schnellverfahren
getroffen werden. Sie brauchen Zeit und Sorgfalt, demnach Eigenschaften,
denen die Politik häufig keine größere Bedeutung beilegt, von der
Wissenschaft aber eingemahnt werden müssen. – Ein Zurückdrängen
der Fächer Rechtsphilosophie, Rechtsgeschichte, Rechtsvergleichung
und Rechtssoziologie fördert diese Erkenntnisprozesse nicht, sondern
unterläuft sie. Der Medizin, Politik und der Wirtschaft sind aber abhängige und ungebildete
Juristen/innen lieber, als autonom denkende. | |
Aber ist die
Transplantationsmedizin im Vergleich zu gentechnischen
Anthropotechniken nicht harmlos?
– Darauf ließe sich antworten, dass jeder Antihumanismus seine Wegbereiter
braucht. Und könnte nicht eine Transplantationsmedizin, die nicht
nur innere Organe, sondern auch – wie bereits praktiziert – immer
weitere Gliedmaßen anderer Menschen nützt, zu einem Vorreiter jener Methoden
werden, mit denen dann, gleichsam als „bessere medizintechnische
Lösung” nach der Transplantationsmedizin, neue Menschen oder Hominiden
als körperliche „Reparaturlager” oder wozu auch immer gezüchtet
werden? (Im Bereich des embryonalen Klonens werden bereits heute Mischwesen/Chimären hergestellt; vgl
Der Standard, 17. 9. 2003, S. 30.) – Man muss also fragen: Mündet
der vordergründige medizinische Humanismus – der sich bereits heute
bedenkenlos über geltendes Recht hinwegsetzt – ins Inhumane? Vielleicht
kann man es mir aus humanistischen Gründen nachsehen, dass ich zu
dem, was die Medizin und manche Rechtswissenschaftler machen und
vertreten, nicht nur Beifall klatsche. – Es erhebt sich daher die
unabweisbare rechts-philosophische Frage auch in Bezug auf Medizintechniken:
Sollen wir wirklich alles machen und wollen, was wir können? | Anthropotechniken? |
2. Rechtspolitische
Voraussicht | |
Bei der Diskussion und Interpretation dieser Fragen lassen
sich zwei Ebenen unterscheiden: | |
| • eine juristisch-hermeneutische und
eine | |
| • der menschlichen Besonnenheit, Klugheit und rechtspolitischen
Voraussicht. | |
Auf
der ersten Ebene halte ich manche Meinungen, etwa die von Staatssekretär
Waneck, aber auch die des Innsbrucker Transplantationsteams für
interpretativ unausgewogen; auf der zweiten Ebene erscheinen sie
mir obendrein unklug und der Erhaltung der österreichischen Widerspruchslösung, für
die es einzutreten gilt, abträglich. Es ist unklug, weil, sollte
sich die Meinung durchsetzen, dass sowohl die derzeit eindeutig
illegale
Multiorganspende wie
wohl auch das
Abtrennen von Extremitäten bereits
de lege lata für zulässig erachtet wird, dies zur Folge haben wird,
dass immer mehr Österreicherinnen und Österreicher wenigstens eine
Teilwiderspruchserklärung abgeben werden. | Unkluge und illegale Praktiken |
Dies zeigt uns, dass der moderne
Staat kaum mehr in der Lage ist, in bestimmten Bereichen der Rechtsordnung
für die Beachtung seines Rechts zu sorgen. Staatliches Recht
wird von der Medizin in diesem Bereich ignoriert.
Die Medizin stellt sich, unterstützt von einer fragwürdigen Politik,
über das demokratische Gesetz. Es handelt sich rechtstheoretisch
um (Rechts)Geltungsprobleme. Das hat einerseits mit der Stärke bestimmter
gesellschaftlicher Gruppen zu tun, hier der Medizin; zum anderen
mit der Verfilzung von Medizin und Politik. Demokratisch ist diese
Entwicklung als bedenklich anzusehen, zumal andere Gesellschaftsbereiche
folgen. | Medizin und
demokratisches Gesetz |
Eine solche
(Zweck)Interpretation durch die Medizin durch willfährige oder allzu
fortschrittsgläubige Juristen widerspricht aber meines Erachtens
auch dem demokratischen Konsens des Jahres 1982 und schlägt dem
damals einstimmig gesetzlich beschlossenenen Menschenbild ins Gesicht.
Es mag schon sein, dass für manche Menschen der Begriff der
Pietät nicht
mehr zählt oder lästig ist; aber diese müssten dann den Mut besitzen,
einen neuen demokratisch-politischen Konsens in Bezug auf diese
Frage zu suchen. Und wenn diese Kreise meinen, dies nicht erreichen zu
können, müssen sie sich wohl oder übel mit dem geltenden rechtlichen
Rahmen begnügen. Das ist besser, als sich über das Gesetz hinweg
zu setzen und so zu tun, als wäre ohnehin alles in Ordnung. Das
ist das Schlechteste, was man tun kann. Denn dadurch wird auf Dauer
sowohl der Weiterbestand der Widerspruchslösung gefährdet, als auch
der Demokratie ein Bärendienst erwiesen. | Begriff der „Pietät“ |
Verspielt wird dadurch auch die Möglichkeit,
anhand dieser Frage paradigmatisch das Verhalten unserer Gesellschaft
in Hinblick auf den Umgang mit dem enormen und akzelerierten disziplinären
Fortschritt einzuüben. Wir sollten uns daher – bei aller Fortschrittsoffenheit
– auch fragen, ob wir es uns leisten können, ganze Bereiche unserer
Gesellschaft aus der Legitimität und der demokratischen Gesetzesbindung
zu entlassen. Es wäre feige, diese rechtliche unpolitische Herausforderung
nicht sehen zu wollen und wir sollten auch nicht so naiv sein, von
den unmittelbar betroffenen Disziplinen die Lösung dieser schwierigen
Fragen zu erwarten. Unsere sich rasch wandelnden Gesellschaften
werden uns künftig wohl noch öfter vor die Frage stellen, ob wir
auch all das machen sollen, was wir zu tun in der Lage sind. Das
mag die Technik, die Wirtschaft, die Politik oder die Medizin betreffen.
Um solch grundlegende Fragen möglichst richtig und gerecht beantworten
zu können, brauchen wir wenigstens annähernde Klarheit über
jenes Menschenbild, dem wir folgen wollen. Je klarer wir
entscheiden, umso weniger Überraschungen wird es geben. Allzu optimistisch
dürfen wir dabei aber vorerst nicht sein! | Rechtlicher Umgang mit disziplinärem
Fortschritt |
Wir dürfen dabei nicht vergessen: Aufgabe
des Rechts ist es, zum Vorteil der Menschen eines Gemeinwesens und (!)
der jeweiligen Gesellschaft zu wirken. – Recht soll Gesellschaft
möglich machen! | |
II. Rechtsfragen
der Transplantationsmedizin
in Österreich (mit Links) | |
Zunächst
einige Klarstellungen, um Missverständnisse möglichst auszuräumen.
Ich befürworte die österreichische Widerspruchslösung,
weil ich meine, dass diese eine vertretbare Mitte hält zwischen
den beiden Polen, die für eine Lösung des Transplantationswesens
zu berücksichtigen sind; nämlich der
Spenderautonomie auf
der einen und gesellschaftlicher Solidarität (im
Bewusstsein des individuellen Eingebundenseins und der Angewiesenheit
des Individuums auf andere in der Gesellschaft) auf der andern Seite.
– Meine Befürwortung bedeutet aber nicht, dass ich der Meinung bin,
dass alles so bleiben sollte, wie es derzeit ist! Ich meine vielmehr,
dass es eine Reihe wichtiger Gründe gibt, unsere geltende Widerspruchslösung
zu verbessern und zu diesem Zwecke zu überdenken. Diese Gründe sind
recht(sinhalt)licher, rechtstechnisch-organisatorischer, aber insbesondere
auch rechtsethischer und demokratiepolitisch-rechtsstaatlicher Natur.
Ich bin überhaupt der Meinung, dass unsere Widerspruchslösung den
Widerspruch ernster nehmen muss als bisher, soll sie auf Dauer Bestand
haben. | Wir benötigen ein öTPG |
1. Deutschland,
Schweiz, Europarat | |
Die Tatsache,
dass unser nördlicher Nachbar, Deutschland, 1997
ein neues Transplantationsgesetz beschlossen hat und auch die Schweiz 1999
einen umfangreichen Gesetzesentwurf erstellt hat und diskutiert,
der aufgrund eines Volksentscheids verfasst wurde, zeigt, dass hier
etwas in Bewegung geraten ist. Dazu kommt, dass der Europarat 1997
die sog Bio-Ethik-Konvention verabschiedet hat, die unter anderem
die Lebendspende (Art 19 ff) regelt und darüber hinaus vom selben Gremium
1999 der Entwurf eines Zusatzprotokolls (ZP) zu dieser Konvention
erstellt wurde, das unter anderem die Totenspende regeln soll. | Internationale Entwicklung |
 | |
Daneben
bemühen sich die Eurotransplantminister auf rechtlich
unsicherem Terrain um eine Verbesserung der grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit; vgl die gemeinsame Erklärung vom Oktober 1999. –
Ich darf in diesem Zusammenhang feststellen, dass eine europäische
Lösung des Transplantationswesens wünschenswert wäre. Sie
sollte eine europaweite Zusammenarbeit ermöglichen, ohne die Mitgliedsländer
unter das Joch eines einheitlichen Systems zu zwingen. | Europäische Lösung wäre wünschenswert |
| |
2. Praxis des Transplantationswesens
in Österreich | |
Ohne
hier auf die Frage des umstrittenen
Organbegriffs näher
eingehen zu können, möchte ich eine Gegenfrage an jene richten,
die meinen, diesen Begriff beliebig dehnen zu können: Verliert, so
meine Frage, der vom Gesetzgeber – meines Erachtens bewusst ein-
und abgrenzend – im Zusammenhang mit dem Begriff der Pietät gebrauchte
Organbegriff nicht völlig seine Kontur und damit seinen Abgrenzungswert,
wenn man ihn so dehnt, wie das geschehen ist und offenbar weiterhin
geschieht? Besteht dann nicht der ganze Körper nur aus Organen?
Was bleibt dann von der gesetzlich festgeschriebenen „Pietät” übrig,
wenn der gesamte Körper des Menschen von ehrgeizigen Medizinern
als Rohstofflager verwendet wird? – Von einem derart schwammigen
Organbegriff auszugehen, erscheint fragwürdig. Der Gesetzgeber von
1992 war hier jedenfalls anderer Meinung. | Strapazierter Organbegriff – Achtung des Gesetzes? |
Gegen
die gelebte Praxis des Transplantationswesens in Österreich lassen
sich daher wichtige Bedenken vorbringen, und zwar
– wie erwähnt – solche rechtsethischer, interpretativer, aber auch rechtstechnisch-organisatorischer
und demokratiepolitisch-rechtsstaatlicher Art. Denn auch die Medizin
untersteht der Rechtsordnung und ist kein Arkanbereich,
der legibus solutus handeln darf. Das führt mich zum zweiten Teil
meines Themas: Dem Verhältnis von Medizin und moderner Gesellschaft. | Untersteht auch die Medizin der RO? |
Wenn
ich disziplinäre Sorgen in Bezug auf das Verhältnis von Recht und
Medizin äußere, geschieht dies nicht aus Besserwisserei oder in
Einmischungsabsicht (wie das seitens der Medizin gerne abwehrend
gesehen wird), sondern in der Hoffnung, dass es gelingt, die Medizin
künftig besser in die Gesellschaft und unser Rechtssystem zu integrieren
und sie zu ihrem eigenen Wohl – möglichst ohne störende Nebenwirkungen
– gesellschaftlich tätig sein zu lassen. Es kann dabei nicht schaden, das
disziplinäre Verhältnis von Recht und Medizin immer wieder zu hinterfragen.
Das gilt natürlich für beide Seiten! Es geht dabei auch um Rechtssicherheit für
„beide” Seiten der Transplantation: die Spenderseite und die Medizin.
Aber auch um ein Respektieren recht(staat)licher Parameter. | Medizin und moderne Gesellschaft |
Diese Klarstellungen erscheinen
auch deshalb nötig, weil erfreuliche Fortschritte der Immunologie weitere
Fortschritte der Transplantationsmedizin erwarten lassen. Das erfordert
aber auch rechtliche Klarstellungen. Dazu kommt, dass die Frage
der Stammzellenzüchtung,
des therapeutischen Klonens
und der Xenotransplantation
als mögliche (Weiter)Entwicklungen der nächsten Jahre angesehen
werden müssen. Auch sie benötigen einen rechtlichen Rahmen. Allein
es fehlt bislang an rechtspolitischer Vorsorge. | Fortschritte der
Transplantationsmedizin |
Die
Realisierung von § 3 unseres Entwurfs besäße den
Vorteil, die Politik, das heißt überhaupt die gesellschaftlichen
Machtträger zu animieren, Farbe zu bekennen, wenn die dort genannten
neuen Medizintechniken zur Anwendung gelangen sollen. Ohne diese
Bestimmung erscheinen Politik und Interessensvertretungen in hohem Maße
versucht, den nötigen Antworten auszuweichen und diese de facto
dem jeweiligen Sachbereich – hier der Medizin – zu überlassen, der
aber zur Beantwortung dieser Fragen weder demokratisch legitimiert
noch politisch dafür Verantwortung zu tragen hat. – Das Ziel, den Entwurf
eines österreichischen Transplantationsgesetzes vorzulegen
liegt demnach darin, einen rechtspolitischen Diskurs anzuregen,
der bestehende Hoffnungen und Ängste (der Bevölkerung), aber auch
Machtinteressen (involvierter Bereiche) zutage treten lässt und
diesen wichtigen Gesellschaftsssektor nicht im Nebel scheinbarer
Sachfragen belässt. Der Diskurs böte aber auch für die Medizin und
ihre Machtapparate die Chance, allmählich die Sprache einer breiteren
gesellschaftlichen Problemfindung zu erlernen, die nicht die eigenen
Interessen mit gesellschaftlicher Wahrheitsfindung verwechselt;
und für das Recht und seine Vertreter beinhaltete dies die Chance,
sehen zu lernen, wo die Gefahr politischer Handlangerdienste
und politischer Willfährigkeit beginnt. Das mag idealistisch
klingen, ist aber – ganz im Gegenteil – sehr realistisch, freilich
nur in dem Sinne, dass ein solches Vorgehen für unsere politische
Rechtskultur von Vorteil wäre, mögen auch die Chancen dafür
gering sein. Es sei daher noch einmal betont, dass Fragen wie diese keine bloßen
medizinischen Fachfragen sind, sondern solche, die einer politisch-demokratischen
Antwort bedürfen. Medizin erscheint dabei, wie übrigens
auch das Recht – wenngleich in unterschiedlicher Weise – als Hilfsdisziplin im
Rahmen der Aufbereitung einer nötigen politischen Entscheidung.
Dadurch könnte auch der viel beschworene Primat des Politischen unterstützt
und in diesem Felde aufgezeigt werden, dass auch schwierige und
scheinbar reine Sachfragen (in Spezialfragen) einer politisch-gesellschaftlichen
Lösung zum Wohle des Ganzen möglich sind und keineswegs der immer
wieder behauptete Sachzwang besteht, diesen Fragen politisch aus
dem Weg zu gehen. | Primat des Politischen? |
Es geht also auch darum, in modernen Gesellschaften darauf
zu achten, den Primat des Gesamtgesellschaftlich-Politischen zu
wahren und zu stärken. Moderne Gesellschaften laufen nämlich allenthalben
Gefahr, von Partikularinteressen überrannt und
– zum Nachteil des Ganzen – an die Wand gedrückt zu werden. Das
lehrt uns neben der Ökonomie (Globalisierung, Multis, blinde ideologische
Privatisierung der Märkte etc) unter anderem auch die Medizin, zumal
dieser Bereich starke wirtschaftliche Affinitäten aufweist, was
Problemlösungen nicht erleichtert. – Damit ist noch nicht gesagt,
dass der politische Sektor, die auf ihm lastende gesellschaftliche
Verantwortung bereits wahrnimmt. Es sieht vielmehr danach aus, als
würde auch dieser Bereich versagen. Das kann aber nicht bedeuten,
dass die Wissenschaft diesem Versagen Beifall zu klatschen hat. | |
3. Zur gegenwärtigen
Rechtslage | |
Über
die gegenwärtige Rechtslage und die „Vorstellungen” des
Gesetzgebers von 1982 soll kurz mittels „Links”
informiert werden, was den Text nicht belastet: | „Links” zum besseren Verständnis |
| • Link-1: Der Text der KAG-Novelle 1982
– §§ 9, 10 KAG | |
| • Link-2: Regierungsvorlage 1982 | |
| • Link-3: Der Ausschußbericht | |
| • Link-4: III. Welche Themenbereiche des TP-Sektors
gehören gesetzlich geregelt? | |
| • Link-5: IV. Welche Organe dürfen entnommen
werden? – Zur Frage der Multiorganspende | |
| • Link-6: V. Transplantation und Pietät | |
| • Link-7: VI. Plädoyer
für eine neues TPG. | |
Entwicklung der Organ-Transplantationsfrequenzen
in Österreich 1971 bis 1999 | Jahr | Herz | Lunge | Leber | Niere | Pankreas | | 1971 | | | | 17 | | | 1972 | | | | 34 | | | 1973 | | | | 63 | | | 1974 | | | | 95 | | | 1975 | | | | 85 | | | 1976 | | | | 61 | | | 1977 | | | | 72 | | | 1978 | | | 1 | 70 | | | 1979 | | | | 92 | 1 | | 1980 | | | 1 | 93 | 1 | | 1981 | | | 2 | 106 | | | 1982 | | | 7 | 156 | 1 | | 1983 | 1 | | 14 | 151 | 5 | | 1984 | 8 | | 18 | 233 | 7 | | 1985 | 17 | 1 | 28 | 238 | 8 | | 1986 | 39 | 3 | 30 | 280 | 11 | | 1987 | 43 | 6 | 57 | 351 | 24 | | 1988 | 46 | 3 | 32 | 306 | 8 | | 1989 | 56 | 6 | 56 | 411 | 7 | | 1990 | 82 | 22 | 80 | 424 | 11 | | 1991 | 68 | 24 | 60 | 396 | 8 | | 1992 | 90 | 32 | 66 | 322 | 14 | | 1993 | 110 | 38 | 91 | 386 | 16 | | 1994 | 95 | 37 | 96 | 350 | 12 | | 1995 | 108 | 28 | 109 | 305 | 9 | | 1996 | 105 | 29 | 131 | 363 | 8 | | 1997 | 95 | 33 | 134 | 334 | 25 | | 1998 | 95 | 62 | 134 | 374 | 31 | | 1999 | 95 | 70 | 151 | 421 | 30 |
| |
Kombinierte Transplantationen werden nicht extra
angeführt – Quelle: ET-Dokumentation (ÖBIG ´99) | |
Text
der KAG-Nov 1982
| Link-1 |
§ 9
KAG. (1) Für die in Krankenanstalten beschäftigten Personen besteht Verschwiegenheitspflicht,
sofern ihnen nicht schon nach anderen gesetzlichen oder dienstrechtlichen
Vorschriften eine solche Verschwiegenheitspflicht auferlegt ist.
Die Verpflichtung zur Verschwiegenheit erstreckt sich auf alle die
Krankheit betreffenden Umstände sowie auf die persönlichen, wirtschaftlichen
und sonstigen Verhältnisse der Pfleglinge, die den Anstaltsangehörigen in
Ausübung ihres Berufes bekannt geworden sind; bei Eingriffen
nach § 62a auch auf die Person des Spenders und des Empfängers. | |
§
10 KAG | |
(1) Durch die Landesgesetzgebung sind die
Krankenanstalten zu verpflichten: | |
1 ... ... | |
2 ... ... | |
3 ... ... | |
4 ... ... | |
5 ... ... | |
6. über Entnahmen nach § 62a Niederschriften
zur Krankengeschichte aufzunehmen und gemäß Z 3 zu verwahren. | |
Hauptstück F | |
Entnahme von Organen oder Organteilen
Verstorbener zum Zwecke der Transplantation [Überschriften
als Marginalien? Wenn ja , bitte noch machen, ich trau mich nicht!] | |
| |
§ 62 a KAG | |
(1) Es ist zulässig, Verstorbenen einzelne Organe
oder Organteile zu entnehmen, um durch deren Transplantation das
Leben eines anderen Menschen zu retten oder dessen Gesundheit wiederherzustellen.
"Die Entnahme ist unzulässig, wenn den Ärzten eine Erklärung vorliegt,
mit der der Verstorbene oder, vor dessen Tod, sein gesetzlicher
Vertreter eine Organspende ausdrücklich abgelehnt hat. Die Entnahme
darf nicht zu einer die Pietät verletzenden Verunstaltung der Leiche
führen." | |
(2) Die Entnahme darf erst durchgeführt werden,
wenn ein zur selbständigen Berufsausübung berechtigter Arzt den
eingetretenen Tod festgestellt hat. Dieser Arzt darf weder die Entnahme
noch die Transplantation durchführen. Er darf an diesen Eingriffen
auch sonst nicht beteiligt oder durch sie betroffen sein. | |
(3) Die Entnahme darf nur in Krankenanstalten
vorgenommen werden, die die Voraussetzungen des § 16 Abs. 1 lit.
a und c bis g erfüllen. | |
(4) Organe oder Organteile Verstorbener dürfen
nicht Gegenstand von Rechtsgeschäften sein, die auf Gewinn gerichtet
sind. | |
| |
Erst im parlamentarischen Gesundheitsausschuß
wurden dem Absatz 1 zwei weitere Sätze angefügt. Sie lauten: | |
| |
§ 62 b KAG | |
Angaben über die Person von Spender bzw. Empfänger
sind vom Auskunftsrecht gemäß § 11 Datenschutzgesetz, BGBl. Nr.
565/1978, ausgenommen. | |
| |
| |
§ 62 c KAG | |
Wer dem § 62 a zuwiderhandelt, begeht, sofern
nicht eine gerichtlich strafbare Tat vorliegt, eine Verwaltungsübertretung
und ist mit Geldstrafe bis 30.000 S zu bestrafen. | |
| |
In der Folge sollen aus der Regierungsvorlage (RV)
969 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates
XV. GP, Seite 1 ff wichtige Passagen wiedergegeben werden, die auch
noch für das Verständnis heutiger Probleme von Bedeutung sind. | Link-2: Die Regierungsvorlage
1982 |
Im Vorblatt der RV wird ein kurzer Problemaufriss gegeben:
"Obschon nach der bisherigen Rechtslage die Entnahme von Organen
bzw. Organteilen zu Heilzwecken zulässig ist, besteht seitens der
Ärzteschaft und der Vereinigungen betroffener Patienten, wie zB
den Dialysepatienten, der Wunsch, die Zulässigkeit dieser Entnahmen
zum Zwecke der Transplantation ausdrücklich und
unzweifelhaft [Hervorhebung in den Materialien]
im Gesetz festzulegen. Die bisherige Rechtslage hat verschiedentlich
zu Unsicherheit und Unklarheiten geführt." | |
Bei der Lösung des dargestellten Problems gilt es, die einander
gegenüberstehenden Güter der Rettung menschlichen Lebens bzw. der
Wiederherstellung der Gesundheit einerseits sowie der Pietät und
der Achtung religiöser und philosophischer Überzeugungen andererseits
abzuwägen und einen Ausgleich zu finden. Dies soll dadurch geschehen,
als es lediglich erlaubt ist, einzelne Organe oder Organteile zu
entnehmen. Insgesamt sind jedoch bei dieser Abwägung die Güter Leben
und Gesundheit höher zu bewerten." | |
In den "Erläuterungen" wird zu §
62 a Abs 1 ausgeführt: "Diese Bestimmung erklärt, daß es
zulässig ist, zum Zwecke der Verpflanzung Organe oder Organteile
zu entnehmen, gibt aber gleichzeitig an, daß diese Eingriffe nur in
einem begrenzten Umfang zulässig sein sollen. Die Entnahme darf
sich nur [!- Hervorhebung von mir] auf einzelne
wenige Organe oder Organteile erstrecken. Damit soll sichergestellt
sein, daß der Leichnam eines als Spender geeigneten Verstorbenen
auch nach Durchführung einer Entnahme in einem solchen Zustand verbleibt,
der der Würde eines Toten entspricht und durch den eine Verletzung
zur Pietät nicht erfolgt. Der Organbegriff ist im medizinischen
Sinn zu verstehen und erfaßt daher auch das Gewebe." | |
Die "Erläuterungen" enthalten weitere Ausführungen
zur Todesfeststellung, der Entnahme und Verpflanzung in gemeinnützigen
Krankenanstalten und dem Verbot der Gewinnerzielung aus Pietätsgründen
etc. | |
Wichtige Einsichten vermittelt auch der Ausschussbericht
(AB) des Ausschusses für Gesundheit und Umweltschutz über die Regierungsvorlage
(969 der Beilagen) betreffend das Bundesgesetz, mit dem das Krankenanstaltengesetz geändert
wird (1089 der Beilagen); abgedruckt in: Protokolle des NR XV. GP,
116. Sitzung, 1. Juni 1982, S. 11622 ff. Daraus sollen ebenfalls
wichtige Passagen zitiert werden. Hinzuweisen ist darauf, dass erst
im genannten Ausschuss die Änderung der Regierungsvorlage in Richtung
Widerspruchslösung beschlossen wurde. | |
S. 11.623: "Der Ausschuß für Gesundheit und Umweltschutz
hat die gegenständliche Regierungsvorlage in seiner Sitzung vom
6. Mai 1982 in Verhandlung genommen. Bei der Abstimmung wurde die
Regierungsvorlage unter Berücksichtigung dieses Abänderungsantrages
einstimmig angenommen. [Hervorhebung von mir] Zu der Abänderung
gegenüber der Regierungsvorlage wird folgendes bemerkt: Im Hinblick
auf die Wahrung religiöser und philosophischer Überzeugungen ist
es geboten, auch einen im Zeitpunkt der vorgesehenen Entnahme vorliegenden Widerspruch
des Verstorbenen bzw. seines gesetzlichen Vertreters zu beachten.
... Die Abänderung lautet: Dem § 62 a Abs. 1 sind folgende Sätze
anzufügen: ‚Die Entnahme ist unzulässig, wenn den Ärzten eine Erklärung
vorliegt, mit der der Verstorbene oder, vor dessen Tod, sein gesetzlicher
Vertreter eine Organspende ausdrücklich abgelehnt hat. Die Entnahme
darf nicht zu einer die Pietät verletzenden Verunstaltung der Leiche
führen.’ " | |
In der anschließenden Diskussion im Nationalrat führt der
Abgeordnete Dr. Wiesinger (ÖVP) unter anderem aus:
" ... Wir hätten jetzt als Opposition, das gilt für beide Parteien,
zwei Wege gehen können. Den einen Weg, nämlich zu sagen, ganz typisch,
das ist hier eben ein materialistisches Gesetz, wo der Körper als
Reparaturlager angesehen wird, und wir hätten in relativ kurzer
Zeit eine sehr starke, unerfreuliche, emotionsgeladene Diskussion
in der Öffentlichkeit gehabt. | |
Wir sind bewußt diesen Weg nicht gegangen, weil wir glauben,
daß diese gesetzliche Maßnahme so ungeheuer wichtig ist, vor allem
für die Hunderten von Nierenkranken, die heute auf die Nierenwäsche
angewiesen sind und die praktisch auf Nierenspender warten, um weiterhin
überleben zu können. Hier ist es um sehr wesentliche vitale Interessen
von vielen Menschen in Österreich gegangen. Und bei einer Güterabwägung
war es für uns ganz einfach der richtige Weg, mit der Regierung
Verhandlungen aufzunehmen und zu versuchen, auch unseren Argumenten
zu entsprechen. Konsens statt Konfrontation. | |
Ich stehe nicht an hier zu sagen, daß man seitens der sozialistischen
Fraktion, auch von seiten des Herrn Bundesministers absolut bereit
war, hier in konstruktive Gespräche einzugehen, und diesen Argumenten,
die für uns aus grundsatzpolitischen, weltanschaulichen Gründen
so wesentlich waren, diesen Anträgen auch Rechnung getragen hat. | |
Warum erwähne ich das so ausführlich? Das zeigt, daß eine
parlamentarische Arbeit möglich ist, zu einem Konsens zu finden,
wenn auf seiten derjenigen, die die Mehrheit haben, auch eine Bereitschaft
besteht, diesen Konsensweg zu gehen. Denn eines geht natürlich nicht,
meine Damen und Herren, von der Opposition zu erwarten, daß sie
mehr oder weniger die Dinge hinnimmt, die ihr grundsätzlich nicht
passen, und die Regierung nur von sich aus mit ihrem Mehrheitszug
über alles drüberfährt. Das ist ein Weg, der der Demokratie, der
diesem Land und der der Bevölkerung sicher auf Dauer nicht guttun
wird. (Beifall bei der ÖVP.) ... | |
Wir werden in einer dreiviertel Stunde Gelegenheit haben,
über einen derartigen Fall zu reden. Sehen Sie, das sind für mich
die Antipoden, das ist das Gegenstück. Auf der einen Seite der Versuch,
etwas Vernünftiges gemeinsam für dieses Land zustande zu bringen,
und auf der anderen Seite ein Justamentstandpunkt, wo man glaubt,
sich mit der Mehrheit durchsetzen zu müssen. Ich halte den zweiten
Weg für gefährlich." | |
Der Abgeordnete Samwald (SPÖ) führte unter
anderem aus: " ... Genau festgehalten wurde in diesem Gesetz auch, daß
eine Organentnahme nur zur Lebensrettung oder in einem anderen Fall
zu einer sinnvollen Lebensverlängerung eines Patienten geschehen
darf, aber nicht zu wissenschaftlichen Zwecken und auf gar keinen
Fall zu einer wirtschaftlichen Verwertung führen darf. | |
Meine Damen und Herren! Wenn wir uns heute mit dieser Beschlußfassung
hier im Hohen Haus, Abänderung des Krankenanstaltengesetzes befassen,
muß vor allen Dingen auch zum Ausdruck gebracht werden, daß, obwohl
nach der bisherigen Rechtslage die Entnahme von Leichenteilen zu
Heilzwecken schon zulässig war, schon vor längerer Zeit auch von
seiten der Ärzteschaft Österreichs und der Vereinigung der betreffenden
Patienten, wie der Dialysepatienten, der Herzpatienten, um nur einige
anzuführen, der Wunsch bestand, auch die Zulässigkeit der Entnahme dieser
einzelnen Organe und Organteile von Verstorbenen zum Zwecke dieser
Transplantationen auch unzweifelhaft mittels Gesetz neu festzulegen. | |
Wobei gerade vielleicht auch hier bis vor kurzem die bisherige
Rechtslage, Herr Kollege Primarius Dr. Wiesinger hat es ja angeführt,
schon in manchen Fällen zu einer Unischerheit geführt hat und vor
allen Dingen auch in der Auslegung manchmal zu Unklarheiten geführt
hat. Wir wissen, daß nach der Verurteilung eines Wiener Primararztes wegen
Entnahme von Knochensplittern im Jahre 1978 eigentlich die Zahl
der Transplantationen sehr strak zurückgegangen ist und daß dieser
Fall und einige andere, die dann gefolgt sind, dazu geführt haben,
daß wir heute hier dem Hohen Hause die Änderung des Krankenanstaltengesetzes
in bezug auf die Organtransplantationen vorlegen und nach eingehenden
Beratungen, das muß ich auch hier anerkennen, im Ausschuß eine Dreiparteieneinigung erreicht
werden konnte. | |
Vor allem in der primären Frage der Entnahme des Organes
konnte Einigung erzielt werden, wobei der Passus in das Gesetz aufgenommen
wurde, daß die Entnahme dann unzulässig wäre, wenn den Ärzten eine
Erklärung vorliegt, mit der der Verstorbene oder vor dessen Tod
sein gesetzlicher Vertreter eine Organspende ausdrücklich abgelehnt
hat. Die Entnahme dieses Organes darf auf keinen Fall, das ist,
glaube ich, auch sehr wichtig für die Bevölkerung Österreichs, zu
einer die Pietät verletzenden Verunstaltung der Leiche führen. | |
["Pietät" ist ein normativ in hohem Maße
aufgeladener Begriff, der nicht nur rechtliche,
sondern auch weltanschaulich-religiöse, philosophische und medizinische
Inhalte aufweist, und im jeweils zu interpretierenden Kontext
keineswegs vage verfließt, sondern lösungsbezogen sogar relativ
klare, wenn auch nicht messerscharfe Konturen erhält. Die gesellschaftsbezogene
Aussage der "Pietät" in § 62a Abs 1 KAG, auf welche in den Materialien 1982
mehrfach und nachdrücklich Bezug genommen wird, kann demnach auch
nicht durch eine von den Vorstellungen des Gesetzgebers abweichende
Erklärung von Angehörigen Verstorbener aufgehoben oder modifiziert werden.
Der Begriffsinhalt mag zwar einem gewissen gesellschaftlichen
Wandel ausgesetzt sein, sein Kern bleibt aber verbindlich.
Der normative Begriff der "Pietät" bildet einen wichtigen Teil jenes
politischen Kompromisses, der zum einstimmigen Gesetzesbeschluss
im Jahre 1982 geführt hat. Dieser normative Rahmen kannn weder individuell aufgekündigt,
noch durch die Medizin einseitig verändert werden.] | |
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich glaube, daß es
uns hier gemeinsam gelungen ist, im Ausschuß eine Einigung zu erringen,
die wir heute diesem Hohen Hause vorlegen konnten, und daß es uns
vor allen Dingen auch gemeinsam gelungen ist, in einer Interessenabwägung
für die Rettung und Erhaltung des Lebens für viele Menschen in Österreich,
die ja schon jahrelang auf eine solche Organspende warten, wirksam
zu werden, bei gleichzeitiger Einhaltung der Pietät und der Beachtung
der Gefühle von deren Angehörigen. | |
Es ist daher zu hoffen, meine sehr geehrten Damen und Herren,
daß es mit dieser Gesetzeswerdung wieder zu einer Zunahme der Organverpflanzungen
und der Transplantation im Interesse vieler Kranker, die auf Heilung
beziehungsweise Verbesserung ihres Leidens hoffen, kommen wird." | |
Der Bundesminister für Gesundheit und Umweltschutz Dr.
Steyrer führt unter anderem aus: "... Seit dem Jahre 1770 besitzt
Österreich ein sehr modernes Obduktionsgesetz, das damals den Vorrang
der Wissenschaft vor der Totenruhe arrogiert und festgestellt hat.
Mit diesem Obduktionsgesetz wurden die gigantischen Fortschritte
der Wiener Ersten und Zweiten medizinischen Schule praktisch überhaupt
erst ermöglicht. | |
Ich glaube, daß analog diesem modernen Obduktionsgesetz
eine solche Novelle zum Organ- und Transplantationsgesetz Berechtigung
hat, weil hier das Vorrecht des Lebens vor der Totenruhe statuiert
wurde. | |
Ich möchte – das ist der Sinn meiner Wortmeldung – dem Ausschuß
für diese konstruktive Arbeit danken und ich möchte auch – und das
stehe ich nicht an zu erklären – feststellen, daß hier die traditionell
gute Zusammenarbeit auf dem Gebiete des Gesundheitswesens auch von
den Oppositionsparteien demonstriert wurde. | |
Ich möchte auch sagen, daß eine solche Regelung, wie wir
sie heute in Österreich erzielt haben, zum Beispiel in der Bundesrepublik
Deutschland nicht möglich gewesen wäre, weil zweifellos eine so
wichtige sachliche Frage dort stark emotionalisiert und sicherlich
dem Parteienhickhack ausgeliefert worden wäre. | |
Deshalb mein Dank. Ich möchte sagen, daß hier eine Tat gesetzt
wurde, die zweifellos für einen großen Teil der österreichischen
Bevölkerung wesentliche Verbesserungen auf dem Gebiete der gesundheitlichen
Betreuung bringen wird und vor allem eines beseitigen wird, nämlich
die Rechtsunsicherheit, die viele Ärzte befallen hat .... Und daher haben
wir heute etwas erreicht, was zweifellos auch den Oppositionsparteien
zugute kommt. Das möchte ich anerkennen. Ich möchte mich herzlich
dafür bedanken. (Beifall bei der SPÖ.)" | |
Die Abgeordnete Dr. Marga Hubinek (ÖVP)
führt aus: " ... Ich halte das, meine sehr geehrten Damen und Herren, für
einen großen Fortschritt, für einen Fortschritt, den die Regierungsvorlage
nicht aufweisen konnte. Ich glaube, es war wichtig, daß der Antrag
der ÖVP-Fraktion auf die Zustimmung gestoßen ist, daß es einen absoluten
Respekt vor dem Willen des Spenders geben muß. | |
Ich glaube, meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn wir
vom mündigen Bürger reden, so müssen wir eigentlich auch respektieren,
daß er bestimmt, ob sein Körper unversehrt erhalten bleibt. Es können
weltanschauliche, es können religiöse Gründe für ihn wichtig sein.
Wichtig ist, daß sie die Ärzte respektieren .... | |
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich möchte ähnlich
wie der Herr Minister über den Konsens einige Worte sagen. Ich glaube,
es zeigt, daß das Parlament durchaus in der Lage ist, einen sinnvollen
Kompromiß zu erarbeiten, einen sinnvollen Kompromiß, der vielen
Menschen zugute kommt. | |
Man sollte die Lehre aus dem ziehen, was in diesem Bereich
möglich ist: Ideen auch der Opposition nicht von vornherein vom
Tisch zu fegen, sondern sie zumindest zu prüfen, und wenn man der
Meinung ist, daß man ihnen Folge leisten kann, flexibel genug zu
sein, seinen eigenen Standpunkt zu korrigieren." | |
Diese Novelle zum Krankenanstaltengesetz wurde einstimmig angenommen. | |
4. Welche Themenbereiche
des Transplantationssektors gehören gesetzlich geregelt? | |
| Adresse unseres Gesetzentwurfs |
 | |
Das
Widerspruchsregister bedarf dringend einer gesetzlichen Grundlage:
"Aufgaben" und "Pflichten" dieser wichtigen Einrichtung sind zu
normieren. Dabei sollte die Möglichkeit des Widerspruchs
effektuiert werden! Klargestellt werden sollte dabei auch
die Rechtsnatur der Widerspruchserklärung, die
nämlich keine rechtsgeschäftliche (Willens)Erklärung ist, sondern einen
(Willens)Akt menschlicher Selbstbestimmung darstellt, den es persönlichkeiltsrechtlich
zu schützen gilt. Die Erklärung sollte formfrei abgegeben
und jederzeit widerrufen werden können. Stellvertretung sollte
nicht möglich sein. - Statuiert werden sollte auch eine Erkundigungspflicht des
Arztes vor Durchführung einer Transplantation beim Widerspruchsregister.
– Unbedingt vorzusehen wäre die Möglichkeit des Teilwiderspruchs,
wie das in anderen Ländern – bspw in Holland – schon möglich ist. | Gesetzliche Grundlage nötig Widerspruchsregister |
Widerspruchsregister gegen Organspende jährliche
Eintragungen und Anfragen 1995 bis 1999 | Jahr | Eintragungen | Anfragen | | 1995 | 323 | 450 | | 1996 | 1153 | 829 | | 1997 | 1665 | 879 | | 1998 | 855 | 845 | | 1999 | 590 | 815 |
| |
Gesetzlich umschrieben werden sollten auch jene Körperteile,
die entnommen werden dürfen. Das dtTPG 1997 ist
diesen Weg gegangen; vgl § 1 iVm § 9 dtTPG. Man kann diese Fragen
nicht allein der Medizin überlassen. Darunter leidet die Rechtssicherheit.
– Zu regeln wäre in diesem Kontext auch die sog Multiorganspende,
die derzeit zur gelebten österreichischen Praxis gehört, was aber nicht
gesetzeskonform ist. | Welche
Körperteile dürfen entnommen werden? – Zur Zulässigkeit der Multiorganspende? |
Anzustreben ist auch eine gesetzliche Mindestorganisation für
den Transplantationssektor; vgl die §§ 10 und 11 unseres Entwurfs.
Er sieht Transplantationszentren, Transplantationssprengel, eine
Transplantationskonferenz und darüber hinaus sogenannte Transplantationskoordinatoren
vor. | Gesetzlicher
Organisationsrahmen der Transplantationsmedizin |
Wünschenswert erschiene ferner eine gesetzlich fundierte
internationale oder doch europäische Einbindung des grenzüberschreitenden
Organaustauschs wie er bspw über Eurotransplant und andere Verteilungsorganisationen
(zB Swiss- oder Scan-Transplant) bereits praktiziert wird. Diesbezüglich
ist auf die "Gemeinsame Erklärung zur Zusammenarbeit im Rahmen der
Stiftung Eurotransplant international" der Eurotransplantminister
vom Oktober 1999 hinzuweisen. | Eine europäische
Regelung |
Wichtig erscheint ferner eine verbesserte Information der
Bevölkerung über den gesamten Transplantationssektor; vgl dazu §
7 unseres Entwurfs. Berichtspflichten sind zu statuieren;
vgl § 11 Abs 2, § 12 Abs 5 sowie § 18 iVm § 21 unseres Entwurfs. | Information
der Bevölkerung |
Unverzichtbar erscheint ferner die gesetzliche Regelung
der Warteliste und damit zusammenhängend gesetzliche Regeln über
die Organzuteilung. Vgl § 12 unseres Entwurfs. – Hier geht es um überfällige rechtsstaatliche
Erfordernisse. Man muss sich wirklich fragen warum das
nicht längst gemacht wurde. | Warteliste und
Organzuteilung |
Dringend einer Regelung bedarf die derzeit in Österreich
gesetzlich ungeregelte Lebendspende samt Aufklärungspflichten und
nötiger Einwilligung dazu; vgl die §§ 16 und 17 unseres Entwurfs. Mangels
rechtlicher Klarheit ist die Lebendspende bei uns in Österreich
– im Vergleich zu anderen Ländern – derzeit nur von untergeordneter
Bedeutung. Hier könnte für das Transplantationswesen mehr erreicht
werden, zumal die Lebendspende auch medizinische Vorteile aufweist.
Hier könnten uns vielleicht die holländischen Erfahrungen weiter
helfen. | Regelung der
Lebendspende |
Auf der anderen Seite treten bereits jetzt Missbrauchsmöglichkeiten in
Erscheinung. – Wie beurteilen Sie etwa den folgenden Fall, der nicht
erfunden ist: Ein österreichisches Transplantationsteam will die
Zustimmung der zuständigen Ethikkommission dafür erlangen, dass
einem deutschen Rechtsanwalt die Niere seines rumänischen Brieffreundes
transplantiert wird. | |
Spenderaufkommen nach Transplantationszentren und
Spendertyp 1999 | TX-Zentrum | Tote Spender * | Lebendspender | | Graz | 26 | 1 | | Innsbruck | ** 48 | 16 | | Region Linz | 25 | 3 | | Wien | 106 | 26 | | Gesamt | 205 | 46 |
| |
*Used cadaveric donors, **12 Spender aus Südtirol | |
*Used cadaveric donors, **12 Spender aus Südtirol | |
Auszubauen und weiter zu klären wäre ferner das bereits
jetzt bestehende Gewinnverbot, das unter anderem durch ein angemessenes
Werbeverbot zu ergänzen wäre. – Ein Handel mit menschlichen Organen
ist unter allen Umständen zu vermeiden. Das dies nicht nur eine
theoretische Befürchtung, sondern Zeitungsberichten zufolge (Der
Standard, Dienstag, 15. Juli 2003, Seite 5: "Niere für Geld: Illegaler
Handel" – Österreicher brauchte Geld, um die Firma seiner Lebensgefährtin
zu retten) gesellschaftliche Realität ist, sollte bedacht werden.
– Dringt der Götze Mammon in diesen Bereich einmal ein, sind die
Folgen kaum abzusehen. Markt und Wirtschaft haben hier nichts verloren.
Nur eine klare Antwort löst hier die Probleme. | Gewinn- und
Werbeverbot – Kein Organhandel |
Die Kompetenzen des Obersten Sanitätsrates im Zusammenhang
mit dem Transplantationswesen wären grundsätzlich zu überdenken,
zu modernisieren und – vor allem auch – zu demokratisieren; vgl
dazu § 8 unseres Entwurfs, der diesem Gremium – in einem rechtsstaatlich-demokratischen Kontext
– wichtige Aufgaben zuweist. | Kompetenzen
des Obersten Sanitätsrates |
Gesetzlich zu regeln sind auch Organbanken, mögen diese
vielleicht auch erst künftig zu größerer Bedeutung gelangen; vgl
§ 9 unseres Entwurfs. | |
Rechtlich geregelt werden muss auch die Organisation der
(einzelnen) Transplantationszentren; insbesondere auch die Aufgaben
des bereits jetzt eingesetzten Transplantationskoordinators. – Vgl dazu
§ 11 unseres Entwurfs. | |
Neu und umfassender zu regeln ist ferner die Totenspende.
Sie wurde in den §§ 13 ff unseres Entwurfs eingehend behandelt.
Hinzuweisen ist hier bspw darauf, dass § 14 iVm § 1 unseres Entwurfs auch
die Entnahme "anderer" Körperteile zulässt, dies aber an besondere
im Gesetz genannte Voraussetzungen bindet. | |
Gesetzlich geregelt werden muss ferner die Todesfeststellung;
vgl § 15 unseres Entwurfs. | |
Dringlich erscheint das Schaffen eines gesetzlichen Transplantationsregisters;
vgl die §§ 18-20 unseres Entwurfs. In dieses Register wären einerseits
Widersprüche einzutragen, selbstverständlich in
neuer erweiterter Form. – Darüber hinaus wären auch erfolgte Toten-
und Lebendspenden zu dokumentieren.
Das ist nicht nur wissenschaftlich von Vorteil, sondern auch aus
Gründen der Rechtssicherheit ratsam. | |
Unverzichtbar erscheint ferner das Schaffen von effizienten
Kontrolleinrichtungen; vgl § 21 unseres Entwurfs. – Vorgesehen ist
dort auch eine Beschwerdemöglichkeit an den zuständigen Bundesminister. | Verbesserte
Kontrolleinrichtungen |
Auch realistische Sanktionen sind anzustreben, zumal die
gegenwärtige Regelung völlig unzureichend ist: Das betrifft gerichtlich
strafbare Handlungen, Verwaltungsstrafen und Schadenersatz; vgl
§ 22 unseres Entwurfs. | |
Transplantationsgeschehen 1999 in Österreich gegliedert
nach Transplantationszentren und Organen | TX-Zentrum | Graz | Innsbruck | Linz | Wien | Summe | | Herz | 15 | 20 | | 59 | 94 | | Herz und Lunge | | | | 1 | 1 | | Lunge | | 10 | | 59* | 60 | | Leber (tote Spende) | 10 | 56 | | 79 | 145 | | Leber (Lebendspende) | | | | | 6 | | Leber gesamt | 10 | 62 | | 79 | 151 | | Niere (inkl. Pa/Niere) (tote Spende) | 47 | 104 | 54 | 177 | 382 | | Niere (Lebendspende) | 1 | 10 | 3 | 25 | 39 | | Niere gesamt | 48 | 114 | 57 | 202 | 421 | | Pankreas (komb. mit Niere) | | 23 | | 1 | 27 | | Pankreas | | 3 | | | 3 | | Pankreas gesamt | | 29 | | 1 | 30 |
| |
* Eine Lunge durch Lebendspende | |
Quelle: ET-Dokumentation | |
5. Welche Organe
dürfen entnommen werden? – Zur Frage der Multiorganspende | |
Das geltende Gesetz geht davon aus, dass nur die Entnahme
"einzelner Organe oder Organteile" zulässig ist.
– Hier besteht eine grosse Kluft zwischen Gesetz und gelebter medizinischer
Praxis. | |
Unbestritten
ist, dass die Entnahme"aller"
Organe gesetzwidrig wäre, wenngleich auch daran mitunter
gezweifelt wird. Strittig ist jedoch wie das Wort "einzelne"
zu verstehen ist. Festgehalten werden soll, dass das überwiegende
Verständnis dieses Passus darin besteht, dass die zu entnehmende
Organzahl mit dem Begriff "einzelne Organe oder Organteile" limitiert
ist. Aufgrund des Gesetzestextes ist davon auszugehen, dass die
Entnahme zu vieler Organe unzulässig ist. "Einzelne" heißt
eben nicht "alle", aber auch nicht "viele".
Am ehesten ist das Adjektiv "einzelne" iSv "mehreren",
nämlich im Ausmaß von maximal zwei oder drei Organen zu
verstehen. Der wohl bewusst nicht messerscharf gewählte Gesetzestext
deckt und rechtfertigt demnach keine Multiorganspenden,
mögen diese auch von der Transplantationsmedizin gewünscht und in
der Praxis regelmäßig (!) vorgenommen werden. Somit dürfen zwar
zwei oder allenfalls drei Organe, aber nicht mehr oder gar alle
entnommen werden. Eine großzügige Auslegung könnte
paarig angelegte Organe als ein Organ betrachten. – Die Beseitigung
bestehender Unklarheiten erschiene für Österreich wünschenswert,
um Zweifel und Unsicherheit in der Transplantationspraxis auszuräumen. Eine
gesetzliche Lösung dieser Fragen drängt auch insofern, weil die
Immunologie erfreulicherweise große Fortschritte macht, was tendenziell
aber dazu führt, Transplantationen auszuweiten. | Gesetzestext deckt keine Multiorganspenden Wünschenswerte
Klarstellungen |
Die
nach einer Aufschlüsselung von Eurotransplant quantitativ
ansteigende Multiorganspende in Österreich macht deutlich,
dass es hier – bei allem Verständnis für praktische Bedürfnisse
– nicht bloß um eine l’art pour l’art-Interpretation des Gesetzestextes
geht. Die Formulierung des § 62a Abs 1 Satz 1 KAKuG stellt nämlich
auch sicher, dass der menschliche Leichnam nicht rücksichtslos
als "Rohstofflager" verwendet wird. Das wollte der Gesetzgeber
von 1982 nämlich dezidiert nicht. Interpretationen – von wem immer
sie stammen mögen, die über dieses menschlich vernünftige und vom
Gesetzgeber seiner politischen Entscheidung zu Grunde gelegte Maß
hinausgehen, gefährden die österreichische Lösung als Ganze und
erscheinen für die Zukunft auch demokratiepolitisch kontraproduktiv. | Zur Interpretation des § 62a Abs 1 KAKuG |
Internationaler Vergleich der Spender- und Transplantationszahlen
pro Million Einwohner 1998 | Land | Spenderaufkommen* | Transplantationen | | | Niere** (tote Spende) | Niere (Lebendspende) | Leber | Herz*** | Lunge**** | | Österreich | 19,8 | 40,2 | 6,0 | 16,5 | 11,6 | 7,7 | | Belgien | 19,4 | 36,1 | 2,6 | 13,9 | 9,6 | 3,3 | | Luxenburg | 17,5 | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Slowenien | 13,5 | 23,0 | 0,5 | 2,0 | 2,0 | 0 | | Deutschland | 13,4 | 25,0 | 4,3 | 6,6 | 6,6 | 1,5 | | Niederlande | 13,1 | 25,3 | 7,0 | 2,7 | 2,7 | 1,1 | | Spanien | 31,5 | 49,8 | 0,5 | 22,7 | 8,8 | 3,2 | | Finnland | 19,8 | 35,1 | 1,2 | 7,6 | 3,5 | 1,1 | | Tschechien | 19,2 | 34,9 | 0,7 | 6,4 | 5,3 | 0,8 | | Frankreich | 16,9 | 30,8 | 1,2 | 11,8 | 6,3 | 1,5 | | Norwegen | 15,6 | 28,3 | 17,6 | 5,7 | 7,5 | 2,0 | | Schweiz | 15,4 | 28,7 | 9,7 | 11,0 | 6,3 | 4,3 | | Schweden | 14,6 | 26,7 | 13,5 | 10,8 | 4,1 | 3,7 | | Italien | 12,3 | 20,9 | 1,4 | 9,5 | 5,8 | 1,1 | | USA | 22,7 | 35,1 | 15,8 | 15,4 | 8,7 | 3,3 | | Australien | 10,5 | 19,1 | 7,7 | 6,9 | 4,7 | 3,7 |
| |
* Used cadaveric donors ** Inklusive kombinierte
Niere-Pankreas-Transplantationen *** Exclusive Herz u. Lunge, USA
und Australien: Die Daten für Leber, Herz und Lunge beziehen sich
auf das Jahr 1997. | |
Quelle: Council of Europe, Transplant Procurement
Management (TPM), März 2000 – ÖBIG ´99 | |
6. Transplantation
und Pietät | |
Verunstaltung
der Leiche Die Entnahme darf gemäß § 62a Abs 1 KAKuG nicht zu einer
die Pietät verletzenden Verunstaltung der Leiche führen.
Unter Verunstaltung ist jede nach der allgemeinen Lebensanschauung
(!) wesentliche nachteilige Veränderung der äußeren Erscheinung
zu verstehen. Daher besteht bei der Entnahme innerer Organe keine
namhafte Verunstaltungsgefahr, sofern geöffnete Körperhöhlen ordnungsgemäß
verschlossen werden. Probleme entstehen jedoch bei der Entnahme
von Gliedmaßen, wie etwa den Händen, an die der Gesetzgeber 1982
meines Erachtens nicht gedacht hat. | Verunstaltung der Leiche |
Vgl dazu nunmehr auch § 6 dtTPG, wo auf
die Achtung der Würde des Organspenders abgestellt wird und Angehörigen
Gelegenheit zu geben ist, den Leichnam nach durchgeführter Transplantation
noch zu sehen. Das sollte europäischer Standard werden. – Ich meine
nicht, dass die Bereitschaft der österreichischen Bevölkerung als
Organspender/innen zu dienen zunimmt, wenn sich die Ansicht durchsetzt,
dass jedem Verstorbenen auch Hände, Arme und Beine und vielleicht
einmal Kopf und Rumpf abgetrennt werden können. Die Reaktion in
der Bevölkerung wird vielmehr die sein, eine Widerspruchserklärung
oder doch eine Teilwiderspruchserklärung abzugeben. Die einschlägige
medizinische Argumentation bewegt sich wohl eher in einem unbewussten
aber gefährlichen Zirkel: Wir benötigen viele Organspenden und versuchen
daher schon gegenwärtig, trotz der diesbezüglich relativ klaren Rechtslage
(Gesetz + Materialien), die Multiorganspende zu rechtfertigen. In
Wahrheit wird dadurch nicht nur die Multiorganspende, sondern unsere
gesamte durchaus positiv zu bewertende – wenn auch verbesserungsbedürftige
– Widerspruchslösung gefährlich unterminiert. | |
 | |
Ich halte derartige
Entnahmen nach geltendem Recht für unzulässig und verweise diesbezüglich auf
die wichtigen Ausführungen des früheren Justizministers
Foregger im Wiener Kommentar zu § 190 StGB Rz 14): | Ausführungen
des früheren Justizministers Foregger |
Die Fortschritte der Medizin führen "dann nicht zu beklemmenden
Vorstellungen über eine weitgehende Aufhebung der Totenruhe und
das Ende der Pietät gegenüber Toten, wenn sich die Medizin die Beschränkung
auf bloß einzelne Teile eines Leichnams und das Gebot zur Erhaltung des
äußeren Menschenbildes angelegen sein läßt". Und nach Gerhard Aigner,
dem damals zuständigen Legisten des Gesundheitsministeriums, "darf
die Entnahme sich nur auf einzelne wenige Organe oder Organteile
erstrecken". | |
Aigner, Gesetzliche Regelung der Organentnahme
von Verstorbenen in Österreich, in: Mitteilungen der österreichischen
Sanitätsverwaltung 225 (1982). Aigner betont, dass das Wort "einzelne"
im Gesetzestext des § 62a KAG im Hinblick auf wenige Organe besonders
"betont" wurde. – Wir sollten Jean Paul Sartres Mahnung ernst nehmen:
"Der Mensch ist nichts anderes als das, wozu er sich macht." Ich
denke, dass wir beachten sollten, dass der Umgang mit unseren Toten
auch unseren Umgang mit den Lebenden beeinflusst. Und wir haben,
das 20. Jahrhundert im Gepäck, allen Grund dazu, vorsichtig in diesem
Umgang zu sein. Das gilt auch für unser Thema. Nicht alles, was
als Fortschritt gilt, ist einer und nicht alles, was wir machen
können, sollten wir auch tun. Der Transplantationssektor erscheint
mir auch als denkbar schlechtes Beispiel dafür, um den Forderungen
des Marktes zu entsprechen, wie das von einem bekannten Transplantationsmediziner
– wenig glücklich – behauptet wurde. | |
Vgl dazu nunmehr auch § 6 dtTPG, wo auf die Achtung der
Würde des Organspenders abgestellt wird und Angehörigen Gelegenheit
zu geben ist, den Leichnam nach durchgeführter Transplantation noch
zu sehen. Das sollte europäischer Standard werden. Mehr bei Barta,
in: Barta/Weber (Hg), Rechtsfragen der Transplantationsmedizin in Europa
36 (2001). | |
Es
geht hier insgesamt um eine sensible Interpretation mehrerer
einschlägiger Gesetzesstellen und grundsätzlicher gesellschaftlicher
Werthaltungen. Dabei darf nichts unberücksichtigt bleiben, oder
die eine gegen die andere Gesetzesstelle oder Werthaltung ausgespielt
werden. Vielmehr bildet die Rechtsordnung ein integrales Ganzes.
Man kann nun nicht verlangen und erwarten, dass Mediziner – gleichgültig
ob Chirurgen oder Gerichtsmediziner – eine solche Auslegung zustande bringen.
Deshalb erscheint Foreggers Aussage wichtig. Sie darf nicht einfach,
weil unbequem, zur Seite geschoben werden. – Auf dieser gesetzlichen
und wertmäßigen Grundlage ruht nämlich die 1982 erzielte politisch-demokratische
Lösung unserer Organtransplantation. Eine Interpretation, die diesen
Rahmen verlässt, verlässt den Rahmen des Gesetzes. Es besteht hier
kein Raum für eine extensive (Gesetzes)Auslegung. | Gefragt ist eine sensible Interpretation |
7. Plädoyer für
ein neues Transplantationsgesetz – Recht und Medizin in modernen
Gesellschaften | |
Gesellschaftliche Konflikte, Ängste, Unsicherheiten, Zweifel
müssen heute mehr denn je offengelegt, analysiert und dadurch "kultiviert"
werden. Das andere Muster – in der Politik meist beliebter – ist
das des Wegschauens, Leugnens, Verniedlichens, Herabsetzens oder
schlicht Verdrängens. – Diese Dichotomie lässt sich auch bei unserem
Thema ausmachen: Österreich tendiert – nicht nur hier – zum Wegschauen
und Verdrängen. Nicht "genaues Denken" und sorgfältige Analyse haben
Konjunktur, sondern Gerede, Oberflächlichkeit, Opportunismus und
Populismus. | |
Es ist zu bedauern, dass Staatssekretär Waneck – er ist
Mediziner – keine Notwendigkeit erkennen konnte, die gegenwärtige
Rechtslage zu verbessern. Ich würde ihm raten, zum Vergleich mit
der österreichischen Rechtslage, das dtTPG 1997 und den Schweizer
Entwurf 1999 und anschließend unseren Entwurf durchzusehen. Er wird
dann feststellen können, was in Österreich fehlt, was getan werden
kann und getan werden sollte. | |
- Respekt vor
Recht und GesetzWünschenswert erschiene es, in einem Verfassungsartikel –
des immer wieder zu Recht geforderten "Verfassungspakets-Patientenrechte"
– auch die Grundlinien des österreichischen Transplantationsrechts
(kurz) niederzulegen und darauf die neue einfachgesetzliche Regelung
zu stützen. Ich meine, dass es nicht zuviel wäre, von einem Staatssekretär
und der Transplantationsmedizin in Österreich zu erwarten, sich
um eine sensible (juristische) Interpretation zu bemühen. Zu verlangen wäre
aber schon jetzt mehr Respekt vor dem Recht und dem demokratischen
Gesetz, aber auch vor den von all dem Betroffenen. Es gilt
doch nicht nur die eigene politische Klientel zu bedienen. Die politische
Abwimmeltaktik zeugt von Uninformiertheit, schlechtem Gewissen,
mangellndem Einfühlungsvermögen und medizinischem Machtbewusstsein
statt Einsicht. | Verfassungsartikel |
Mein Ergebnis beruht auf einer interpretativen Zusammenschau
verschiedener Aussagen des Gesetzgebers iVm mit den – für das Gesetz
1982 – durchaus interessanten Aussagen der Gesetzesmaterialien,
die einen guten Einblick in das Denken des historischen Gesetzgebers
gewähren, was nicht selbstverständlich ist. | |
Bleibt festzuhalten, dass das Erlassen eines TPG für Österreich
rechtspolitisch nötig erscheint, mag das auch immer wieder – von
den davon betroffenen Bereichen der Medizin, die über Macht und namhaften
politischen Einfluss verfügen – bestritten werden. Der Vergleich
mit anderen westeuropäischen Staaten zeigt, dass nur Österreich
die Lebendspende gesetzlich nicht explizit regelt. | Österreich braucht
ein TPG |
Dazu Barta,
in: Barta/ Weber (Hg),
Rechtsfragen der Transplantationsmedizin in Europa 38 (2001). | |
Für die Medizin erscheint es als Vorteil, wenn sie sich
auf ihre eigentlichen Aufgaben beschränken kann und nicht – wie
bisher – mit Rechtsunsicherheit belastet wird. Aber auch für Spender
und Empfänger von Organen samt ihren Angehörigen stellt eine kompakte,
verständliche gesetzliche Information über ihre Möglichkeiten, Rechte
und Pflichten eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Status quo
dar und auch für Krankenanstalten bestünde dann ein klarer rechtlicher
Rahmen für die vielen mit Transplantationen einhergehenden Fragen.
Der Schritt des deutschen Gesetzgebers sollte für
Österreich ein neuerlicher Anstoß sein, die vielen ungeregelten
Fragen im Zusammenhang mit Transplantationen zusammenfassend zu
regeln. Auch die Bemühungen der Schweiz und des
Europarates sollten uns zu denken geben. Ich meine,
dass mit den hier vorgeschlagenen oder ähnlichen Regelungen dem
österreichischen Konzept der Widerspruchslösung ein guter Dienst
erwiesen wäre, zumal es auf Dauer gefährlich sein kann, im sensiblen
medizinisch-rechtlichen Problembereich der Organtransplantation
dem Prinzip des quieta non movere zu huldigen. Gemeinsame Aufgabe
von Recht und Medizin ist es vielmehr, der Wirklichkeit ins Auge
zu schauen und ihr bestmöglich zu begegnen. | |
Ein
normatives Einfangen der vorausgeeilten medizinischen Entwicklung erscheint
mir aber auch – wie angedeutet – gesellschaftlich wichtig. Denn
wir können es uns aus demokratiepolitischen und rechtsstaatlichen
Gründen nicht leisten, ganze Gesellschaftsbereiche aus der normativen Bindung
an das demokratische Gesetz zu entlassen. Natürlich kann ein solcher
Schritt auch nicht durch die Selbstdefinition dieser Bereiche geschehen.
Darin läge nicht nur eine Selbstüberschätzung, sondern das beschwört
auch die Gefahr herauf, dass auch andere Bereiche diesem fragwürdigen
Beispiel folgen. Dann tritt an die Stelle des allgemeinen demokratisches
Gesetzes und der Achtung vor dem Gesetz normative Beliebigkeit.
Das wäre das Ende des Rechtsstaates und vielleicht auch der Demokratie.
– Solchen Anfängen zu wehren ist daher kein nebensächliches Unterfangen. | Einfangen der medizinischen Entwicklung |
als
SolidaritätsmodellWas spricht im Bereich der Organtransplantation
für ein Beibehalten unserer österreichischen Widerspruchslösung,
was gegen die Übernahme der zuletzt von Deutschland legistisch verwirklichten
sogenannten erweiterten Zustimmungslösung? – Das deutsche
Modell betont meines Erachtens, stärker als unsere österreichische
Lösung, den Wert der Individualität, während die österreichische
Lösung zwar das Individuum in seiner freien Entscheidungsmöglichkeit
respektiert, gleichzeitig aber den Gedanken der Solidarität stärker
betont als das deutsche Modell. Und ich meine, dass es unseren postindustriellen
Gesellschaften durchaus gut ansteht, solidarisches Handeln – wo
dies möglich und sinnvoll ist– zu stützen, weil unsere Wirtschaftsordnungen
ohnehin zunehmend menschliche Gemeinschaft zerstören und Egoismen
aller Art fördern. – Wir müssen uns dabei auch mit kleinen Schritten
begnügen. | Beibehalten der Widerspruchslösung |
Ich habe unlängst ein Buch gelesen, das voller Weisheiten
auch für uns postmoderne Menschen ist: Georg Luck,
Die Weisheit der Hunde (1997). Ein Buch über die antiken
Kyniker, diese vorurteilsbehaftete griechische Philosophengruppe
in der Nachfolge des Sokrates. Dort findet sich anregendes von Anthistenes,
Diogenes von Sinope, Krates und anderen Angehörigen dieses Philosophenkreises.
Von Diogenes, dessen Begegnung mit Alexander dem Großen berühmt
wurde, wird auch berichtet, dass er, schon in hohem Alter stehend,
von Piraten gefangen und als Sklave verkauft worden war. Über 80
Jahre alt, habe er testamentarisch verfügt, seinen Leichnam nicht
zu beerdigen, sondern in einem Graben den Tieren zum Fraß vorzuwerfen. | Das Beispiel
des Diogenes von Sinnope |
Das kann leicht missverstanden und sollte nicht als grauslicher
"Kynismus" ausgelegt werden, mag das auch unseren heutigen Pietätsvorstellungen
widersprechen. Allein der Grundgedanke des Diogenes scheint auch
heute noch brauchbar: Diogenes will uns wohl lehren, dass auch wir
für die Zeit nach unserem Tod, nicht nur narzistische Anordnungen
treffen, sondern solidarisch zu unserer Umwelt und unseren Mitmenschen
stehen sollen. | |
Nachdem es im antiken Griechenland noch keine Organtransplantation
gab, war der Körper des Diogenes nach seinem uneitlen, selbstlosen
und solidarischen Verhalten nur noch für Tiere brauchbar. – Heute
dagegen sind wir in der Lage sinnvoller mit dem toten menschlichen
Körper umzugehen. Allein die Achtung vor dem toten Körper, wir nennen
sie "Pietät", sollten wir uns erhalten. Auch wenn manche Vertreter
der Politik und Medizin meinen, dass dies unwichtig sei. | |
Bestimmungen zur Organspende in der Europäischen
Union | Land | Grundregelung | | Belgien | Widerspruchslösung | | Frankreich | Widerspruchslösung | | Luxemburg | Widerspruchslösung | | Österreich | Widerspruchslösung | | Portugal | Widerspruchslösung | | Schweden | Widerspruchslösung | | Spanien | Widerspruchslösung | | Finnland | Zustimmungslösung | | Großbritannien | Zustimmungslösung | | Griechenland | Zustimmungslösung | | Italien | Zustimmungslösung | | Deutschland | Zustimmungslösung | | Dänemark | Zustimmungslösung | | Holland | Zustimmungslösung | | Irland | Zustimmungslösung: ohne gesetzliche Grundlage |
| |
Quelle: ÖBIG ´99 | |
| |

