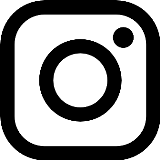
"All the poems have messages"
Die Beiträge auf Rupi Kaurs Instagram-Account sind in einem optisch ansprechenden Schachbrettmuster aus alternierenden Bild- und Textkompositionen (immer ein persönlicher Beitrag, dann wieder ein Gedicht) zusammengesetzt. Klickt man auf eines der in Dreierreihen angeordneten Text-Quadrate, füllen Kompositionen wie etwa dieser Beitrag vom 5. Jänner 2021 den Bildschirm aus: „you are lonely // but you are not alone // there is a difference - rupi kaur”, steht im linken oberen Bereich des Bildes in kleingeschriebener Times New Roman. Rechts unten sind vier gezeichnete cocteaueske Figuren in verschiedenen Positionen skizziert. Unter den typischen Schaltflächen der App steht in fett gedruckter Schrift „Gefällt 192.830 Mal”. Im Kommentarbereich meldet sich die Autorin selbst zu Wort und verrät, dass es sich beim Gedicht um die Seite 19 aus ihrem aktuellen und dritten Buch „home body” handelt. Ausführlich erläutert sie den Text und dessen Entstehungsprozess: „throughout my struggle with depression i had to learn that what i was enduring wasn’t unique to me. [...] the truth was others also knew this gloom”.
Während sich in Buchform erscheinende Lyrik laut Zahlen des Börsenvereins des deutschen Buchhandels seit zehn Jahren bei mehr oder weniger einem Prozent der Umsätze einpendelte, verkaufte die Kanadierin Rupi Kaur ihre ersten beiden Bände acht Millionen mal in 42 verschiedenen Sprachen. Kaur ist Aushängeschild und Wegbereiterin einer neuen (Distributions-)Form von Lyrik, selbstbezeichnend „Instapoetry” genannt. Um das Jahr 2013 begannen anglo-amerikanische Autor*innen wie Kaur oder R. M. Drake, auf die bis dorthin überwiegend bildlich-visuell funktionierende Social-Media-Plattform Instagram Screenshots eigener Texte zu stellen.[1] Obwohl Instapoetry anfangs fast ausschließlich über Social Media und im Selbstverlag vertrieben wurde, schafften es die erfolgreichsten Instapoet*innen, innerhalb von wenigen Jahren ein Millionenpublikum zu akquirieren. R. M. Drake (2,4 Millionen Follower auf Instagram), der anonym publizierende Account atticusxo (1,5 Millionen) oder Kaur (4,1 Millionen) sind heute allesamt auch im Print Bestsellerautor*innen, deren Publikationen auf der New York Times-Bestsellerliste landen und in den wichtigen englischsprachigen Zeitungen rezensiert werden. In Kaurs tonangebender Lyrik findet man ein quasi vollständiges Kompendium der Themen, die Instapoetry häufig behandelt: Es geht um Liebe und Beziehungen, body positivity, Rassismus, Sexismus, mental health, Religion und Spiritualität, Feminismus, autobiografische Lebenserfahrungen und -realitäten. Auf formaler Ebene teilt Niels Penke in einem der ersten deutschsprachigen wissenschaftlichen Aufsätze zum Thema (feuilletonistische Beiträge gibt es bereits zur Genüge) Kaurs Lyrik in „bekenntnishafte Ich-Gedichte”, „appellative Du-Gedichte”[2] und aphoristische, meist nur einen oder wenige Sätze umfassende Kurzgedichte. Kaurs Texte sind wie die meiste populäre Instapoetry kurz, meist ungereimt und frei rhythmisiert. Sie kommunizieren plakativ ein Anliegen oder einen Sachverhalt und werden bei Bedarf von der Autorin selbst interpretiert. Dass Kaur und einige andere dadurch mit fast allen geläufigen Normvorstellungen für Literatur brechen und noch dazu zu Bestsellerautor*innen werden, ist nicht wenigen ein Dorn im Auge.
Watts vs. McNish
Im Essayband „The Sacred Wood” (1920) fasste der Lyriker und spätere Literaturnobelpreisträger T. S. Eliot ein altbekanntes Paradigma zusammen, auf dem basierend Lyrik und Literatur noch hundert Jahre später vielfach verstanden werden. „The progress of an artist”, schrieb er, „is a continual self-sacrifice, a continual extinction of personality”. Für den poeta doctus versteht sich, „that the poet has, not a ‘personality’ to express, but a particular medium, which is only a medium and not a personality”. Was macht man nun mit einer ganzen Generation von Poet*innen, von denen nicht ein einziges Gedicht von der Schöpfer-Persönlichkeit getrennt verstanden werden möchte, wo im Fall von Rupi Kaur sogar die formale Art der Publikation (immer ein persönliches Bild neben einem Gedicht) eine „Gleichrangigkeit von Autorin und Text”[3] evoziert? Im Jahr 2018 weigerte sich die britische Dichterin Rebecca Watts den neuen Gedichtband „Plum” der Spoken-Word- und YouTube-Dichterin Hollie McNish zu rezensieren. Stattdessen sorgte sie in einem polemischen Rundumschlag gegen die neuen Autor*innen von Insta- und Spoken-Word-Lyrik im Poetry National Review für einen kleinen Literaturstreit: Ähnlich wie bekannte Populist*innen à la Donald Trump stilisieren sich die neuen Poet*innen laut Watts zu „products of a cult of personality”[4]. Schlagwörter wie ‚Ehrlichkeit’ oder ‘Zugänglichkeit’ würden zur neuen Maxime der Dichtkunst erhoben, obwohl man dabei nur „the complete rejection of complexity, subtlety, eloquence and the aspiration to do anything well”[5] befeuere. „Plum”, schreibt sie in Anlehnung an T. S. Eliot über McNishs Werk, „is the product not of a poet but of a personality”[6].
Lyrik und Identitätspolitik
Mit ihrer Kritik am Personenkult einer in ihren Augen „artless poetry”[7] zerrte Watts die Lyrik auf den kulturellen Kampfplatz der Identitätspolitik. „Wenn ein Argument das Selbstwertgefühl eines Menschen beleidigt, gilt dies häufig als Diskreditierung des Sprechers”[8], schreibt der Politikwissenschaftler Francis Fukuyama. Passend dazu fühlten sich McNish und ihre Fans persönlich angegriffen und die Menschen, die diese wiederum als das ‚literarische Establishment‘ bezeichnen würden, in ihren Ansichten bestätigt. Watts kritisierte in ihrem Text nicht nur McNish und ihren „consumer-driven content”[9], sondern auch die wohlgesonnene Literaturkritik. Diese würde sich McNish wegen ihrer Rolle als marginalisierte Frau im Literaturbetrieb und Advokatin heikler gesellschaftspolitischer Themen (Sexismus, soziale Ungerechtigkeit, Rassismus, etc.) erst gar nicht anzugreifen trauen.[10] Wohlgemerkt sind sowohl Watts als auch McNish Cambridge-Alumni. Die Vermischung von Identitätspolitik und Kunst macht die neue Art von Poesie auch von linker Seite angreifbar. In Anlehnung an Slavoj Žižek könnte man sie als Symptom einer „Post-Politik”[11] betrachten, in der durch die „Entpolitisierung des ökonomischen Bereichs”[12] der öffentliche Diskurs „auf die „kulturell” limitierten Anliegen der religiösen, sexuellen, ethnischen und anderer Lebensunterschiede begrenzt bleiben”[13]. Die in der Lyrik besungenen realpolitischen Anliegen blieben damit außen vor.
T. S. Eliots und vor allem Rebecca Watts aristotelisch anmutende Forderung, Poet*in und Persönlichkeit zu trennen, wirkt nicht erst seit dem späten 20. Jahrhundert archaisch – nicht zuletzt, weil darin konstruktivistische Grundüberlegungen außer Acht gelassen werden. Für Anna Kiernan impliziert T. S. Eliots Wunsch der Trennung von Dichter*in und Persönlichkeit einen Kanon, „and the canon predominantly consists of privileged white men”. Über den (britischen) Literaturbetrieb lehrt uns der Streit über Lyrik und Identitätspolitik, dass er tendenziell immer noch eine Oxbridge-Debatte ist.
#wordporn, oder: die Erotisierung des geschriebenen Worts
Der Titel von Watts Polemik lautet „The Noble Cult of the Amateur” und spricht damit einen weiteren wichtigen Aspekt von Instapoetry an. „Serious poets [...]”, schreibt sie, „don’t start off amateurs, but apprentices”[14]. Etymologisch ist der Amateur (von lat. amator, ‚der Liebhaber’) ähnlich wie der Dilettant (von lat. delectare, ‚sich erfreuen’) von einer Bewunderung und Leidenschaft für einen Gegenstand getrieben. Der “apprentice” (von lat. apprehendere, ‚anfassen’), also der Lehrling, lernt ein Handwerk, betätigt und begreift sich in der Sphäre des Materiellen. Ein häufig reproduziertes Bild eines Dichters oder einer Dichterin ist das eines körperlich arbeitenden Menschen. „But I’ve no spade to follow men like them”, schreibt Seamus Heaney in „Digging” über sein Schreiben im Verhältnis zur Feldarbeit seiner bäuerlichen Vorfahren. „Between my finger and my thumb // The squat pen rests. // I’ll dig with it”. Paradoxerweise spielt gerade die materielle Seite der Dichtkunst – Heaneys ‚Graben‘ in endlosen Papierbögen – in der digitalen Instapoetry eine große Rolle. R. M. Drake schreibt seine Gedichte teilweise auf einer Schreibmaschine aus den 1940er Jahren und fotografiert diese ab.[15] Der Account thetypewriterdaily veröffentlicht Lyrik und Sinnsprüche im Stil einer Kopie eines Notizbuchs, dessen Seiten mit bunten Zeichnungen, Basteleien oder getrockneten Blumen verziert sind. Viele Nutzer*innen wählen für ihre Instapoetry bewusst ein nostalgisch anmutendes Erscheinungsbild: Betont schlicht gehaltene Screenshots aus Schreibprogrammen mit Schriftarten wie Times New Roman oder Courier erinnern an die Ästhetik von PC-Betriebssystemen der frühen 2000er Jahre, als viele der Autor*innen von Instapoetry selbst noch Kinder waren.
Fotografien schreibmaschinengetippter Seiten oder aufwändig kalligraphierte Notizblätter erinnern an die Praxis mittelalterlicher Handschriften. In einem 2014 erschienenen Aufsatz hat Johanna Green aus cyberpragmatischer Perspektive die „paratextual anatomy of Twitter” im Hintergrund mittelalterlicher Kodizes und antiker Papyrusrollen analysiert. Im Zusammenspiel von Text und dessen bildlicher Gestaltung geht es in der Instapoetry ähnlich wie in (hoch-)mittelalterlichen Kodizes um ein Gesamtkunstwerk aus Bild und Schrift. So gestaltete Instapoetry suggeriert lustvolles Lesen, eine Sinnlichkeit im Umgang mit dem geschriebenen Wort und seiner Materialisierung. Dies verraten konkrete „Leseanweisungen”[16] in Form von Hashtags (sammelnde Hyperlinks oder Querverweise) unter den Postings. Hinweise wie #poetrylove, #poetrylovers, #poetryislove, #poetryporn oder #wordporn helfen einerseits kleinen Accounts, in der Community der Instapoet*innen gefunden und gelesen zu werden und nähren zugleich eine programmatische Ästhetik: eine Erotisierung des geschriebenen Worts.
Ist Keats tot?
Die härteste Kritik an der Instapoetry kommt, wie im Absatz über Identitätspolitik bereits angerissen, von Literat*innen und Kritiker*innen, die sie für zu einfach, offensichtlich zu verstehen und kunstlos halten. „All the poems have messages”[17], beklagt Watts in ihrer Polemik. Hier muss man noch einmal betonen, dass bei Watts Kritik die Grenzen zwischen Instapoetry, Spoken-Word und anderen jungen Poet*innen, die sich dieser ‘Szene’ zugehörig verstehen, verschwimmen. Auch der Guardian fasst die Lyrik derselben Autor*innen in einer Replik aufn Watts’ Text als „performance poets” oder „younger poets using social media to gain an audience” zusammen. Einige dieser Autor*innen kokettieren öffentlichkeitswirksam mit dem Unmut ihrer im traditionellen Literaturbetrieb verorteten Gegner*innen. So sorgte die Neuseeländische Dichterin Hera Lindsay Bird mit ihrem Text „Keats is dead so fuck me from behind” 2016 für einen Internet-Hype.
Die mit den meisten „Likes” versehenen Gedichte von Rupi Kaur sind überwiegend die kürzesten.[18] Nicht nur die layouterischen Rahmenbedingungen der App Instagram (z. B. die Größe eines Beitragsfeldes oder die eingeschränkte Sichtbarkeit von Beiträgen mit mehreren Slides), sondern auch User*innengewohnheiten verlangen Kürze und Verständlichkeit, die es erlaubt, ein Kunstwerk im vorbeiscrollen zu sehen, zu interpretieren und zu bewerten. Die am besten performenden Beiträge muss man oft nicht einmal interpretieren: „I’m the darkest room of my life”, lautet etwa ein Gedicht von Rupi Kaur, veröffentlicht am 14.02.2021. Was an dieser Art von Texten kritisiert wird, „using a content so blatant, so ‚what it is‘, it, too, ends by being uninterpretable”[19], ist Susan Sontags Definition von Pop Art in ihrem berühmten Aufsatz „Against Interpretation”. Am Ende des Essays appelliert sie sogar – passend zum vorhin diskutierten lustvollen Lesen – an eine „erotics of art”[20] als Alternative zu einer sturen Hermeneutik. Bemerkenswert ist, dass sich die Kritik an Instapoetry und ähnlichen Lyrik-Formen häufig gegen schreibende Frauen (Holly McNish, Kate Tempest – heute Kae Tempest –, Rupi Kaur u. a.) richtet. Ob und wie in diesen Angriffen Misogynie mitklingt, müsste dringend (sowohl vor dem Hintergrund der Identitätspolitik, als auch) empirisch untersucht werden: Einen Andy Warhol oder Roy Lichtenstein würde man heute schließlich kaum aus einem Museum werfen, weil die Bedeutung des Kunstwerks zu offensichtlich ist.
Vielleicht kann man der Literaturkritik in Bezug auf Instapoetry und ähnlichen Formen eine Überforderung durch Kürze diagnostizieren, denn: Wer kann unterm Strich einen beliebigen Vers von Louise Glück von einem Satz von Rupi Kaur unterscheiden? Wer kann unter dem Vergrößerungsglas einen Pinselstrich von Monet und einen Kaffeefleck auseinanderhalten? Die von medialen Rahmenbedingungen aufoktroyierte Kürze neuer literarischer Formen verlangt von der Literaturwissenschaft und -kritik, die Bezugsgrößen ihrer Textwahrnehmung neu zu skalieren.
Lyrik und Kapital
Soziale Medien wie Instagram, Facebook oder Twitter erlauben es, die Mechanismen kulturellen und sozialen Kapitals teilweise offen einzusehen. Unter einem Posting von Rupi Kaur liest man die genaue Anzahl der Menschen, die die Tatsache, dass ihnen ein Gedicht oder ein anderer Beitrag gefällt, mit einem affirmativen ♥ markiert haben. Das soziale Kapital manifestiert sich öffentlich im Kommentarbereich (Wer spricht mit wem auf welche Weise und worüber?) oder privat in Direktnachrichten, die Instagram-User*innen senden und empfangen können. Für die hier beschriebenen Autor*innen ist die Bezeichnung Instapoetry keineswegs pejorativ, sondern eine Selbstbezeichnung. Dennoch steht hinter vielen Schreiber*innen der Wunsch nach einer gedruckten Veröffentlichung. Als Rupi Kaur trotz hunderttausender Follower auf Instagram keinen Vertriebsweg fand, publizierte sie ihren ersten Band milk and honey im Selbstverlag. Erst später erschien das Buch bei Andrews McMeel. „The moment you self-publish”, erzählt sie im Interview mit Schauspielerin Emma Watson, „you’re just locking the door. No one is going to take you seriously. I thought ‘that’s fine’, ‘cause no one is taking me seriously anyway”. Kaurs Plan ging trotz persönlicher Vorbehalte auf: Zwei Jahre nach der Veröffentlichung im Jahr 2014 landete das Buch auf der New York Times-Bestsellerliste.
„The poet’s story has long been one of a double life, split between two urgent duties: making a living and making art”, heißt es in einem Feature über Kaur im Atlantic. Tatsächlich konnten in der Literaturgeschichte die wenigsten Dichter*innen von ihrem Schreiben leben. T. S. Eliot arbeitete in einer Bank, Charles Bukowski oder William Faulkner bei der Post, William Carlos Williams war Mediziner. Instapoet*innen wie Rupi Kaur konnten sich durch ihre Online-Veröffentlichungen vom dichterischen Doppelleben lösen. Wer sich unter den Instagram-Poet*innen den notorischen Brotberuf sparen will, schafft sich häufig eine corporate identity: Hinter Kaur steht mittlerweile ein ganzes Team. In ihrem Online-Shop verkauft sie Tattoos, Siebdrucke oder T-Shirts. Der Account „ATTICUS” bietet seine Gedichte sogar auf Schmuck gedruckt an.
Die indischstämmige Kanadierin Rupi Kaur zeigt, dass weibliche People of Colour mit Working Class-Hintergrund nur mit einem Smartphone mit Internetzugang ihren Weg in den weltweiten Literaturbetrieb schaffen können. Millionen von neuen jungen Leser*innen interessieren sich für Lyrik und kaufen reichlich Bücher. 2018 verkaufte sich im Vereinigten Königreich gut 12 % mehr Lyrik als im Jahr davor. Junge Leser*innen tauschen sich aufgrund von Instapoetry online über ihre Erfahrungen mit Rassismus, Sexismus oder psychischen Problemen aus und unterstützen sich gegenseitig. Die Kommerzialisierung, die Direktheit und unmissverständliche Einfachheit der Instapoetry ist in der Geschichte der Kunst nichts Neues. Neu ist, dass nun marginalisierte Stimmen mit unterrepräsentierten Themen auf anderen, digitalen Wegen die Welt der Lyrik auf den Kopf stellen. Mit einer Steigerung der Popularität und des wirtschaftlichen Potenzials von Instapoetry müsste man künftig das Zusammenspiel einer neoliberalen Verwertungslogik mit der Identitätspolitik genauer untersuchen. Trotzdem ist es höchste Zeit, dass die (deutschsprachige) Literaturkritik diese Entwicklungen der Lyrik als ein Faktum akzeptiert und sich mit ihnen auseinandersetzt.
Benjamin Stolz, 20.03.2021
Anmerkungen:
[1] Vgl. Niels Penke: #instapoetry. Populäre Lyrik auf Instagram und ihre Affordanzen. In: Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik, 49 (2019), S. 465 ff.
[2] Ebd. S. 468.
[3] Ebd. S. 467.
[4] Rebecca Watts: The Cult of the Noble Amateur. Manchester: Poetry National Review 239 (2018), Jan./Feb., S. 14.
[5] Ebd.
[6] Ebd. S. 15.
[7] Ebd. S. 13.
[8] Francis Fukuyama: Identität. Hamburg: Hoffmann &Campe 2020, S. 143.
[9] Watts, S. 14.
[10] Vgl. ebd. S. 17.
[11] Slavoj Žižek: Ein Plädoyer für die Intoleranz. Wien: Passagen Verlag 2013, S. 92.
[12] Ebd. S. 91.
[13] Ebd.
[14] Watts, S. 17.
[15] Vgl. Jenke, S. 471.
[16] Ebd., S. 472.
[17] Watts, S. 16.
[18] Vgl. Jenke, S. 471.
[19] Susan Sontag: Against Interpretation. New York: Farrar, Strauss & Giroux, S. 10.
[20] Ebd. S. 14.
Abbildungsnachweis (Logo): Instagram.