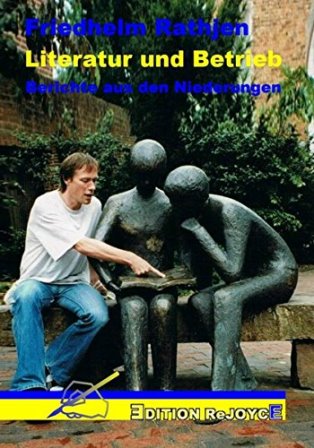
Unerwartete Entdeckungen
Friedhelm Rathjen: Literatur und Betrieb. Berichte aus den Niederungen. Südwesthörn: Edition ReJOYCE 2017. ISBN 978-3-947261-01-7. 168 S. Preis [A]: 17,50 €
Ich muss zugeben, dass der Peritext in Form von Titel und Untertitel bei mir andere Erwartungen ausgelöst hat, als sie der Text dann einlösen konnte. „Literatur und Betrieb. Berichte aus den Niederungen“ – das schien so ganz ein Thema für literaturkritik.at zu sein, denn wo sonst berichtet man so gerne über die Geheimnisse dieses Betriebs ... Deshalb freute ich mich, als mir der Autor auf meine Anfrage hin auch prompt und sehr freundlich ein Rezensionsexemplar schickte. Die lange Wartezeit bis zur Rezension entschuldige ich jetzt einfach mit der Zeitlosigkeit dieses Buchs, denn Rathjen als Literaturkritiker definiert sich – zumindest was seine Lektüreauswahl betrifft – grundsätzlich über seine Unzeitgemäßheit.
Dazu gleich noch mehr. Zunächst muss hier daran erinnert werden, dass Friedhelm Rathjen zu den wenigen Übersetzern zählt, denen es gelungen ist, die geballte Aufmerksamkeit des Feuilletons auf eine Übersetzung zu lenken und eine Debatte auszulösen, bei der es um grundlegende Fragen ging wie jene, ob eine ‚genaue’, d. h. textnahe Übersetzung wirklich auch ‚genauer’ ist oder nicht umgekehrt der Heisenberg’schen Unschärferelation folgt, heißt: je genauer desto ungenauer: „Rathjen hat jene Distanz falsch eingestellt, und seine extrem genaue Übersetzung ist eben darin ungenau und darum inadäquat“,[1] so nur als Beispiel hierzu die Diagnose von Dieter E. Zimmer über die heiß diskutierte und umstrittene Neuübersetzung von Melvilles „Moby Dick“ durch Friedhelm Rathjen. Zu dem 2001 parallel in zwei unterschiedlichen Übersetzungen erschienenen Roman[2] verzeichnet das Innsbrucker Zeitungsarchiv nicht weniger als 11 Artikel, die sich ausführlich mit der Übersetzungsfrage beschäftigen. Auf die angeführte Kritik von Sommer findet sich in Rathjens Essaysammlung dann auch eine geharnischte Replik des Autors unter dem aussagekräftigen Titel „Wal-Kampf“ (S. 127–129).
So produktiv diese Diskussion auch für die Praxis und Theorie der Übersetzung gewesen oder immer noch sein mag, so kann dieses spezielle ‚Übersetzungsdrama’ hier nicht noch einmal nacherzählt werden. Das im Vorwort des schmalen Bändchens festgehaltene Fazit des Autors, das er aus seinen konkreten Erfahrungen mit dem ‚Betrieb’ gezogen hat, ist aber vor dem Hintergrund dieser Geschichte sehr gut nachvollziehbar:
„Die Literatur ist ein hehres Gut, der Literaturbetrieb das genaue Gegenteil [...] Leider funktioniert die feine Scheidung in der Praxis aber doch nicht, da sich bei genauerem Hinsehen erweist, daß die Literatur nicht ohne Betrieb und der Betrieb nicht ohne Literatur zu haben ist.“ (S. 7)
Warum der schmale, vom Autor selbst publizierte Band aber einen aufschlussreichen Beitrag für das Verständnis von Prozessen der Literaturvermittlung darstellt, sei hier kurz erklärt:
Rathjen hat in seinem Band Buchrezensionen, Vorträge, Tagungsberichte, Lesungsmoderationen und das seltene (mir in dieser Form unbekannte) Genre der Selbstrezension („RathJoyce“, S. 159–163) gesammelt und publiziert (im Anhang finden sich fein säuberlich sämtliche Quellenangaben aufgelistet). Die Praxis, dass LiteraturkritikerInnen ihre eigenen, naturgemäß verstreuten, Texte sammeln und als ‚Werk’ zugänglich machen, findet sich mittlerweile dank der nicht mehr vorhandenen technischen und finanziellen Hürden immer öfters im Internet in der Form einer Homepage oder eines Blogs (vgl. Die Büchersäufer, Stefan Mesch, schoenauer-literatur.com). Rathjen ‚tut es’ auch, allerdings über das traditionelle Medium Buch, was vielleicht als Hommage an selbiges Medium verstanden werden kann, zumal der Autor auch sonst im Internet selbst keine Zeichen setzt. Egal ob Buch oder Internet lässt sich jedoch aus dieser Form der Selbstpräsentation auf ein bestimmtes Bild von der Aufgabe der Literaturkritikerin / des Literaturkritikers schließen, welche sich vermutlich nicht auf die Erledigung eines Auftragswerks beschränkt, sondern inhaltliche und formale Ansprüche miteinschließt, die über das Werk vermittelt werden sollen. Während die Disparatheit der in den verschiedensten Medien verstreuten literaturkritischen Texte es kaum erlaubt, dass man sich als Leser ein ‚Bild’ von einzelnen KritikerInnen macht, ist das über diesen Weg nicht nur möglich, sondern wird sogar durch die Sammlung angeregt. Selbst-‚Erhebung’ (Kritiker = Autor) sowie Selbst-‚Erniedrigung’ (Kritiker = Objekt der Kritik) sind die zwei gegensätzlichen Rollen, die sich daraus ergeben, denn der / die KritikerIn legt damit dieselben (hohen) Maßstäbe an sich selbst wie an die besprochenen Werke an und setzt sich auch als Objekt der Kritik aus. Wir kennen diesen Anspruch an die Literaturkritik als ‚vierte Gattung’ vor allem aus der Zeit der impressionistischen Kritik (Hermann Bahr, Alfred Kerr u.a.) und finden diesen immer dort, wo die Abgrenzung zum Markt und die Autonomie der Kritik deutlich eingefordert werden. Dass Rathjen sich eher im ‚Subfeld der reinen/eingeschränkten Produktion’ zu Hause fühlt als in jenem der Massenproduktion (vgl. Pierre Bourdieu) [3] zeigt sich deutlich in seiner Lektüre- und Themenliste, die abgesehen von den Werken Melvilles und Joyces, mit denen der Autor durch seine Übersetzertätigkeit ‚wortwörtlich’ vertraut ist, auch Arno Schmidt,[4] Samuel Beckett, Marianne Fritz, Josef Winkler oder „Konzepte der Avantgarde“ enthält. Dazu passt auch die klare Abstinenz von ‚autorinfizierten’ Interpretationsmethoden sowie der geschulte Blick auf formalästhetische, also sprachliche und stilistische Feinheiten.[5] In Erinnerung an Hubert Winkels’ Essay über die „Emphatiker und Gnostiker“[6] in der deutschsprachigen Literaturkritik kann Rathjen als beispielhafter Vertreter der letzteren Spezies genannt werden, die tapfer um die Einhaltung einer Spielregel kämpft, ohne die das alles ein ziemlich nüchternes Geschäft wäre: „Ohne taktisches Verständnis kein Spaß am Spiel.“[7]
Doch abgesehen von der hier skizzierten möglichen ‚Verwendungsmöglichkeit’ von Rathjens Werk als anschauliches Material für die Exemplifizierung des literarischen Feldes der Gegenwart finden sich darin auch noch andere für den Literaturbetrieb aufschlussreiche Details, so der Blick auf die weitgehend unbekannte Seite des britischen Lyrikers Edward Thomas (1878–1917), auf dessen Prosawerke Rathjen in einem Aufsatz eingeht und dort auch dessen Tätigkeit als Literaturkritiker erwähnt.[8] Diese ist sowohl inhaltlich von Bedeutung als auch rein quantitativ, denn „Edward Thomas gehört als Rezensent immerhin zu den ersten, die die frühen Verse von Ezra Pound willkommen heißen“ (S. 23) und „gelegentlich rezensiert er bis zu dreizehn Bücher pro Woche, und insgesamt schreibt er für Zeitungen eine Textmenge, die mindestens drei Romanen von Buddenbrooks- oder Ulysses-Länge entspricht“ (S. 18). Ebenso wenig wie sich um 1900 mit solcherlei „Fronarbeit“ (ebd.) Existenzängste bekämpfen ließen, sieht auch der ökonomische Gegenwert für Literaturvermittler in heutigen Tagen prekär aus: Rathjen gibt offenen Einblick in seinen Finanzhaushalt und wählt zur Illustration dafür die Einnahmen eines wörtlich „superben Jahr[es]“, in dem er mit einer Übersetzung, Rezensionshonoraren und Ausschüttungen der VG-Wort auf 25.497,93 DM kam (1992) – das sind umgerechnet ca. 13.000 Euro – das liegt nicht weit entfernt von der Armutsgrenze in Deutschland (11.749 Euro) und es tröstet vermutlich auch nicht, dass 56% der AutorInnen in den USA unter der dortigen Artmutsgrenze leben (11.670 US Dollar/10.000 Euro).[9] Doch die negative Bilanz trifft nicht nur das ökonomische, sondern auch das soziale Kapital: „Das Rezensieren ist ein undankbares Geschäft, das nur Ärger bringt, und zwar für alle Beteiligten“ (S. 159). Wer wissen möchte, wie sich „all dieser Verdruß“ vermeiden lässt, soll sich Rat bei „RathJoyce“ holen, denn dort wird der „Königsweg zum ärgerlosen Rezensieren“ vorgestellt (S. 159–163).
Renate Giacomuzzi, 28.09.2018
Renate.Giacomuzzi@uibk.ac.at
Anmerkungen:
[1] Dieter E. Sommer: Adolf Adda Ahab – Vor 150 Jahren erschien Herman Melvilles Roman ‚Moby-Dick’. Nach langem Streit gibt es jetzt zwei neue Übersetzungen. Welche ist besser? In: Die Zeit, Literaturbeilage Nr. 47, 15. November 2001, S. L3.
[2] Herman Melville: Moby-Dick oder Der Wal, aus dem Englischen von Matthias Jendis, hg. von Daniel Göske. München: Carl Hanser Verlag 2001. – Moby Dick; oder: Der Wal, aus dem Englischen von Friedhelm Rathjen. In: Schreibheft 57, hrsg. von Norbert Wehr. Essen: Rigodon-Verlag 2001 [enthält 28 Kapitel]; München: Zweitausendeins 2004 [vollständige Fassung].
[3] Die Regeln der Kunst. Genese und Struktur des literarischen Feldes. Frankfurt/Main: Suhrkamp 1999.
[4] Rathjen gehört zu den Herausgebern des „Bargfelder Boten“, des Fachorgans der Arno-Schmidt-Forschung.
[5] Als Beispiel hier zwei Auszüge aus einer Besprechung von Josef Winklers Novelle „Ein Tod in Rom“ (2001): „Ich weiß nicht, ob der Autor Josef Winkler ein Getriebener ist, diese Frage interessiert mich eigentlich auch nicht, weil es mir beim Lesen um das Buch und nicht um den Autor außerhalb dieses Buches geht; aber der Stellvertreter des Autors im Buch, nämlich die Instanz des Erzählers, ist in jedem Fall getrieben“ (S. 49f.). - „Die Novelle Natura morta ist sprachlich, formal und perspektivisch überaus streng durchgearbeitet, deshalb ist sie ein Höhepunkt im Schaffen Josef Winklers. Sprache und Form sind dem inhaltlichen Geschehen durchweg adäquat“ (S. 55).
[6] Hubert Winkels: Emphatiker und Gnostiker. Über eine Spaltung im deutschen Literaturbetrieb – und wozu sie gut ist. In: Die Zeit, Nr.14, 30.3.2006, S. 59. Vgl. dazu auch Stefan Neuhaus: „Emphatiker und Gnostiker: Chancen und Risiken der Literaturkritik“. In ders.: Literaturvermittlung. Stuttgart: UVK 2009, S. 200–233.
[7] Winkels, ebd.
[8] „Der Bekümmerte. Edward Thomas und sein Roman Die Unbekümmerten“, S. 15–26.
[9] Vgl. Thomas Klingenmaier: Die niedrig gelegte Bezahlschranke. In: Stuttgarter Zeitung, 27.8.2012, Nr. 198, S.12.