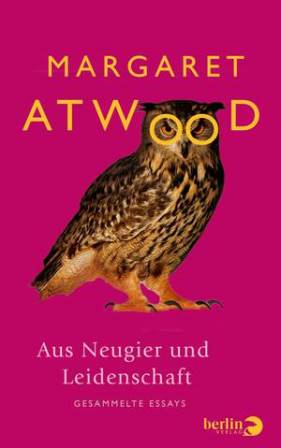
Ein Leben in Texten
Margaret Atwood: Aus Neugier und Leidenschaft. Gesammelte Essays. Berlin: Berlin Verlag, 2017. ISBN 978-3-8270-0666-0. 477 S. Preis [A]: 28,80 €
Wieso aussagekräftige Originaltitel in der deutschen Übersetzung häufig durch völlig uninspirierte und austauschbare ersetzt werden, bleibt rätselhaft. Natürlich lassen sich manche Wortspiele nur schwer übersetzen, aber Margaret Atwoods 2005 erschienenen Essayband Curious Pursuits für die deutsche Ausgabe zu Aus Neugier und Leidenschaft semantisch zu massakrieren, ist doch einigermaßen phantasielos ohne Not. Das war das Haar in der Suppe, ein Härchen eigentlich nur, der Rest schmeckt vorzüglich. Der Band versammelt Gelegenheitswerke aus 35 Jahren, unterteilt in drei zeitliche Abschnitte, 1970–1989, 1990–1999 und 2000–2005. Diese Einteilung markiert Zäsuren in Atwoods Leben und damit auch in ihrem Schaffen. Die kurzen Texte, zusammengetragen aus ihrem nicht-fiktionalen Werk, sind unterschiedlicher Natur, es finden sich Reiseberichte, Nachrufe, Reden, Essays zum eigenen Schreiben und Rezensionen darunter.
Atwood als Kritikerin
Margaret Atwood ist eine herausragende Schriftstellerin. Sie ist eine großartige Essayistin. Als Kritikerin kann sie aber nur leidlich überzeugen, zumindest, wenn man sich eine konventionelle Rezension erwartet. Das mag daran liegen, dass ihr das Rezensieren eigentlich zuwider ist. Dass sie es trotzdem tut, erklärt sie aus dem Fairnessprinzip des Gebens und Nehmens:
„Und Rezensionen zu schreiben, finde ich immer problematisch: Es erinnert so an Hausaufgaben und ich bin dabei gezwungen, eine Meinung zu haben, statt nur, frei nach Keats, die Fähigkeit zu akzeptieren, dass nicht jeder komplexe Sachverhalt erschöpfend erklärt werden kann. Was der Verdauung so viel besser täte. Ich schreibe trotzdem welche, denn wer rezensiert wird, soll auch seinerseits rezensieren, sonst hat das Prinzip der Gegenseitigkeit versagt.“ (S. 10)
Eine großzügige Geste, aber auch ein seltsames Missverständnis: Die Liste der SchriftstellerInnen, die genauso begnadet als KritikerInnen in Erscheinung traten, ist ebenso lang wie jene der SchriftstellerInnen, die schon bei der Auslegung der eigenen Texte wenig Inspiration zeigten. Überhaupt greift Atwoods Einstellung zur Kritik sehr kurz. Sie unterscheidet „zwei Arten von Rezensionen“, nämlich die „journalistische Rezension, die auf den Klatsch am Dorfbrunnen zurückgeht“ und „andererseits die ‚akademische‘ Rezension, die auf die Bibelexegese und andere Traditionen der minutiösen Erforschung sakraler Texte zurückgeht. Hinter dieser Art von Analyse steht unausgesprochen der Glaube, dass manche Texte heiliger sind als andere und dass man mithilfe einer Lupe oder Zitronensaft verborgenen Sinn aufdecken kann.“ (ebd.). Man möchte doch hoffen, dass es zwischen Klatsch und sakraler Wertungshierarchie noch andere Formen der Kritik gibt. Auch wenn Atwood gleich nachschiebt, dass sie selbst beides geschrieben hätte, merkt man doch, dass sie sich im Feld der professionellen Wertung nicht heimisch fühlt. Verrisse finden sich keine, Atwoods Verständnis als Kritikerin lässt vermuten, dass sie auch keine geschrieben hat. Schlechte Bücher zu besprechen findet sie nämlich sinnlos:
„Ich bespreche keine Bücher, die mir nicht gefallen, obwohl das die Ms. Hyde in mir natürlich spaßig fände und die eher maliziös gesinnten Leser unterhaltsam. Aber entweder ist ein Buch wirklich schlecht, dann sollte es überhaupt nicht besprochen werden, oder es ist gut, aber nicht mein Fall, und dann sollte jemand anderes es besprechen.“ (S. 10)
Das mag aus der Warte der Schriftstellerin eine nachvollziehbare Position sein, der Literatur dient sie aber nicht und genau der sind KritikerInnen verpflichtet, niemals den AutorInnen. Natürlich macht es keinen Sinn, sich ein unbeachtetes Debüt vorzuknöpfen und es genüsslich zu filetieren. Spaß macht das bestimmt, zumindest der Kritikerin, doch wer ein Exempel statuieren will, muss sich schon dem Anerkannten zuwenden. Nur dass man ein „schlechtes“ Buch gar nicht besprechen sollte, ist zu kurz gedacht. Verrisse nehmen die Literatur ernst, paternalistisches Schonen tut das nicht. Auch der zweite Punkt ist als persönliche Haltung nachvollziehbar, sollte aber nicht als Position der Kritik verabsolutiert werden. Gerade KritikerInnen müssen dazu in der Lage sein, den persönlichen Geschmack zu überwinden und die Qualitäten eines Textes zu erkennen und herauszustellen, obwohl er die eigenen Lektürebedürfnisse nicht befriedigt. Das ist professionelles Lesen. Eine solch professionelle Leserin möchte Atwood indes gar nicht sein. Im Vorwort zu Susanna Moodies Roughing it in the Bush schreibt sie: „Ich bin ja weder Historikerin noch Literaturwissenschaftlerin, sondern Autorin von Prosa und Gedichten, und solche Menschen sind notorisch subjektive Leser.“ (S. 91). So paradox das ist, gute SchriftstellerInnen sind nicht zwangsläufig gute LeserInnen. Das wiederum ist Margaret Atwood sehr wohl. Die Kraft ihrer unorthodoxen Besprechungen liegt daher gerade in der Verweigerung der Objektivierbarkeit.
Die abgedruckten Rezensionen sind etwas unstrukturiert und diffus, sie mischen Inhaltsangabe, Reflexion und Persönliches. Am Anfang steht oft überschwängliches Lob, wie hier in der Besprechung von Toni Morrisons Menschenkind, erschienen 1987 in der New York Times Book Review:
„Menschenkind ist Toni Morrisons fünfter Roman und wieder ein Triumph. Morrisons Vielseitigkeit, ihr Talent und Einfühlungsvermögen sind schier grenzenlos. Gäbe es noch Zweifel an ihrem Rang unter den größten Autoren der zeitgenössischen amerikanischen Literatur, Menschenkind würde sie ausräumen. Mit einem Wort: Es ist ein Schocker.“ (S. 101)
Womit andere KritikerInnen ihre Rezension zufrieden beschlossen hätten, einer zusammenfassenden Einordnung von Autorin und Werk, das setzt Atwood unbekümmert an den Beginn. Ihre Begeisterung lässt sie sich von gattungstypischen Vorgaben nicht nehmen, auch künstlich Spannung aufzubauen hat sie nicht nötig. Atwood folgt ihrer eigenen Dramaturgie. Die Besprechung von John Updikes Die Hexen von Eastwick ist etwa ein launiger Essay mit sokratischen Elementen. Ihr Lob ist gespickt von ironischen Spitzen, die zeigen, dass sie misogyne Schwingungen durchaus nicht überlesen hat. Als Feministin kann sie gar nicht anders, als beim Thema Hexen hellhörig zu werden. Doch zum einen lässt sich die Leserin Atwood die Freude an Updikes Schreibkunst nicht nehmen, zum anderen liest sie differenziert und geht dem Erzähler nicht auf den Leim: „Und was die Hexen betrifft, da weist so manches darauf hin, dass sie ein Produkt der Fantasie von Eastwick sind – sprich von Amerika. Und wenn dem so ist, dann sollte man das tunlichst zur Kenntnis nehmen. Das ist ein guter Grund, das Buch zu lesen.“ (S. 90). So unprätentiös würde kaum ein anderer Kritiker ein Buch anpreisen.
Die Autoren, die Atwood sich aussucht, sind allesamt politisch und durchwegs unbequem. Eine Nähe zum eigenen Werk wird dabei spürbar. Neben den Großen der Weltliteratur wie Morrison, Updike, Pamuk, verhilft sie gerade unbekannteren, übersehenen oder in Vergessenheit geratenen kanadischen Schriftstellerinnen zu Aufmerksamkeit. Ihren Fokus legt sie auf den Inhalt, wobei sie durchaus und auch ganz bewusst moralische Maßstäbe anlegt. Ästhetische und formale Fragestellungen stellt sie dafür eher hinten an, sprachliche Qualität setzt sie voraus. Ihre Rezensionen sind unheimlich dicht, voller Faktenwissen, literarischer Bezüge und kleiner Details. Die Autorin Atwood entdeckt die Raffinessen anderer AutorInnen sofort. Gerade das macht sie dann doch zu einer großartigen Kritikerin: Sie weiß wohin sie schauen muss. Dass sie deshalbTexte aussucht, die ihr von vornherein leicht zugänglich sind, kann man nachsehen, dafür bekommt man ungemein scharfsinnige Analysen. Außerdem erfüllt sie etwas, wozu nur die richtig guten KritikerInnen in der Lage sind: Ihre Rezensionen haben ästhetischen und intellektuellen Eigenwert. Sie beziehen sich immer auf die Gesellschaft und gehen weit über die Referenz zum besprochenen Text hinaus.
Und der Rest…
Hauptaugenmerk wurde für diese Besprechung auf die Kritikerin Atwood gelegt. Das betrifftt insgesamt nur einen kleinen Teil des Buches. Der Band ist Autobiografie und Poetik zugleich. „Die Werke anderer zu rezensieren zwingt einen, die eigenen ethischen und ästhetischen Vorlieben unter die Lupe zu nehmen.“ Im Gegensatz zu vielen anderen KritikerInnen verschleiert sie diese Vorlieben nicht und legt ihre Parameter offen. Es sind daher nicht zuletzt ihre Kritiken, die Atwood sehr persönlich zeigen, ihre ästhetischen und politischen Positionen, die Art, wie sie sich die Welt aneignet. Das Besondere und Unverwechselbare an Atwoods politischen Essays ist die Radikalität und Unkorrumpierbarkeit ihrer Haltungen, aber die Großzügigkeit ihrer Anwendung. Atwood ist stilistisch und argumentativ unheimlich klar und geradlinig, verfügt aber auch über die rare Fähigkeit, Ambivalenzen auszuhalten. Reportagen und Reiseberichte nehmen uns mit auf Atwoods erste Reise durch ein Europa, von dem sie schwer enttäuscht war, sie bringen uns in ein Afghanistan am Rande des Krieges und auf Edinburghs unvergleichliches Fringe-Festival. Am Großartigsten aber sind Atwoods Vorlesungen und Essays zur Literatur. Ihr 1993 an der University of Gloucester gehaltener Vortrag Übeltäterinnen mit befleckten Händen. Von der Schwierigkeit, über böse Frauen zu schreiben ist eine bitterböse Abrechnung mit der patriarchalen Literaturgeschichte. Missstände zu analysieren und anzuprangern, ohne den Humor zu verlieren und verbittert zu werden, ist eine der großen Stärken von Margaret Atwood. (Nicht, dass beides nicht verständlich wäre, nur sind humorlose und verbitterte Texte eher schlecht verdaulich.) So manche Flapsigkeit hat die Kritik der Übersetzung angelastet, das mag sein, indes gehört das (auch im Original) zum Programm. Wer würde einen Nachruf so beginnen, wenn nicht Margaret Atwood: „Mordecai Richler ist nicht mehr, und mit ihm ist ein großes Licht erloschen. Doch was für ein Licht? Nicht die olympische Fackel, nicht der Heiligenschein der Engel. Denken Sie eher an die Laterne des grummeligen, scharfzüngigen, fassbewohnenden Diogenes, der bei Tageslicht nach einem ehrlichen Menschen sucht.“ (S. 289). So geht es einem mit jedem von Atwoods Texten. Sie beginnen mit einem Paukenschlag und halten dieses Niveau dann auch, so dass man (so klischeehaft das auch klingt) das Buch kaum aus der Hand legen kann.
Veronika Schuchter, 28.09.2018
Veronika.Schuchter@uibk.ac.at