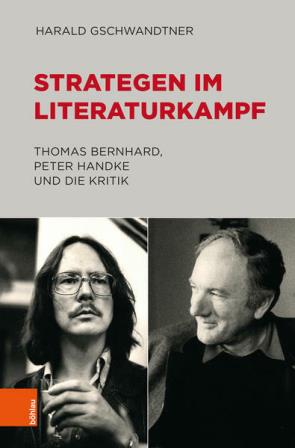
Die Jukebox im literarischen Feld
Harald Gschwandtner: Strategien im Literaturkampf. Thomas Bernhard, Peter Handke und die Kritik. Wien, Köln, Weimar: Böhlau 2021. 480 S. (Literaturgeschichte in Studien und Quellen, Bd. 31). ISBN 978-3-205-21230-0. Preis [A]: 78,00 €.
Peter Handke gegen Marcel Reich-Ranicki, Marcel Reich-Ranicki gegen Peter Handke, Peter Handke gegen Siegfried Unseld, Elias Canetti gegen Thomas Bernhard, Thomas Bernhard gegen Bruno Kreisky, Peter Turrini, Gerhard Roth, Peter Handke, eigentlich gegen überhaupt alle: Zugegebenermaßen – so ganz kann man sich der Versuchung nicht erwehren, die großen Fehden der österreichischen Nachkriegsliteratur als Hahnenkämpfe innerhalb einer narzisstisch veranlagten Männerriege abzutun. Als „literaturbetrieblicher gossip“ (S. 25) scheinen sie allenfalls für eine biographistisch ausgerichtete Forschung interessant; ansonsten wird man tatsächlich, frei nach Handke, lieber „über die Literatur reden als über das gegenwärtige Geschäft“ (S. 133).
Harald Gschwandtner jedoch nimmt die Debatten und die darin verwickelten Akteure ernst: Das Ergebnis ist eine profunde Analyse, die zeigt, um wie viel komplexer man sich die Auseinandersetzungen innerhalb des literarischen Feldes ab den 1960er-Jahren denken muss. Seine Arbeit (ursprünglich als Dissertation an der Universität Salzburg eingereicht) bietet weit mehr als eine Nacherzählung der Ereignisse rund um die öffentlich ausgetragenen Konflikte. Deren Beschreibung ist freilich nicht unwesentlich: Obschon Gschwandtner bescheiden von einer auf ausgewählte Anekdoten basierenden Herangehensweise spricht, liefert er doch eine Fülle von Fakten, die über die allgemein bekannten Streitfälle hinausreichen. Dass bestimmte Aspekte – etwa Handkes vieldiskutierte Positionierungen in Hinblick auf die Jugoslawienkriege – bewusst ausgespart bleiben, ist nicht nur aus arbeitsökonomischen Gründen verständlich, sondern auch notwendig, um das zentrale Thema nicht aus den Augen zu verlieren. Besonders arbeitsökonomisch scheint Gschwandtner indes nicht vorgegangen sein: Er hat nicht nur die – bei Autoren dieses Renommees sehr umfangreiche – Sekundärliteratur, sondern auch Rezensionen, Interviews und Materialien aus dem Nachlass gesichtet.
Seine intensive Auseinandersetzung mit dem schriftstellerischen Werk von Bernhard und Handke ist schließlich dem Vorhaben geschuldet, die wechselseitige Beeinflussung von Literaturkritik und literarischer Ästhetik in den Blick zu nehmen. In diesem Sinne sind die Kapitelüberschriften, die immer wieder Zitate und Werktitel kombinieren, mehr als eine inhaltliche Orientierungshilfe: Sie zeigen Gschwandtners Verfahren, seine Thesen in jedem Fall mit konkreten Verweisen zu belegen; gleichermaßen legen sie sein Bemühen offen, Selbstaussagen ebenso wie Kommentare anderer in Beziehung zum literarischen Schaffen der Autoren zu setzen. Damit nimmt er sich nicht nur dem Desiderat einer genauen Untersuchung von Bernhards und Handkes Verhältnis zur Literaturkritik an: Er fragt darüber hinaus nach ästhetischen Kriterien, die Urteile der Kritiker ebenso wie die verteidigenden Kommentare der Autoren erklären können, und danach, wie sich öffentliche Reaktionen auf Schreibprozesse und -prämissen ausgewirkt haben. Auch wenn Selbstaussagen der Autoren nicht vorschnell mit jenen ihrer Figuren analog gesetzt werden, kann Gschwandtner dennoch subtil nachzeichnen, wie fiktionales und non-fiktionales Sprechen ineinander übergehen, insbesondere dann, wenn es um Fragen der literarischen Wertung geht. Mehrmals motiviert er dabei zu einer Relektüre der literarischen Texte, die er weniger als eine Auseinandersetzung mit Literatur per se als mit Formen der Literatur- bzw. Theaterkritik verstanden wissen will. Meinungsstreitigkeiten interessieren nicht als Ausdruck persönlicher Feindschaften, sondern als ernstzunehmende Diskussionen auf der Suche nach neuen literarischen Formen und Wertmaßstäben.
Dass bei der Austragung der Konflikte persönliche Befindlichkeiten – seien es Herkunftskomplexe, Aufmerksamkeitsdefizite, der Wunsch nach Bestätigung oder gekränkte Eitelkeiten – eine Rolle gespielt haben dürften, verhehlt Gschwandtner nicht. Auf (küchen-)psychologische Deutungen verzichtet er jedoch: Er analysiert die Kontroversen hauptsächlich vor der Folie der Bourdieu’schen Theorien zum literarischen Feld, die die Fälle Bernhard und Handke als repräsentative Beispiele für Machtkämpfe um kulturelles Kapital vorführen. So wie ihr Einsatz für wenig beachtete Autoren an eigene Vorstellungen von Autorschaft geknüpft ist, so lassen sich auch gegenseitige Rivalitäten als Kampf um die beste Positionierung innerhalb der Kulturszene verstehen. Selbststilisierungen der Autoren zu jugendlichen Neuankömmlingen, unnachgiebigen Polemikern und Einzelgängern sind ebenso wie das Gebaren des autorativen Kritikers, wie es Marcel Reich-Ranicki zeitlebens kultiviert hat, Teil von Inszenierungsstrategien, die eine Verortung im literarischen Feld ermöglichen. In diesem Sinne erklärt Gschwandtner empfindliche Reaktionen auf negative Urteile auch nicht als persönliche Disposition der Autoren, sondern, in Anlehnung an Bourdieu, mit der generellen Abhängigkeit des Künstlers von Fremdbildern, die maßgeblich für Selbstvorstellungen werden.
Dass bei der Frage nach der (strategischen) Gegnerschaft zwischen Autor und Literaturkritiker die Wahl auf Thomas Bernhard und Peter Handke gefallen ist, nimmt nicht weiter wunder. Beide treten Anfang der 60er-Jahre mit vielversprechenden Debütromanen in das literarische Feld ein, um in den nächsten Jahrzehnten zu den bedeutendsten österreichischen Schriftstellern zu avancieren; vor allem aber verbindet sie der Hang zur Provokation, der immer wieder zu skandalträchtigen Grabenkämpfen führt. Die Presse spielt dabei eine entscheidende Rolle: Der fanatische Zeitungsleser Bernhard und der vehement alles Journalistische ablehnende Handke treffen sich in ihrer gemeinsamen Antipathie für die Rezensenten. Ihre Formen der Verteidigung unterscheiden sich zwar grundlegend (wobei Gschwandtner den differenzierten Polemiken Handkes eindeutig mehr Sympathie zollt als Bernhards schwer einzuordnenden Rundumschlägen); gemein ist ihnen jedoch ein hohes Maß an Verletzlichkeit, das sie zu rhetorisch scharfen Gegenangriffen veranlasst. Interessanterweise haben sich sowohl Handke als auch Bernhard – unbewusst oder bewusst im Sinne einer Stilisierung als Opfer einer feindlich gesinnten Literaturkritik – wiederholt als durchwegs abgeurteilte Autoren präsentiert: ein Selbstbild, das Gschwandtners Prüfung nicht standhält.
Auf jeden Fall erlangen die Autoren ebenso wie die Kritiker, allen voran Marcel Reich-Ranicki, durch ihre Fehden große mediale Aufmerksamkeit – nur eine von vielen Konsequenzen im Literaturkampf, von denen Gschwandtner spricht. Vor allem im Zusammenhang mit Handke kann er nachweisen, dass dieser gerade durch die literaturkritische Praxis zu tiefgreifenden poetischen Selbstreflexionen motiviert wurde. Der Autor sah sich offenbar dazu verpflichtet, bei der Auseinandersetzung mit Werturteilen seiner Kontrahenten die eigene literarische Ausrichtung klar zu formulieren und zu festigen. Gleichzeitig wird in ihm – die formelhafte Sprache des Journalismus zurückweisend – der Wunsch nach neuen Formen der Literaturkritik laut. Handkes eigene Besprechungen, auf die Gschwandtner sehr ausführlich eingeht, sind folglich eher Beschreibungen von sinnlichen Lektüreerfahrungen denn Bewertungen: Sie lesen sich als Plädoyer für eine suchende, fragende statt urteilende Betrachtung von Literatur, die ohne sprachliche Automatismen und Klischees auskommt.
Tatsächlich verdankt Gschwandtners Arbeit ihre besondere Qualität der Analyse des „Sounds“ (S. 333), sei es der literarischen Texte, der Rezensionen und Verrisse oder der selbstverteidigenden Gegenantworten. Sind Verfahren der Provokation und Eskalation hinlänglich bekannt, so kann Gschwandtner doch aufzeigen, wie (sprachliche) Bilder und Topoi – etwa jener der Bücherverbrennung oder die Darstellung des Kritikers als aggressiver Hund – über Jahrzehnte fortgeschrieben werden. Nach seinem Befund sind sowohl Aussagen als auch Formulierungen der gegenseitigen Kampfansagen erstaunlich unoriginell: Gschwandtners Liste der im ähnlichen Wortlaut wiederholten Vorwürfe dürften somit als typische Techniken der Ablehnung und Diffamierung im Literaturbetrieb von allgemeingültiger Bedeutung sein. Dazu zählen die Gleichsetzung mit trivialen Autorinnen und Autoren ebenso wie die Vorhaltung, den Erfolg nur einem ökonomischen Kalkül und einer geschickten Selbstvermarktung zu verdanken, also ein „imposter“ (S. 218) im literarischen Feld zu sein.
Hier mehr denn anderswo beweist Gschwandtner, dass er nicht nur eine Abhandlung über Bernhard und Handke geschrieben hat (was tatsächlich – um ein Lieblingswort Marcel Reich-Ranickis in Bezug auf Handkes Prosa zu bemühen – langweilig wäre). Vielmehr berührt er generelle Fragen zu den Ein- und Ausschlussmechanismen im Literaturbetrieb: Dabei nimmt er sowohl zeitgebundene Zusammenhänge als auch prinzipielle Aspekte von inszenierter Autorschaft, literarischer Wertung und Vermarktung in den Blick. Gerade weil dabei immer wieder die etablierten Formen der Betrachtung von Literatur in Frage gestellt werden, handelt es sich um ein wichtiges Buch – es ist gewissermaßen (um hier zumindest ein wenig Handkes Forderungen nach ungewöhnlichen Formulierungen Genüge zu tun) ein Beatles-Album der Auseinandersetzung mit Literaturkritik.
Maria Piok, 12.07.2021