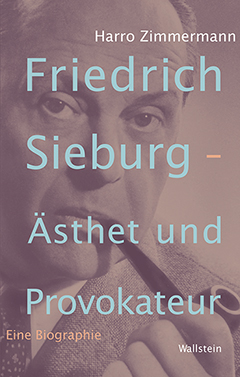
"Nur selten überlebt ein deutscher Kritiker seinen Tod"
Über Literaturkritiker als Gegenstand dickleibiger Biographien. Beiläufige Marginalien zu Harro Zimmermanns Friedrich-Sieburg-Porträt. Von Michael PilzDass nach dem Ableben Marcel Reich-Ranickis kürzlich eine gründlich überarbeitete und wesentlich ergänzte Neuauflage von Uwe Wittstocks MRR-Biographie aus dem Jahr 2005 herausgekommen ist, war nicht weiter verwunderlich – sowohl mit Blick auf die Prominenz des Porträtierten als auch auf dessen exzeptionelle Lebensgeschichte, die Reich-Ranicki bereits selbst in seinem autobiographischen Bestseller Mein Leben verarbeitet hatte. Auch Autobiographien von anderen so genannten „Großkritikern“ sind ja durchaus keine Seltenheit, wie nach den beiden unlängst verstorbenen Hellmut Karasek (Auf der Flucht, 2004) und Fritz J. Raddatz (Unruhestifter, 2003) zum Beispiel auch Joachim Kaiser mit seinem Erinnerungsband Ich bin der letzte Mohikaner von 2008 unter Beweis gestellt hat (wobei dessen Titel mit der zunehmenden Bevölkerungsdichte in den ewigen Jagdgründen des Feuilletons mehr und mehr an Evidenz gewinnt). Ob den drei zuletzt Genannten dereinst einmal die Ehre zuteilwerden wird, selber einen oder gar mehrere Biographen zu finden, die ihre Lebensgeschichten für den Sachbuchmarkt rekonstruieren und spannend aufbereitet nacherzählen werden, mag zumindest ungewiss, mit Sicherheit aber weit weniger selbstverständlich erscheinen als im Falle Reich-Ranickis, der ja bereits zu Lebzeiten nicht zu knapp mit biographischer Aufmerksamkeit von Seiten Dritter bedacht worden war. Dass dafür sein Rang als schreibender Kritiker keineswegs den alleinigen Ausschlag gegeben hat und ein nicht unerheblicher Teil des Interesses gerade auch breiterer Leserschichten auf die Popularität und die Wirkung einer multimedial inszenierten Figur zurückzuführen ist, ist naheliegend.
Denn gemeinhin gehören Literaturkritiker wahrlich nicht zu den bevorzugten Personengruppen, die auch jenseits von akademischer Fachliteratur, von Tagungsbänden und gelehrten Einzelanalysen für das Format des biographischen Sachbuchs infrage kommen; die Vorrangstellung ist da zweifellos Dichtern und Schriftstellern im engeren Sinne, Politikern und gekrönten Häuptern oder auch sonstiger Berühmtheiten aus den Feldern des Sports, der Wissenschaften und der Kulturproduktion von der Malerei bis zur Musik zuzusprechen. Kritiker, Feuilletonisten und Essayisten, die spätestens seit den Causerien eines Charles-Augustin Sainte-Beuve selber zu den kleinmeisterlichen Porträtisten des literarischen Diskurses gezählt werden können, erreichen dagegen nur selten einen Grad an Prominenz, der zur Begründung der Notwendigkeit eines eigenen Porträts in voller Buchlänge ausreichend erscheint (wobei der genannte Sainte-Beuve dank Wolf Lepennies’ sogar bei dtv nachgedruckter Studie gleich die sprichwörtliche Ausnahme liefert, die diese Regel bestätigen könnte). Allenfalls ‚Auch-Kritiker‘, wie etwa Tucholsky oder Walter Benjamin, dürften auf die Breite gesehen das Zeug dazu haben, in nennenswerter Anzahl als Gegenstand auf dem Sachbuchmarkt für Literaturliebhaber zu reüssieren. Selbst eine so schillernde Intellektuellen-Figur wie Alfred Kerr, die nun wahrlich Stoff genug für eine ebenso abwechslungs- wie pointenreiche Lebensbeschreibung bieten würde, hat demgegenüber bis heute keinen Biographen gefunden. Von weit weniger narzisstisch veranlagten Protagonisten des literaturkritischen Diskurses wie Max Rychner oder Walter Boehlich, Hans Mayer oder Reinhard Baumgart ganz zu schweigen.
Vor diesem Hintergrund muss es schon ein wenig auffallen, dass dem einstmals zwar stark polarisierenden, aber heute weitestgehend verschollenen Friedrich Sieburg – dem seinerzeit das Prädikat eines konservativen „Literaturpapsts“ der 1950er und frühen 1960er Jahre zugemessen worden war – binnen relativ kurzer Frist nun schon die dritte Biographie gewidmet worden ist, die sein Leben im vollen Durchlauf von der Wiege bis zur Bahre nacherzählt: Nach der eher schmalbrüstigen, zweifellos gut gemeinten, aber weitestgehend hagiographisch-apologetischen Arbeit der betagten Sieburg-Verehrerin Cecilia von Buddenbrock, die zunächst auf Französisch, 2007 dann auch auf Deutsch erschienen ist und durch die Veröffentlichung in der Societäts-Druckerei, also im Verlag der einstmaligen Frankfurter Zeitung und heutigen FAZ gleichsam den Anstrich eines offiziösen Paratexts für den langjährigen Hausautor Sieburg erhalten hat; sowie nach der 2014 punktgenau zum 50. Todestag vorgelegten voluminösen Arbeit von Klaus Deinet, die nicht ohne einen gewissen Hang zum Monumentalen auf 630 eng bedruckten Seiten die Ergebnisse akribischer Archivrecherchen präsentiert, legt nun Harro Zimmerman unter dem Titel Friedrich Sieburg – Ästhet und Provokateur noch einmal einen immerhin über 480 Seiten starken Band mit dem schlichten Zusatz „Eine Biographie“ vor. Von Marcel Reich-Ranicki einmal abgesehen dürfte sein Vorgänger im Amt des Literaturchefs der FAZ damit wohl der einzige deutschsprachige Literaturkritiker des 20. Jahrhunderts sein, von dem gegenwärtig mehr als nur eine biographische Gesamtdarstellung auf dem Buchmarkt lieferbar ist. Die Frage nach der Verhältnismäßigkeit stellt sich da wohl ebenso wie diejenige nach dem Grund des anhaltenden Interesses, das die Figur Sieburg von Biographenseite auf sich fokussiert. Also: Hat es das wirklich gebraucht? Und wenn ja, warum?
Blickt man auf das bescheidene Presseecho, das das Buch bislang gefunden hat, so ließe sich die erste Frage etwa mit Tilman Krause von der Welt beantworten. Der ausgewiesene Sieburg-Kenner, der selber über den Kritiker gearbeitet hat und 1990 an der FU Berlin mit einer werkbiographischen Studie über „Friedrich Sieburgs Wege und Wandlungen in diesem Jahrhundert“ promoviert wurde,[1] findet zwar durchaus Lobenswertes an Zimmermanns Biographie, diese in toto aber auch recht überflüssig: „Zimmermanns Thesen gehen auch nie über das hinaus, was schon geschrieben wurde. […] Für den Kenner bietet es zu wenig Neues, und für den Sieburg-Novizen ist es viel zu wenig pointiert und appetitanregend.“
Nur einmal vorausgesetzt, man wollte sich diesem (durchaus nachvollziehbaren) Urteil nicht anschließen und stattdessen Zimmermanns Buch als eine wohlgelungene, „elegant und […] einleuchtend argumentierte Biographie“ betrachten, wie dies Lutz Hachmeister in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 10. Oktober getan hat, so ließe sich die zweite Frage nach der Legitimation des neuerlichen biographischen Zugriffs wohl am ehesten noch unter Verweis auf die Zielstellung des Autors beantworten, die in nichts Geringerem besteht, als darin, seinen Protagonisten als „einen der intellektuellen Mitbegründer der Bundesrepublik“ angemessen beleuchten zu wollen. Zimmermann unternimmt mithin den Versuch, Sieburg als exemplarische Referenzfigur für eine Neukartierung des literarischen Feldes nach 1945 dies- und jenseits der scheinbar so dominanten „Gruppe 47“ einzusetzen (was in Hinblick auf die auch in der Literaturwissenschaft längst anzutreffende Einsicht vom denkbar heterogenen Erscheinungsbild jenes Terrains freilich auch nicht mehr allzu originell ist).
Ob Zimmermanns Unterfangen, mit „Blick auf Sieburgs Vermächtnis […] eine neue Vergangenheit“ zu (re)konstruieren (S. 17), geglückt ist oder nicht, mag dahingestellt bleiben. Wenn der Biograph aber einleitend auf jene „kritischen Antipoden“ Sieburgs zu sprechen kommt, „die sich nach 1945 ihrerseits erst als hochbetagte Männer, oft nicht einmal dann der eigenen jugendlichen Verstrickung in das Nazi-Regime haben erinnern wollen“ (S. 16), so legt dieses an den Vergleichsmaßstäben Grass und Jens aufrechnende Bestreben, Gerechtigkeit gegenüber einem politisch alles andere denn unbelasteten Akteur des nachkriegsdeutschen Literaturbetriebs üben zu wollen, immerhin eines nahe: woraus nämlich das anhaltende Interesse, wenn nicht gar die intrikate Faszination an der Person Friedrich Sieburgs für den heutigen Leser noch immer resultieren könnte. Es ist das von Zimmermann auch in den Titel seines Buches aufgenommene provokante Potential, man könnte auch sagen: das Skandalon Sieburg, das sich zu nicht unerheblichen Teilen aus dem Vorwurf seiner Nazi-Kollaboration speist – womit er gleichsam das Negativ zur Biographie eines Marcel Reich-Ranicki liefert: hier wie da ein „Literaturpapst“, der nach 1945 (noch dazu bei derselben Zeitung) erhebliche diskursive Macht aufgebaut und ausgeübt hat; auf der einen Seite aber das jüdische Nazi-Opfer, auf der anderen der zumindest rechtskonservative, zwischen 1933 und 1945 zu vielerlei Zugeständnissen an die Machthaber bereite, bestenfalls distanziert-überlegene Sympathisant. Dass in den Archiven ironischerweise neben der Beitrittsbestätigung in die NSDAP auch ein genau gegenteiliges Dokument existiert, in dem Sieburgs Aufnahme in der Partei abgelehnt wird, scheint ein für die Positionsbestimmung dieses Intellektuellen durchaus bezeichnendes Paradox zu sein, das freilich auch sein Biograph Harro Zimmermann nicht auflösen kann (was die offenkundigen ideologischen Verwicklungen und Wendemanöver seines Protagonisten aber um keinen Deut besser macht).
Jeder Biograph muss sich zwangsläufig zu dieser Phase in Sieburgs Leben und den daraus folgenden Konsequenzen verhalten: verständnisvoll apologetisch, kritisch ergründend oder auch vorsichtig abwägend, wobei sich auf jede der drei bislang vorliegenden Sieburg-Biographien eine der genannten Haltungen verteilen lässt. Cäcilia von Buddenbrock verteidigt und schaut dabei oft genug bewusst nicht so genau hin; Deinet schaut umso genauer und gräbt sich in die Archive mit dem Ergebnis erhellender Ergebnisse (auch über Sieburgs Privatleben); und Zimmermann fasst dann auf Basis derselben Quellen nochmal zusammen, um den Befund gegen alle allzu harschen Kritiker mit einer Art Ehrenrettung festzuschreiben: Lupenreiner Nazi war Sieburg denn nun mal keiner, ein flexibler Mitläufer aber allemal, dabei jedenfalls distinguierter Schöngeist, und zwar einer, der sich nach 1945 durchaus einsichtig in die eigene Verstrickungen, wenn auch nicht allzu offenherzig bekenntnishaft zeigte, um sich stattdessen praktisch wirkend auf den Boden der jungen Demokratie zu stellen und letztere mit kulturkritischer Reflexion zu begleiten. „Indes“, „zumindest“, „freilich“, „aber“, „immerhin“ und „jedoch“ sind bezeichnenderweise ziemlich häufig anzutreffende Vokabeln in Zimmermanns Studie.
Ein großer Wurf – da dürfte man Tilman Krause noch einmal zustimmen – ist das nicht geworden, die klare Linie und der souveräne Zugriff drohen zwischenzeitlich immer wieder abhanden zu kommen, was nicht zuletzt im relativ unvermittelten Beginn und dem ebenso abrupten Ende des Buches ohne ausreichend bilanzierendes Fazit und ohne eine für den Leser nachvollziehbare Beschäftigung mit den bereits reichlich zu Sieburg existierenden Arbeiten anderer Verfasser liegen mag. Diese sind zwar ziemlich vollständig in der angehängten Bibliographie aufgeführt und vom Autor zweifellos kritisch zur Kenntnis genommen worden, vorab spricht Zimmermann aber lediglich pauschal von einem „unübersichtlichen Rezeptionsgelände“ (S. 16), ohne dieses dann auch nur annähernd abzuschreiten oder zu diskutieren. Dies lediglich mit dem „essayistischen“ Stilansatz rechtfertigen zu wollen, mit der der Verlag den Band auf dem Umschlag bewirbt, schiene mir bei einem so opulenten, durchaus mit Quellenzitaten und Endnoten arbeitenden Band eine etwas dünne Begründung zu sein.
Hinzu kommt: Der bundesrepublikanische „Kritikerpapst“ Sieburg selbst bleibt in seinem Profil etwas blass, insofern nämlich, als bei Zimmermann kaum herausgearbeitet wird, was denn nun von der aktuellen deutschsprachigen Gegenwartsliteratur der 1950er und frühen 1960er Jahre tatsächlich seine kritische Zustimmung und positive Förderung gefunden hat (von dem längst zu einem Klassiker bei Lebzeiten aufgestiegenen Thomas Mann, der bekanntlich 1955 gestorben ist, einmal abgesehen). Seine ablehnende Haltung gegenüber der „Gruppe 47“ wird zwar ausführlich betont und zitiert, ebenso die Tatsache, dass Sieburg im einen oder anderen Fall ja denn doch auch ein gutes Haar an Andersch, Böll und Kluge, ja sogar an Arno Schmidt hat finden mögen. Namen wie Stefan Andres oder Frank Thiess fehlen dagegen im Personenregister ebenso wie etwa derjenige des Bestsellerautors Josef Martin Bauer (Soweit die Füße tragen) oder auch derjenige des ehemaligen Luftwaffenoffiziers Gerd Gaiser, den Sieburg seinerzeit mit Nachdruck als große Hoffnung der deutschen Nachkriegsliteratur gelobt und im Verbund mit anderen konservativen Kritikern wie Curt Hohoff oder Günter Blöcker als eine der wichtigsten Gegenfiguren zur „Gruppe 47“ ins Spiel gebracht hat.[2]
Zimmermanns Ignoranz gegenüber solchen literaturpolitischen Strategien verhindert ein wenig die Einsicht, dass die Angriffe der „Siebenundvierziger“ gegen Sieburg eben keineswegs nur als Reaktionenauf die explizit gerittenen Attacken des FAZ-Literaturchefs gegen ihre eigenen Mitglieder, sondern eben auch als gegenläufige Positionierungen einer neuen Avantgardeformation gegen das von Sieburg vertretene und gelobte Autorenfeld – einer nicht immer hell strahlenden Gemengelage aus unterschiedlichsten Repräsentanten der auch schon vor 1945 in Deutschland publizierten Literatur – zu verstehen sind. Auch diese von Sieburg gelobten (und von Zimmermann ausgeblendeten) Gegenwartsautoren von Andres und Thiess einerseits bis Bauer und Gaiser andererseits gehören nämlich auf ganz entscheidende und prägende Weise zum geistigen Klima der bundesrepublikanischen Wirklichkeit um 1950, ohne dass sie mit der selbstzugeschriebenen, in der literaturkritischen Praxis freilich kaum eingelösten Neigung Sieburgs zur „Asphalt-Literatur“ (S. 327) auf einen Nenner hätten gebracht werden können.
Wenn Sieburg etwa in der Zeitschrift Die Gegenwart vom 15.9.1950 die Sprachmächtigkeit von Stefan Andres’ Lyrik lobt, in der der Mensch „wie eine zähe Pflanze“ erscheint, die „ihr Heimweh nach der erdigen Dunkelheit“ behält[3]; oder wenn Gerd Gaiser fünf Jahre später am selben Ort als „ein strenger, ja harter Magier“ charakterisiert wird, „der mit fast hexenhafter Herrschaft über die Zauberformeln der Dichtung begabt ist“[4]; und wenn schließlich an Josef Martin Bauers Erinnerungsbuch über den Zweiten Weltkrieg, in dem eine Expedition deutscher Gebirgsjäger während des Russlandfeldzuges bereits im Titel als Kaukasisches Abenteuer verharmlost wird, vor allem „ein ländlicher Geruch von saurer Milch, frischem Brot und der Ausdünstung arbeitender Leiber“[5] gelobt wird, der über der ganzen Erzählung liege, „und allen menschlichen Vorwitz in den unerbittlichen Gang der Jahreszeiten zurückweist“,[6] so sollten diese beliebig herausgegriffenen, bei Zimmermann freilich nicht zu findenden Beispiele genügen, um aufzuzeigen, wie es um Literaturverständnis und Sprache des „Ästheten“ Friedrich Sieburg beizeiten eben auch bestellt war.
Erhellend dagegen ist das von Zimmermann gelieferte Zitat aus einem Brief Hans Werner Richters an Rudolf Walter Leonhard vom November 1961, in dem der umtriebige Motor der „Gruppe 47“ schreibt:
„Noch ein Wort zu Sieburg. […] Ich habe politisch viel gegen ihn einzuwenden, aber was wären wir ohne ihn. Wir brauchen seine Gegnerschaft, und ich denke, er braucht auch die Gruppe 47 […] und ihre Feind-Freundschaft. Wieviel hat er dazu beigetragen, uns groß zu machen.“
Die Mechanismen und Funktionsweisen des literarischen Feldes sind an diesen Sätzen exemplarisch ablesbar: In einem Geflecht relationaler Beziehungen, in dem sich jede Position (im Sinne Pierre Bourdieus) primär durch Distinktion und Abgrenzungskämpfe definiert, bedürfen die einzelnen Akteure profilierter Gegner, um sich durch deren ablehnende Kritik überhaupt erst in ihrer jeweiligen Eigenart definieren zu können: die nachrückenden ‚Jungen Wilden‘ in ihrer Neuartigkeit ebenso wie die konservativen Großkritiker in ihrer Kompetenz als Bewahrer des Schönen, Guten, Wahren. Ohne Reibungsflächen kein Funkenschlag – Sieburgs Bedeutung für den Literaturbetrieb der Jahre nach 1945 kann in der Tat nicht hoch genug veranschlagt werden.
Damit ist klar: Das literarische Feld lebt vom Showkampf, und das auch schon lange vor Erfindung der Television und aller sich darin austobenden Quartette (in welcher Besetzung diese auch immer auftreten mögen). Zum Habitus des erfolgreichen „Großkritikers“ gehört dementsprechend – wie Marc Reichwein im Anschluss an Christoph Jürgensen festgehalten hat – vor allem eine herausragende Eigenschaft: „In jedem Fall sollte man mit seiner ganzen Existenz eine Angriffsfläche bieten.“ Dass Sieburg die Inszenierung einer solchen Existenz des Anstoßes virtuos beherrscht hat, wird ihm niemand in Abrede stellen wollen. Seinem Aufstieg zum „Literaturpapst“ der prä-Reich-Ranicki-Ära hat dies nicht geschadet, im Gegenteil: es war für seine Realisierung geradezu konstitutiv.
Das Rezept, wie man Großkritiker wird, wäre damit in synchroner Perspektive quasi schon geliefert. Wie es sich damit in diachroner Hinsicht verhält, will heißen: von welchen Faktoren es abhängen mag, nicht nur Großkritiker zu sein, sondern auch noch posthum zu bleiben, ist eine Frage, für die der Fall Sieburg gleichermaßen ein Exempel liefern kann. So groß das Interesse an Sieburgs Person aufgrund des einmal etablierten Mythos vom politisch schillernden „Literaturpapst“ konservativer Observanz nämlich auch sein mag; es hat doch das Interesse an seinen Texten bei weitem überlagert. Für diese Verselbständigung ist die hohe Biographiendichte durchaus symptomatisch – und ein weiteres Charakteristikum, das seine Rezeption mit derjenigen Marcel Reich-Ranickis verbindet.
Gewiss: Dank der engagierten editorischen Bemühungen von Thomas Anz um die Herausgabe von Reich-Ranickis Texten – nach dem Band Meine Geschichte der deutschen Literatur von 2014 ist kürzlich eine weitere Sammlung mit kritischen Essays unter dem Titel Meine deutsche Literatur seit 1945 bei DVA herausgekommen – und angesichts der umfangreichen Backlists mit Reich-Ranicki-Titeln ist es gegenwärtig um dessen literaturkritisches Schaffen nicht schlecht bestellt; die Frage nach der relativen Halbwertszeit des Leserinteresses wird man gleichwohl stellen dürfen. Der abermalige Vergleich mit Sieburg erscheint ernüchternd: Zwar hatte sich noch gut eineinhalb Jahrzehnte nach dessen Tod wiederum die Deutsche Verlagsanstalt um die Herausgabe einer sage und schreibe zehnbändigen Werkausgabe bemüht, deren erste beiden Bände Zur Literatur mit ausgewählten literaturkritischen Essays und Rezensionen kein geringerer als Fritz J. Raddatz betreut hatte; die ambitionierte Edition blieb jedoch schon nach der Neuauflage von Sieburgs Biographien über Napoleon, Robespierre und Chateaubriand stecken, ohne über den siebten Band der geplanten Gesamtfolge hinausgekommen zu sein: Geblieben ist ein Torso, der für sich steht – und heute selbstverständlich längst vergriffen ist.
Letzteres gilt für den Großteil von Sieburgs Schriften: Von seinen literaturkritischen Texten ist gegenwärtig überhaupt nichts mehr lieferbar; einzig die kulturkritischen „Selbstgespräche auf Bundesebene“ unter dem Titel Die Lust am Untergang stehen als bibliophile Liebhaberausgabe für den Kauf durch Sammler der Anderen Bibliothek bereit (so dass angesichts der Fangemeinde dieser Buchreihe weniger Zweifel über den Absatz des Bandes als über dessen tatsächliche Lektüre angebracht sein dürfen). Daneben wartet nur noch der Arche-Verlag mit einer entlegenen Erzählung Der Tod des Dichters auf, die ihre Wiederveröffentlichung primär dem Interesse am behandelten Gegenstand – dem modernen dänischen Klassiker Hermann Bang – verdankt, weshalb sie denn auch in einem Sammelband über Bangs „letzte Reise“ aufgenommen worden ist.
Überhaupt ist Lutz Hachmeisters Befund in der FAZ vom 10. Oktober, dass „substantiell […] von Sieburgs kulturpolitischer Publizistik wenig Brauchbares übrig“ geblieben sei, schwerlich zu widersprechen – nicht nur mit Blick auf das illustrierend angeführte, einstmals hochgelobte Frankreich-Buch von 1929, von dem Harro Zimmermann deutlich genug offenlegt, wie stark es bei allen Liebeserklärungen an die Nachbarnation im zeitgenössischen Schlamm der völkerpsychologischen Stereotype gründelt (vom zeigerecht zur Jahreswende 1932/33 nachgeschobenen Band Es werde Deutschland ganz zu schweigen). Der Rest von Sieburgs Oeuvre steht in Bibliotheken und Antiquariaten zur Sichtung für findige Feinschmecker und verschworene Liebhaber offen, die sich mit Tilman Krause in der Verständigung über die herauszupickenden Rosinen einig sein dürften. Alle anderen lesen bestenfalls die Biographie(n), um es damit dann auch bewenden zu lassen.
Aber machen wir uns nichts vor: Letztlich wird es eben doch die weiter bestehende oder aber eingeschlafene Rezeption der Texte und weniger die auf biographische Details versessene Neugier an der Person sein, die über die Beantwortung der Frage nach der posthumen Präsenz eines Publizisten in den kanonischen Zonen des literarischen Diskurses entscheiden wird – frei nach dem von Lessing formulierten Stoßseufzer aller (vermeintlichen) Klassiker, die davon träumen, „weniger erhoben“ und „fleißiger gelesen“ zu werden. Albrecht Fabri – längst selbst zum Geheimtipp avancierter Kritiker und Essayist von hohen Graden – hat die von ihm aufgeworfene Frage nach der posthumen Mortalitätsrate von Kritikern ebenso realistisch wie nüchtern beantwortet, wenn er feststellte: „Nur selten überlebt ein deutscher Kritiker seinen Tod.“[7] Friedrich Sieburg, soviel ließe sich aus seiner von Lektüreerfahrungen breiterer Leserkreise längst nachhaltig abgekoppelten Existenz als bloßer Gegenstand biographischer Monumente folgern, dürfte in dieser Hinsicht wohl eher unter die ruhelosen Wiedergänger als unter die scheintoten Autoren der deutschen Kritikerzunft gerechnet werden, von denen die letzteren auf eine rettende Wiederbelebung qua Lektüre zumindest noch hoffen dürfen. Insofern hat ein Alfred Kerr vielleicht ja sogar Glück gehabt, wenn er bis heute noch keinen Biographen gefunden hat – Bücher von ihm sind jedenfalls nach wie vor in nennenswerter Zahl im Handel lieferbar geblieben. Und da hilft nun mal nichts: Wer Zugang zu ihrem Verfasser finden will, muss sich zu allererst an dessen Schriften halten.
Michael Pilz, 23.10.2015
Michael.Pilz@uibk.ac.at
[1] So der Untertitel der Buchausgabe von 1993: Mit Frankreich gegen das deutsche Sonderbewußtsein. Die Dissertation selbst trug den Titel Friedrich Sieburg. Ein deutscher Publizist auf der Suche nach nationaler Identität.
[2] Vgl. exemplarisch Friedrich Sieburg: Die Zauberformel. [Rezension zu Gerd Gaiser: Das Schiff im Berg. München 1955]. In: [Ders.]: Zur Literatur 1924–1956. Hrsg. von Fritz J. Raddatz. Stuttgart: DVA, 1981, S. 456–458, wo sich Sieburg unter die größten „Bewunderer“ Gaisers rechnet – eines Autors, der „das Äußerste geleistet“ habe, „dessen die deutsche Sprache heute […] fähig ist.“
[3] Friedrich Sieburg: Tiefbohrung. [Rezension zu Stefan Andres: Der Granatapfel. München 1950]. In: [Ders.]: Zur Literatur 1924–1956. Hrsg. von Fritz J. Raddatz. Stuttgart: DVA, 1981, S. 251–254, hier S. 252, wo es weiter heißt: „Stefan Andres‘ Kunst macht indessen deutlich, daß die lyrische Form ein Bohren in tieferen, wenn auch ungefügeren Schichten gestattet und seelische Zustände ans Licht fördert, die noch schwer mit Erde vermischt sind“
[4] Sieburg: Die Zauberformel (wie Anm. 2), S. 458.
[5] Friedrich Sieburg: Abstieg am Elbrus. [Rezension zu Josef Martin Bauer: Kaukasisches Abenteuer. Esslingen 1950]. In: Die Gegenwart, 15.7.1951, S. 23. Vgl. dazu auch Sieburgs Lob von Bauers So weit die Füße tragen als „sehr eindrucksvolles Buch […], dessen starke, oft überstarke Spannung mit den Mitteln einer natürlichen und gewissenhaften Darstellung erzielt wird.“ (Friedrich Sieburg: Zu viel oder zu wenig. [Rezension zu Josef Martin Bauer: So weit die Füße tragen. München 1955]. In: Die Gegenwart, 22.10.1955, S. 704).
[6] Sieburg: Abstieg am Elbrus (wie Anm. 5), S. 23.
[7] Albrecht Fabri: Der schmutzige Daumen. Gesammelte Schriften. Hrsg. von Ingeborg Fabri und Martin Weinmann. Frankfurt/Main: Zweitausendeins 2000, S. 625.