Kapitel 8 | |
| |
 B. Eigentumsvorbehalt
und Sicherungsübereignung B. Eigentumsvorbehalt
und Sicherungsübereignung |
 D. Die
Lehre vom Rechtsobjekt D. Die
Lehre vom Rechtsobjekt |
| |
C. Gutglaubenserwerb
und Doppelverkauf |
I. Gutgläubiger
Eigentumserwerb | |
1. Der Problemhintergrund
des § 367 ABGB | |
Üblicherweise
wird Eigentum derivativ, dh von einem (berechtigten) Vormann, erworben.
§ 423 ABGB spricht von „Sachen, die schon einen Eigentümer haben”.
So wird zB das Eigentumsrecht einer Käuferin unmittelbar vom Veräußerer
/ Verkäufer, der idR Eigentümer ist, abgeleitet. Dabei gilt – wie
wir schon wissen – der Grundsatz, dass niemand mehr Recht übertragen
kann, als er selbst hat: Nemo plus iuris transferre potest, quam
ipse habet. | Nemo
plus iuris transferre potest, quam ipse habet |
Damit lässt sich das Problem des Gutglaubenserwerbs
(vom Nichteigentümer) aber nicht lösen, denn es gibt Fälle, und
nur diese will § 367 ABGB regeln, dass jemand zB von einem Antiquitäten- oder
Autohändler oder auch einer Privatperson etwas kauft, und zwar im
guten Glauben, dass diese Personen Eigentümer des Kaufgegenstands
oder doch wenigstens darüber verfügungsberechtigt sind, was sich
aber nachträglich als falsch herausstellt. Der Händler verkauft
zB wissentlich gestohlene Ware und ist / wurde daher selbst gar
nicht Eigentümer! Oder eine Privatperson verkauft die ihr anvertraute
Sache, etwa das geliehene Fahrrad. – Kann in so einem Fall zB der
hehlerische Händler dennoch an gutgläubige Kunden Eigentum übertragen?
Und warum soll das so sein? | Typische
Fälle |
2. § 367 ABGB als
Ausnahme von § 366 ABGB | |
Das ABGB behandelt den Gutglaubenserwerb
des § 367 legistisch als Ausnahmefall der unmittelbar vorangehenden
Eigentumsklage des § 366 ABGB. – Es ist also kein Zufall, dass §
367 unmittelbar im Anschluss an die Eigentumsentziehungsklage des
§ 366 ABGB anschliesst. | Ausnahme
von
§ 366 ABGB |
| |
§ 367 ABGB | |
Die Eigentumsklage [gemeint ist zB die eines
Eigentümers, dem die Sache gestohlen wurde!] findet gegen den redlichen
Besitzer einer beweglichen Sache nicht statt, wenn er beweist, dass
.... In diesen Fällen wird von den redlichen Besitzern das Eigentum
erworben, und dem vorigen Eigentümer [dem zB die Sache gestohlen
wurde] steht nur gegen jene, die ihm dafür verantwortlich sind [=
zB den Dieb und seinen Hehler = Antiquitätenhändler], das Recht
der Schadloshaltung zu. | |
| |
 | |
3. Einschneidende
Rechtsfolge: Verkehrsschutz | |
Die Rechtsfolge des § 367 ABGB ist
einschneidend! Der bspw bestohlene (= frühere) Eigentümer verliert
sein Eigentum (zB am gestohlenen Familienbild oder Teppich), wenn
der Erwerber (= Käufer) die gesetzlichen Voraussetzungen, insbesondere
auch die der Gutgläubigkeit erfüllt. – Diese harte Sanktion wird
vom Gesetz nur deshalb angeordnet, weil der Gesetzgeber den rechtsgeschäftlichen
Verkehr auf eine sichere Grundlage stellen wollte; Verkehrs-
und Vertrauensschutz. Man muss sich darauf verlassen
können, dass Eigentum erlangt wird, wenn man zB von einem Kfz-Händler,
also einem befugten „Gewerbsmann”, in gutem Glauben ein Kraftfahrzeug
oder aus einer öffentlichen Versteigerung Gegenstände erwirbt. Die
Erwartungen des Publikums dürfen trotz möglicher „Unregelmäßigkeiten”
nicht enttäuscht werden. – Nur diese wirtschaftlich orientierten rechtlichen
Verkehrsschutzüberlegungen rechtfertigen die harte und – zunächst
vielleicht – ungerecht erscheinende Rechtsfolge des Eigentumsverlustes
des früheren Eigentümers; in unserem Beispiel des Bestohlenen. | Verkehrsschutz
bewirkt ET-Verlust |
Solche Überlegungen können in der Kodifikationsgeschichte
bis zum Codex Theresianus zurückverfolgt werden. | |
Moderne Wirtschaftsordnungen
verlangen von der Rechtsordnung, dass im Interesse von Verkehrssicherheit und Vertrauensschutz stärker
auf äußere Erscheinungsformen von Rechtsverhältnissen Bedacht genommen
wird und nicht so sehr auf innere Zustände oder Vorgänge, die nicht
unmittelbar einsichtig sind. Das wird noch dadurch verstärkt, dass
der Handels- und Wirtschaftsverkehr auf rasche und verlässliche
Geschäftsabwicklung angewiesen ist. Vgl dazu die Begründung in SZ
2/14 (1920): Pferdediebstahl → Entscheidungsbeispiele
| |
4. Gesetzliche
Voraussetzungen | |
Gutgläubiger Erwerb ist aber an bestimmte gesetzliche Voraussetzungen
geknüpft. Nur die vollständige Erfüllung dieser Voraussetzungen
lässt die erwähnte harte Sanktion für den bisherigen Eigentümer
eintreten und den gutgläubigen Erwerber Eigentum auch vom Nichteigentümer erlangen. | |
Das Handelsrecht kennt
in den §§ 366 ff HGB eine vom bürgerlichen Recht etwas abweichende
Regelung des gutgläubigen Erwerbs vom Nichtberechtigten. Eine Vereinheitlichung
steht immer noch aus, sollte aber im Rahmen der Neufassung des HGB
angestrebt werden. | |
§
367 ABGB kennt drei allgemeine und drei besondere Voraussetzungen: | |
Die drei allgemeinen Voraussetzungen müssen kumulativ vorliegen.
Es sind folgende: | Drei „allgemeine“
Voraussetzungen |
| •
Der Erwerber muss redlich,
dh gutgläubig sein, ein Kriterium, das von der Rspr streng geprüft wird!
Vgl dazu die Beispiele in → KAPITEL 3: Redlicher
Besitz. | |
| •
Es muss sich um den Erwerb einer beweglichen (körperlichen) Sache handeln;
für Liegenschaften gilt § 367 ABGB also nicht. | |
| |
| •
Schließlich muss der
Erwerb entgeltlich erfolgt sein; § 367 ABGB: „
... gegen Entgelt.” – Gutgläubiger unentgeltlicher Erwerb (zB Schenkung
einer gestohlenen Sache) wird also nicht geschützt! Hier hat also
der Schutz des Eigentümers Vorrang. | |
 | |
Dazu treten zusätzlich als besondere Voraussetzungen folgende,
wobei hier nur eine von ihnen – alternativ – vorliegen
muss. Entweder: | Alternative
„besondere“
Voraussetzungen |
| •
Erwerb der Sache „in einer öffentlichen
Versteigerung „ (1. Fall); | 1.
Fall |
Der Ersteher von Fahrnis erwirkt Eigentum mit
dem Zuschlag ohne besonderen Übergabsakt durch
das Vollstrekkungsorgan; SZ 26/281 (1953) oder SZ 58/64 (1985).
– Wie ist zu entscheiden, wenn die versteigerte Sache (eine Skulptur
des Pharao Sesostris III) als echt angekündigt wird, sich aber nachträglich
als Fälschung herausstellt? § 367 ABGB regelt nur den gutgläubigen
Eigentumserwerb; andere Rechte, etwa Schadenersatz- oder Gewährleistungsansprüche
bleiben davon unberührt und könnten daher hier zu Wandlung, Preisminderung
oder allenfalls auch Schadenersatzansprüchen führen. Nicht der Erwerbsakt
nach § 367 ABGB ist hier mangelhaft, sondern die Sache selbst. Es
liegt eine Leistungsstörung, kein Mangel in der Wurzel vor → KAPITEL 7: Mängel von Rechtsgeschäften (Folie). | |
| •
oder „von einem zu diesem Verkehre befugten
Gewerbsmann „ (2. Fall), oder | 2.
Fall |
| •
wer
die Sache „ ... von jemandem an sich gebracht hat, dem sie der Kläger
[also der bisherige Eigentümer] selbst zum Gebrauche, zur Verwahrung,
oder in was immer für einer andern Absicht anvertraut hatte”;
sog Vertrauensperson (3. Fall). | 3. Fall |
Anvertraut ist
eine Sache dann, wenn sie sich mit Willen des Eigentümers im (ausschließlichen)
Gewahrsam eines andern befindet; SZ 39/189 (1967). Das gilt selbst
dann, wenn sie dem Eigentümer betrügerisch herausgelockt wurde;
SZ 58/75 (1985) unter ausdrücklicher Ablehnung der vorangehenden
Rspr. Daran zeigt sich, dass der Verkehrsschutz sehr weit reicht!
– Geschützt ist auch der Erwerb vom Vertrauensmann des Vertrauensmanns
oder vom Erben des Vertrauensmanns; Rspr 1936/53. | Anvertraut? |
Schon
das alte deutsche Recht kannte für diesen 3. Fall das Rechtssprichwort:
„Wo Du Deinen Glauben gelassen hast [zB bei einem
untreuen Freund, der das entliehene Fahrrad idF verkauft!], musst
Du ihn suchen „; oder: ”Trau, schau, wem!” –
Der Erwerb von einer Vertrauensperson, also der 3. Fall des § 367
ABGB, gelangte erstmals in Martinis Entwurf (II 3 § 20) ins österreichische
Recht. Die ersten beiden Fälle des § 367 ABGB kennt dagegen schon der
Codex Theresianus und auch das ALR; vgl Wellspacher, Das Vertrauen
auf äußere Tatbestände im bürgerlichen Recht 168 f (1906). Der erste
Fall des § 367 ABGB hat bereits griechische Wurzeln. – Vgl auch
den Hinweis in § 1088 Satz 2 ABGB (Trödelvertrag / Verkaufsauftrag):
„In keinem Fall kann die zum Verkaufe anvertraute Sache dem Dritten,
welcher sie von dem Übernehmer redlicher Weise an sich gebracht
hat, abgefordert werden (§ 367 ABGB).” | Rechtssprichworte |
 | |
 | |
5. Entscheidungsbeispiele | |

|
SZ
20/182 (1938): Dauerwellenapparat –
§§ 367, 368 ABGB. – Der gutgläubige Erwerb wird durch Umstände ausgeschlossen,
die den begründeten Verdacht entstehen lassen, dass der Verkäufer
nicht Eigentümer der Sache ist, sondern selbst [zB] nur Vorbehaltskäufer
[Eigentumsvorbehalt]. – Die Versicherung des Verkäufers allein,
dass er über die Sache verfügen kann, kann guten Glauben des Erwerbers
nicht begründen. | |
Kläger = Verkäufer eines Dauerwellenapparats; | |
Beklagter = Vermieter des Friseurs. | |
Die Klägerin hatte dem im Hause des Beklagten wohnenden
Friseur gegen Ratenzahlungen einen Dauerwellenapparat unter Eigentumsvorbehalt
verkauft. Obwohl der Friseur nur einen geringen Teil des Kaufpreises
bezahlt hatte, überließ er dem Beklagten, dem er seit längerer Zeit
den (Miet)Zins schuldig war, den Apparat auf Abschlag der Zinsschuld.
Er ist deswegen strafrechtlich verurteilt worden. – Die Klägerin verlangte
vom Beklagten die Herausgabe des ihr gehörigen Apparats. Zu Recht?
Versuchen Sie die dazu nötigen Argumente zu sammeln. Welcher Fall
des § 367 ABGB ist hier zu prüfen? | |
|
|
|
JBl 1988, 313: Vorführwagen „Alfa
Romeo „; Kläger = Autokäufer (ohne Kontrolle des Typenscheins); Beklagter
= Autohändler. Wer beim Kauf eines Gebrauchtwagens nicht in den
Typenschein Einsicht nimmt, kann das Auto mangels Redlichkeit in
aller Regel nicht gutgläubig erwerben. – Der Käufer eines Neu- oder
auch Vorführwagens, der den Kaufpreis sogleich bezahlt, darf jedoch
uU vom Eigentum des Verkäufers auch ausgehen, wenn er sich den Typenschein
nicht vorlegen ließ. | |
Nach stRsp ist es Sache des Käufers eines Kraftwagens, sich
durch Einsichtnahme in den Kraftfahrzeugbrief / Typenschein von
der Rechtmäßigkeit des Besitzes seines Vorgängers zu überzeugen
( ...). An die Erkundigungspflicht des Käufers sind besonders strenge
Anforderungen dann zu stellen, wenn es sich um einen Gebrauchtwagen
handelt, weil hier Diebstähle besonders häufig vorkommen ( ...).
Immer aber ist im Einzelfall zu prüfen, ob die nach den besonderen
Umständen erforderliche Sorgfalt verletzt wurde ( ...). Auch bei
Anwendung eines strengen Maßstabs kann deshalb die Gutgläubigkeit
des Käufers eines fabriksneuen Fahrzeuges, der einem autorisierten
Händler den Kaufpreis bar bezahlt hat – auch wenn für einen Teil
des Kaufpreises ein gebrauchter PKW des Käufers an Zahlungs statt
gegeben wird – nicht allein aus dem Grunde verneint werden, weil
er sich den Typenschein nicht vorweisen ließ. Dies gilt auch für
einen vom Kraftfahrzeughändler benützten Vorführwagen. Denn bei
einem Vorführwagen handelt es sich nicht um den Gebrauchtwagen eines
Dritten, so dass bei dessen Erwerb die Rechtsgrundsätze für den
Kauf eines Neuwagens anzuwenden sind. | |
|
|
|
SZ 2/14 (1920): Pferdediebstahl –
Wer ist befugter Gewerbsmann iSd § 367 ABGB? | |
Kläger = Bestohlener Pferdeeigentümer; Beklagter = Großgrundbesitzer,
dessen Verwalter ein gestohlenes Pferd des Klägers gekauft hat. | |
Dem Kläger, einem burgenländischen Wirtschaftsbesitzer,
wurden in der Nacht vom 15. zum 16. Oktober 1918 zwei Pferde aus
dem Stall gestohlen. Am Abend des 17. und in der Früh des 18. Oktobers
1919 hatte ein bekannter Mann eines dieser Pferde dem Verwalter
des Beklagten M, eines in einer nö Gemeinde begüterten Großgrundbesitzers,
zum Kaufe angeboten und überlassen. Der Verwalter hatte diesem Mann
dafür einen Rapphengst im Werte von 5000 Kronen und einen Barbetrag
von 4500 Kronen übergeben. Dem Kläger war es nach wochenlangen Nachforschungen
gelungen, den Dieb zu verfolgen und das Pferd im Stalle des Großgrundbesitzers
zu agnoszieren. Der Verwalter war anfangs geneigt, weigerte sich
aber später, das Pferd herauszugeben. – Der Kläger begehrte mit
der Klage von M. die Ausfolgung des Pferdes oder Zahlung des Betrags
von 15.000 Kronen. – Alle 3 Instanzen gaben der Klage statt. | |
|
|
|
RdW 1985/11:
Herauslocken von Perserteppichen – Gutglaubenserwerb an
listig entlockten Sachen? Dem Eigentümer betrügerisch entlockte
Sachen sind anvertraut iSd § 367 ABGB und können daher von Dritten
gutgläubig erworben werden. – Der gute Glaube wird aber schon durch
leicht fahrlässige Unkenntnis der wahren Umstände ausgeschlossen. | |
Kläger = Teppichhändler; Beklagter = Teppichkäufer. | |
H.K. verleitete einen Angestellten des Klägers zur Ausfolgung
von Perserteppichen, indem er vorgab, er wolle sie zu Hause zur
Probe auflegen. Tatsächlich verkaufte er sie dem Beklagten zu einem
günstigen Preis. Der Kläger verlangt vom Beklagten die Herausgabe
der Teppiche. – Hier findet nicht der 2., sondern der 3. Fall des
§ 367 ABGB Anwendung. | |
|
|
|
EvBl 1999/168: Wirkung des gutgläubigen
Erwerbs bei Weiterveräußerung und Rückerwerb durch den Veräußerer.
– Der gutgläubige Erwerber verschafft durch die Übertragung der
Sache (Motorjacht) jedem Dritten Eigentum, auch
wenn diesem der Mangel im Erwerbsakt des Vormanns bekannt ist. Dies
gilt grundsätzlich auch dann, wenn die Sache an den schlechtgläubigen
Veräußerer selbst zurückgelangt; hier durch ein Finanzierungsleasing
in Form eines Sale-and-lease-back-Geschäfts. (?) | |
|
II. Der
sog Doppelverkauf | |
 | |
| |
Immer wieder stellt sich
– oft im praktischen Zusammenhang mit § 367 ABGB (der aber auf den Erwerb
beweglicher Sachen beschränkt ist!) – auch die Frage des Doppelverkaufs.
Das ABGB regelt ihn getrennt für bewegliche (§ 430 ABGB) und unbewegliche
Sachen (§ 440 ABGB). | |
Es
handelt sich bei der Regelung des Doppelverkaufs auch um eine frühe
Antwort des Gesetzgebers auf die Verletzung fremder Forderungsrechte,
die auch die Rspr früh für schutzwürdig ansah; dazu Gschnitzer,
AllgT 717 ff (1992 2) und → KAPITEL 11: Verletzung
fremder Forderungsrechte:
Sittenwidrigkeit. | Verletzung fremder Forderungsrechte |
Man darf nicht meinen, Doppelverkäufe von
Liegenschaften kämen nicht vor. In Wahrheit sind sie nicht selten. | |
Sehen wir uns das häufige
Zusammenspiel von § 367 und bspw § 430 ABGB anhand eines Beispiels
an. | Zusammenspiel
von § 367 und bspw § 430 ABGB |
Schulfall: Frau A kauft bei einem Antiquitätenhändler
einen schönen alten Kelim (2 x 3 m), bezahlt auch gleich, ersucht
jedoch darum, den Teppich erst einige Tage später abholen zu können,
weil er ihr zum Tragen zu schwer sei und sie derzeit über kein Fahrzeug
verfüge. – Als Frau A zwei Tage später den Teppich abholen will,
tritt der Verkäufer verlegen von einem Fuß auf den anderen und teilt
Frau A schließlich mit, dass er den Kelim mittlerweile an eine andere
Kundschaft für ihn günstiger (zB um 250 ı teurer!) verkauft habe.
– Was kann Frau A tun? | |
Wie würden Sie entscheiden? | |
| • Ist Frau A bereits
Eigentümerin geworden? Wenn ja – wodurch? | |
| • Welche Nebenpflicht des Kaufvertrags hat der
Verkäufer verletzt? | |
| • Erwirbt der Zweitkäufer (K2) Eigentum am Kelim?
Wenn ja – wie? | |
| • Kann Frau A, wenn sie zufällig einige Tage
nach der bösen Überraschung in der Auslage eines anderen Teppichhändlers
einen ähnlichen Teppich sieht, der aber ebenfalls um 250 ı teurer
ist, als der von ihr gekaufte, diesen Mehrpreis, der dem höheren
Zweitverkäuferpreis ihres treulosen Verkäufers entspricht, verlangen
oder erhält sie nur ihren Kaufpreis zurück? – Anders gefragt: Stehen
Frau A auch Schadenersatzansprüche zu? | |
Hat der
Verkäufer (Schuldner) durch einen Doppelverkauf die Erfüllung der
geschuldeten Leistung vereitelt / unmöglich gemacht, hat er den
höheren Erlös dem Käufer als (Schaden)Ersatz herauszugeben. Am Vorliegen
von Verschulden ist idR nicht zu rütteln. Der Verkäufer wird als
unechter Geschäftsführer ( → KAPITEL 12: Unerlaubte
oder unechte GoA: § 1040 ABGB)
behandelt; § 1040 ABGB. Der Mehrerlös wird als sog stellvertretendes
Commodum bezeichnet, das auch in anderen Konstellationen von Bedeutung ist.
Diese Rechtsfigur wird ua auf § 7 ABGB gestützt. – Wir haben es
in unserem Beispiel mit einer verschuldeten nachträglichen Unmöglichkeit
iSd § 920 ABGB zu tun → KAPITEL 7: Nachträgliche
Unmöglichkeit. Zusätzlich
kommt neben § 430, der die Rechtsfolge offen lässt – wie erwähnt
– § 1040 ABGB zur Anwendung. | Stellvertretendes
Commodum |
 | |
Für
den Eigentumserwerb beim Doppelverkauf entscheidet in beiden Fällen
nicht die Priorität des schuldrechtlichen Titels (= erster Kaufvertrag),
sondern die des sachenrechtlichen Modus: Bei § 430 ABGB (beweglichen
Sachen) die frühere Übergabe; bei Liegenschaften (§ 440 ABGB) kommt es
auf das frühere Ansuchen um Grundbuchseintragung an → KAPITEL 2: Arten
bücherlicher Eintragungen.
– Der, dem die Sache zuerst übergeben oder der zuerst um Verbücherung
angesucht hat, erwirbt gültiges Eigentum. Selbst bei Kenntnis des
ersten Verkaufs! „Kenntnis” meint aber nicht „Verleitung zum Vertragsbruch”.
Dazu → Doppelverkäufe
von Liegenschaften Der Doppelverkäufer haftet allerdings dem
verletzten Teil für die – idR schuldhafte – Nichterfüllung. | Eigentumserwerb
beim Doppelverkauf |
2. Doppelverkäufe
von Liegenschaften | |
Auch Doppelverkäufe von
Liegenschaften (§ 440 ABGB) kommen immer wieder vor: Der Erstkäufer,
dem die Liegenschaft nicht physisch außerbücherlich übergeben wurde,
kann vom Verkäufer nur Schadenersatz wegen Nichterfüllung begehren,
selbst wenn der Zweitkäufer vom ersten Kauf Kenntnis hatte; SpR
59 (1873). | |
Nur
bei Verleitung zum Vertragsbruch durch den Zweitkäufer
und bei arglistigem Zusammenwirken von Verkäufer
und Zweitkäufer kann der Erstkäufer unter Heranziehung von § 1295
iVm § 1323 ABGB die ihm verkaufte, aber nicht übereignete Liegenschaft
als Naturalersatz herausverlangen; JBl 1981, 535. | Verleitung zum
Vertragsbruch |
Vgl dazu die Ausführungen (E 22 und E 23 zu §
431 ABGB) in Dittrich / Tades, MGA ABGB35 (1999).
Das folgende Zitat soll auch einen ersten Eindruck über die Darstellungsweise
einschlägiger Probleme in diesem wichtigen Nachschlagwerk vermitteln,
wobei hier auf die Kursivsetzungen im Original verzichtet wurde. | |
 | |
 | |
 | |
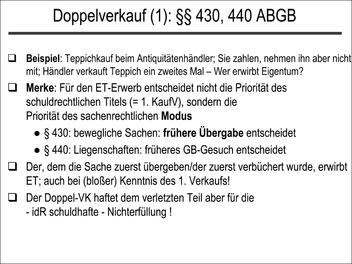 | Abbildung 8.38: Doppelverkauf (1) |
|
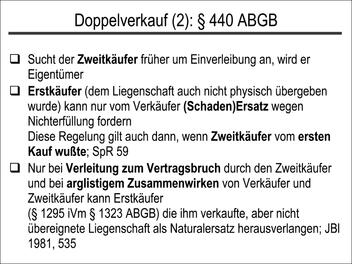 | Abbildung 8.39: Doppelverkauf (2) |
|
III. Gutgläubiger
Pfandrechtserwerb | |
1. Gutgläubiger
Pfandrechtserwerb | |
§ 367
ABGB regelt den gutgläubigen Eigentumserwerb und bindet diesen –
der „harten” Konsequenzen wegen – an strenge Voraussetzungen. –
Gibt es auch einen gutgläubigen Pfandrechtserwerb vom Nichtberechtigten?
– Ja! Die Begründung enthält § 456 ABGB. | |
| |
§ 456 ABGB | |
Wird eine fremde bewegliche Sache ohne Einwilligung
des Eigentümers verpfändet, so hat dieser idR zwar das Recht, sie
zurückzufordern; aber in solchen Fällen, in welchen die Eigentumsklage
gegen einen redlichen Besitzer nicht statt hat (§ 367 ABGB), ist
er verbunden, entweder den redlichen Pfandinhaber schadlos zu halten,
oder das Pfand fahren zu lassen, und sich mit dem Ersatzrecht gegen
den Verpfänder zu begnügen. | |
| |
2. § 456 hat §
367 ABGB zum Vorbild | |
§ 456 ABGB
folgt tatbestandlich dem Vorbild des § 367 ABGB und ermöglicht ebenfalls
einen gutgläubigen Pfandrechtserwerb an beweglichen (!) Sachen:
zB bei Verpfändung einer fremden Sache. – Die Hypothek führt ein
reines Buchleben und existiert außerhalb des Grundbuchs nicht. | |
 | |
3. Rechtsfolge
des § 456 ABGB | |
Bleiben wir bei unserem
Beispiel: C erwirbt gutgläubig Pfandrecht, nicht Eigentum! Das Eigentum (des
A) wird durch das gutgläubig entstehende Pfandrecht zwar belastet,
geht aber nicht verloren! – Was könnte aber die Folge sein, wenn
A sein Fahrrad wieder haben will? | |
| |
Zum gutgläubigen
Pfandrechtserwerb im Handelsrecht vgl § 366 HGB. Hier genügt guter
Glaube des Pfandgläubigers auf die rechtliche Verfügungsbefugnis
( Eigentum) des Pfandbestellers. – Das Handelsrecht verlangt für
den Verlust der Gutgläubigkeit auch grobe Fahrlässigkeit! | |
| |
§ 366 Abs 1 HGB | |
Veräußert oder verpfändet ein Kaufmann im Betriebe
seines Handelsgewerbes eine bewegliche Sache, so wird das Eigentum
oder Pfandrecht auch dann erworben, wenn die Sache nicht dem Veräußerer
oder Verpfänder gehört, es sei denn, dass der Erwerber beim Erwerb
nicht in gutem Glauben ist. Der Erwerber ist nicht in gutem Glauben,
wenn ihm bekannt oder infolge grober Fahrlässigkeit
unbekannt ist, dass die Sache dem Veräußerer oder Verpfänder
nicht gehört oder dass der Veräußerer oder der Verpfänder nicht befugt
ist, über die Sache für den Eigentümer zu verfügen. | |
| |
5. Zusammenhang
mit dem Eigentumsvorbehalt | |
Die Regeln des gutgläubigen
Pfandrechtserwerbs spielen im Zusammenhang mit dem Eigentumsvorbehalt
eine praktisch wichtige Rolle. – Lässt sich jemand Sachen verpfänden
(sei es ein Kaufmann oder ein Privater), die üblicherweise unter
Eigentumsvorbehalt verkauft werden und zieht der Pfandgläubiger
keine Erkundigungen ein (zB Urkundeneinsicht, Rechnungen, Belege, Erkundigung
beim Verkäufer), ob der Verpfändende auch tatsächlich Eigentümer
(oder nach Handelsrecht wenigstens verfügungsberechtigt) ist, handelt
er (grob) fahrlässig und erwirbt nicht gutgläubig Pfandrecht iSd
§§ 456 ABGB oder 366 HGB. „Es wird also [von der Rspr!] geradezu
eine Nachforschungspflicht statuiert.” – H. Mayrhofer, Zur neueren
Entwicklung der Kreditsicherung durch Fahrnis (1968). | |
| |

|
SZ
23/379 (1950): Verpfändung einer unter
Eigentumsvorbehalt gekauften Fräsmaschine – Leitsatz:
Wer an einer Maschine ein Pfandrecht erwirbt, ohne sich zu vergewissern,
dass der Verpfänder auch tatsächlich der Eigentümer ist, handelt
grob fahrlässig iSd § 366 HGB. Käufer der Fräsmaschine = Verpfänder;
Kläger = Verkäufer der Fräsmaschine; Beklagter = Pfandgläubiger
(dem die Maschine als Pfand übergeben wurde). Sachverhalt: Dr. H
hat die Fräsmaschine, deren Herausgabe die klagende Partei von der
beklagten Partei verlangt, von der klagenden Partei unter Eigentumsvorbehalt
gekauft und sie der beklagten Partei verpfändet. | |
|
|
|
EvBl 1965/123: Außenbordmotor –
Leitsatz: § 456 ABGB (§§ 368, 1063 ABGB; § 366 HGB): Grobe Fahrlässigkeit
des Pfandgläubigers beim Pfandrechtserwerb an Waren, die erfahrungsgemäß
unter Eigentumsvorbehalt verkauft werden. Kläger = Verkäufer des
Außenbordmotors (unter Eigentumsvorbehalt); Beklagter = Pfandgläubiger
des Käufer Adalbert K. Sachverhalt: Kläger verkaufte dem Elektrohändler Adalbert
K einen Außenbordmotor mit Tank und Standardpropeller, komplett,
samt Fernschaltung um 47.565,- S unter Eigentumsvorbehalt. Die Klägerin
lieferte den Motor am 12. Juli 1962. Der Beklagte gewährte dem Adalbert
K ein Darlehen von 100.00,- S gegen das Versprechen, ein Motorboot
samt dem hiefür anzuschaffenden Außenbordmotor als Pfand zur Sicherung
der Darlehensforderung übergeben zu erhalten. Adalbert K übergab
ungefähr 1 Monat nach Empfang des Darlehens nach Einbau des Motors
in das Boot dieses samt Motor dem Beklagten mit der Erklärung, er
sei Eigentümer des Bootes. Der Beklagte kannte die finanziellen
Verhältnisse des Adalbert K nicht und wusste nur, dass dieser ein
Haus und ein großes Geschäft besaß. Die Klägerin begehrte nunmehr
mit der Behauptung, der Beklagte sei beim Pfandrechtserwerb schlechtgläubig
gewesen, die Herausgabe des Außenbordmotors. | |
|
|
|
Ähnlich HS 4264/21 (1963): Ananasdosen –
Grob fahrlässig (§ 366 HGB!) handelt, wer den von Anfang an gegebenen
Verdacht eines Eigentumsvorbehalts nicht aufklärt. Die Behauptung
des Verpfänders allein, dass er über die Sache verfügen könne, kann
den guten Glauben des Erwerbers nicht begründen. Bei der Häufigkeit
des Eigentumsvorbehalts besteht eine Pflicht zur sorgfältigen Nachforschung.
Kläger = Verkäufer und Lieferantin der Ananasdosen (die unter Eigentumsvorbehalt
geliefert wurden); Josef H = Käufer der Ananasdosen und Pfandbesteller
+ Verpfänder. Beklagter = Speditionsgesellschaft, die an der bei ihr
eingelagerten Ware ein gesetzliches und ein vertragliches Pfandrecht
behauptete und deshalb die Herausgabe der Ware an den Masseverwalter
verweigerte; über das Vermögen des Josef H war nämlich der Konkurs
eröffnet worden. – Der Klage wurde statt gegeben. | |
|
| |
 B. Eigentumsvorbehalt
und Sicherungsübereignung B. Eigentumsvorbehalt
und Sicherungsübereignung |
 D. Die
Lehre vom Rechtsobjekt D. Die
Lehre vom Rechtsobjekt |
| |

