Kapitel 13 | |
| |
 Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis |
 B. Die Zeit im
Privatrecht B. Die Zeit im
Privatrecht |
| |
A. Stellvertretung
und Vollmacht |
§§ 1002 ff ABGB; §§ 48 ff HGB; HVertrG 1993;
MaklerG 1996. | |
 | |
I. Was ist Stellvertretung? | |
Ein (echter) Stellvertreter gibt in (nicht
unter!) fremdem Namen rechtsgeschäftliche Erklärungen ab (aktive)
oder empfängt sie (passive Stellvertretung), wobei
die Rechtswirkungen dieses Handelns unmittelbar beim Vertretenen
eintreten. – Der Weg dieses uns heute selbstverständlich erscheinenden
Rechtsinstituts der direkten Stellvertretung war
aber lange und steinig, mögen ihm die großen Völker der Antike (vor
allem die Griechen, weniger die Römer) auch schon nahe gekommen
sein. Allein die rechtlichen Errungenschaften der Griechen gingen
wieder verloren, die Römer übernahmen sie nicht. | Langer
Entwicklungsweg |
1. Allgemeines
– Historische Entwicklung | |
Grundsätzlich kann man nur für sich selbst rechtsverbindlich
handeln. Das ist vor allem für den Bereich der Verpflichtungen von
Bedeutung. Wo käme man hin, wollte man es zulassen, dass andere
einen verpflichten können. – Das Rechtsinstitut der Stellvertretung
regelt, unter welchen Voraussetzungen – ausnahmsweise – ein rechtswirksames
Handeln für andere gestattet ist. | |
| |
Der tatsächliche
Grund, der nach Stellvertretung verlangt, kann sehr verschieden
sein: Krankheit, Urlaub, sonstige Verhinderung, Überlastung, aber
auch fehlende (Fach)Kenntnisse oder einfach bessere und effizientere
Geschäftsorganisation. Daher Vollmacht an Verwandte, Freunde, Angestellte,
Anwälte, Steuerberater etc. Moderne Unternehmungen können meist
nicht mehr „allein” geführt werden, sondern brauchen Hilfspersonen,
die für das Unternehmen handeln können; entweder für den gesamten
Unternehmensbereich oder doch einen Teil. | Grund der Stellvertretung |
| |
 | Abbildung 13.1: Direkte oder offene Stellvertretung |
|
Das moderne
Rechtsinstitut der direkten Stellvertretung ist
noch jung. Lange Zeit behalf man sich mit der umständlicheren Form
indirekter / unechter / mittelbarer oder verdeckter Stellvertretung → Die
indirekte Stellvertretung Erst
im 19. Jhd wird im Privatrecht endgültig das Recht der modernen
direkten Stellvertretung etabliert und dabei streng zwischen: | Direkte Stellvertretung |
| • jenem zwischen Machtgeber und Machthaber (sog Innenverhältnis)
und | |
| • dem (Rechts)Verhältnis zwischen Machthaber /
Stellvertreter und Drittem (sog Außenverhältnis)
unterschieden. | |
Dazu kommt, dass im Rahmen
dieser Entwicklung auch das rechtsgeschäftliche Instrument zur Erteilung
von Vertretungsmacht, die Vollmacht, von der häufig
ebenfalls bestehenden vertraglichen Beziehung zwischen Machtgeber
und Machthaber (Dienstvertrag oder Auftrag → KAPITEL 12: Abgrenzungen)
klar unterschieden wird. Die Vollmacht(erteilung) ist
nämlich kein Vertrag, sondern nur ein einseitiges Rechtsgeschäft
→ KAPITEL 5: Einteilung
nach ihrer Entstehung. | Vollmacht |
Von
dieser inneren Verbindung von (bereits bestehender oder doch gleichzeitig
begründeter) vertraglicher Beziehung zwischen Machtgeber und Machthaber
und zusätzlich erteilter Vollmacht geht auch – als praktisch häufiger
Fall (!) – das ABGB aus. Es versieht die §§ 1002 ff ABGB mit der
Marginalrubrik: „ Bevollmächtigungsvertrag „, trennt
also noch nicht klar zwischen dem der Erteilung von Vertretungsmacht
dienenden einseitigen Rechtsgeschäft, der „ Vollmacht „
und der (allenfalls) parallel dazu bestehenden vertraglichen Beziehung
„ Auftrag „. Vgl aber die Bemerkung zu § 1017 ABGB → Parteien
und Rechtsfolgen direkter Stellvertretung
| Bevollmächtigungsvertrag |
Auch
das Preußische Landrecht / ALR, dem das ABGB folgt, kennt die Unterscheidung
zwischen Vollmacht und Auftrag noch nicht. | |
2. Die
indirekte Stellvertretung | |
Im eigenen Namen Der indirekte(mittelbare,
unechte oder verdeckte) Stellvertreter handelt nicht in fremdem
(wie der direkte), sondern im eigenen Namen. Das
heisst: Es erfolgt auch keine Offenlegung der im
Innenverhältnis erteilten Ermächtigung. | Im
eigenen Namen |
Ermächtigung meint
im Privatrecht eine (einseitige) Erklärung, dass der Erklärende
das künftige Verhalten eines andern – hier des indirekten Stellvertreters
– gegen sich gelten lassen will. | |
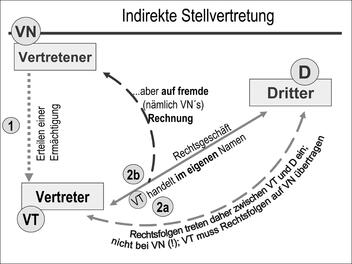 | Abbildung 13.2: Indirekte Stellvertretung |
|
Der indirekte Stellvertreter handelt
aber – wie der direkte – auf fremde Rechnung, nämlich
die des eigentlichen, wenn auch verdeckten Geschäftsherrn. – Die Rechtsfolgen aus
dem zwischen ihm und dem Dritten geschlossenen Geschäft treffen
aber – anders als bei der direkten Stellvertretung – zunächst den
indirekten Stellvertreter selbst. Dieser wird zB aus dem (auf Rechnung
des „Vertretenen”) abgeschlossenen Kaufvertrag selbst berechtigt
und verpflichtet; § 1017 Satz 3 ABGB. | Auf
fremde Rechnung |
Der indirekte
Stellvertreter muss daher die formal von ihm selbst erworbene Rechtsposition
in einem eigenen, neuerlichen Rechtsgeschäft / Vertrag auf den „Vertretenen”
übertragen; Übertragungsgeschäft. – Das ist umständlich,
unsicher und uU teuer. Daher wurde nach einem Ausweg gesucht und
in der direktenStellvertretung gefunden. | Übertragungsgeschäft |
Ein gesetzliches Beispiel einer indirekten
Stellvertretung enthalten die §§ 383 ff HGB; Kommissionsgeschäft.
Auch der sog Strohmann ist (bloß) mittelbarer Stellvertreter. | Kommissionsgeschäft
und Strohmann |
Das Kommissionsgeschäft und
damit die indirekte Stellvertretung spielen heute noch eine Rolle
im Rahmen der Wertpapierkommission der Banken,
aber auch im Rahmen der Rechtsbeziehung zwischen Verlagen und
dem Buch- und Zeitschriftenhandel sowie
bei Second Hand-Läden. Die problematische Zeitschriftenvielfalt
in Kiosken und Tankstellen wäre ohne dieses Rechtsinstitut undenkbar.
– Das Komissionsgeschäft dient auch der Verlagerung des Verkaufsrisikos;
zB vom Buchhändler oder Zeitschriftenverkäufer auf den Verleger. | |
Der Rechtsfigur
des Strohmanns bedient sich die Rechtspraxis in legaler
und illegaler Absicht. – Legal ist es, dass eine Person bspw ein
Grundstück erwirbt, dabei aber nicht an die Öffentlichkeit treten
will. Die Rechtsfigur wird immer wieder zu unerlaubter Umgehung → KAPITEL 11: Die
(Gesetzes)Umgehung.
– etwa im Rahmen des (Ausländer)Grundverkehrs – benützt. | |
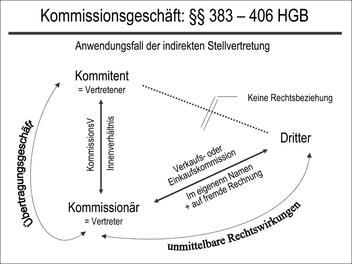 | Abbildung 13.3: Kommissionsgeschäft: §§ 383 – 406 HGB |
|
3. Direkte
Stellvertretung: Anwendungsbereich | |
Bei der direkten Stellvertretung wird dem Vertreter Vertretungsmacht
– dh rechtliches Handeln-Können, nicht Handeln-Müssen,
für andere, hier den Vertretenen – verliehen. – Diese Vertretungsmacht betrifft
das Außenverhältnis, also das rechtliche Verhältnis des Stellvertreters
zu Dritten. Nach der Terminologie des ABGB erteilt der Machtgeber
dem Machthaber Vertretungsmacht. | |
| Begründung von
Vertretungsmacht |
| • durch Rechtsgeschäft:
nur dann heißt sie Vollmacht; | |
| • durch Statuten oder den Gesellschaftsvertrag; | |
| • durch Gesetz (zB Eltern als
gesetzliche Vertreter der Kinder): dann heißt sie gesetzliche Vertretung; | |
| • oder durch den Richter: zB
Sachwalterbestellung oder Bestellung eines Patientenanwalts nach dem
UbG. | |
Die statutarische Begründung
von Vertretungsmacht ist ein Unterfall der rechtsgeschäftlichen,
die richterliche ein Unterfall der gesetzlichen. | |
Die Rechtsordnung gestattet ein rechtlich wirksames
Handeln für andere (insbesondere das Bewirken von Verpflichtungen
für andere) – gleichsam präventiv – nur unter ganz bestimmten Kautelen
/ Voraussetzungen ( → Voraussetzungen
moderner Stellvertretung): | Voraussetzungen
wirksamer
Stellvertretung |
| • Das Vorliegen von Vertretungsmacht;
zB Vollmachterteilung. Dabei muss die Vertretungsmacht stets von
dem stammen, der vertreten werden soll; Selbstverpflichtung. | |
| •
Das Handeln in fremdem Namen muss
für den Dritten auch erkennbar sein; der Vertreter muss sich daher
als solcher zu erkennen geben. – Die Vertretungsmacht muss, soll
es sich um gültige direkte Stellvertretung handeln, offengelegt
werden; Offenlegungsgrundsatz. | |

|
JBl 2000, 170 (Blutspender
wird mit Hepatitis C infiziert): Nach allgemeinen Regeln
(§ 863 ABGB) und dem Grundsatz, dass mangels Offenlegung eines Vertretungsverhältnisses
jeder im eigenen Namen handelt, wird derjenige, der sich in eine
Arztordination oder in ein ärztliches Labor oder in ein sonstiges medizinisches
Institut begibt, mit dem freiberuflich tätigen Arzt oder mit dem
Inhaber des Instituts oder Labors kontrahieren. | |
|
Das moderne Wirtschaftsleben
ist der Hauptanwendungsbereich von direkter Stellvertretung und Vollmacht.
Modernes Wirtschaften, insbesondere das großer Unternehmungen, ist
ohne das Rechtsinstitut der direkten Stellvertretung undenkbar.
Das Handelsrecht hat daher eigene Stellvertretungsformen
und kaufmännische Hilfspersonen entwickelt und gesetzlich näher
geregelt. Sie bauen – wie das Handelsrecht insgesamt – auf dem bürgerlichen
Recht auf. | Handelsrecht
hat eigene Vertretungsformen
entwickelt |
Im kaufmännischen Bereich sind
dies unselbständige (die beiden erstgenannten) und selbständige Hilfspersonen: | Kaufmännische
Hilfspersonen |
| •
Prokura (§§
48 ff HGB) → Vollmachtsarten
| |
| •
Handlungsvollmacht (§§ 54 ff
HGB) an Betriebsangehörige / Angestellte → Handelsrechtliche
Vollmachten
| |
| •
Handelsvertreter
(im
Anschluss), und | |
| • (Handels)Makler
→ KAPITEL 12: Makler. | |
Handelsvertreter
ist nach § 1 Abs 1 HVertrG: | Der Handelsvertreter |
Rechtsquelle: HVertrG 1993, BGBl 88 | |
| • „ ... wer von
einem anderen... [= Unternehmer] | |
| • mit der Vermittlung [= Vermittlungsvertrag]
oder dem Abschluss [= Abschlussvertrag] von Geschäften,
... | |
| •
in dessen Namen und für
dessen Rechnung
| |
| •
ständig betraut ist und | |
| • diese Tätigkeit selbständig und gewerbsmäßig ausübt.” | |
Der
Handelsvertreter ist Kaufmann nach § 1 Abs 2 Z
7 HGB. Bedeutsam ist der konkret geschlossene Vertrag, der daher
sorgfältiger Ausarbeitung bedarf; Kautelarjurisprudenz. Eine Ausnahme
bilden die Liegenschaftsgeschäfte; § 1 Abs 1 HVertrG. Handelsvertreter
können auch zu mehreren Geschäftsherrn in ständiger
Geschäftsbeziehung stehen. Das Entgelt von Handelsvertretern heißt Provision. | Kaufmann |
| •
§ 3 HVertrG regelt die Befugnisse
des Handelsvertreters; zB Annahme von Zahlungen | Weitere
Regelungen des HVertrG |
| • § 3 Abs 3: „Ist der Handelsvertreter als Reisender tätig,
so gilt er als ermächtigt, den Kaufpreis aus den von ihm geschlossenen
Verkäufen einzuziehen [Inkasso ] oder dafür Zahlungsfristen zu
bewilligen.” | |
| •
§
3 Abs 4: Möglichkeit der Abgabe der Mängelrüge gegenüber
dem Handelsvertreter; | |
| •
§
5 HVertrG: Der Handelsvertreter hat die Interessen des Unternehmers mit Sorgfalt
eines ordentlichen Kaufmanns wahrzunehmen und den Unternehmer
unverzüglich von Geschäftsabschlüssen zu verständigen. | |
| • § 6: Unterstützungspflichten des Unternehmers | |
| • § 7: Verbot der Annahme von Belohnungen | |
| • §§ 8 ff: Vergütung / Provision | |
| • § 13: Auslagenersatz | |
| • § 14: Abrechnung und Vorschußleistung | |
| • § 15: Fälligkeit der Provision | |
| • § 16:Buchauszug und Büchereinsicht | |
| • § 17: Gewinnbeteiligung | |
| • § 18: Verjährung aus Vertragsverhältnis (3
Jahre) | |
| • § 19: Zurückbehaltungsrecht; | |
| • §§ 20 ff: Beendigung des Vertragsverhältnisses | |
| • § 20: Fristablauf | |
| • §§ 21 f: Kündigung, vorzeitige Auflösung | |
| • § 25: Konkurrenzklausel | |
| • § 26: Konkurs des Unternehmers | |
Ein anderer
wichtiger Anwendungsbereich moderner Stellvertretung ist das Verfahrensrecht:
Vertretung durch Rechtsanwälte, Notare, Steuerberater etc; vgl etwa
§§ 26 ff ZPO: Prozessvollmacht. | |
| |
§ 26 ZPO | |
(1)
Die Parteien können, sofern in diesem Gesetze nicht etwas anderes
bestimmt ist, Processhandlungen entweder in Person oder durch Bevollmächtigte
vornehmen. | |
(2) Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten
schließt auch in jenen Fällen, in welchen die Vertretung durch Rechtsanwalt
geboten ist, nicht aus, dass die Partei in Begleitung ihres Bevollmächtigten
vor Gericht erscheint und daselbst neben diesem mündliche Erklärungen
abgibt.” | |
| |
Nicht alle Rechtsgeschäfte eignen sich zur Stellvertretung.
Es gibt auch sog vertretungsfeindliche Rechtsgeschäfte:
wie zB Eheschließung oder Testamentserrichtung. – Es handelt sich
dabei um Rechtsakte, die nur höchstpersönlich ausgeübt
werden können. Die Rechtsgeschichte kennt freilich auch hier Ausnahmen;
zB Soldatentestament oder Ferntrauung von Soldaten. | Vertretungsfeindliche Rechtsgeschäfte |
4. Parteien
und Rechtsfolgen direkter Stellvertretung | |
Die Parteien der Stellvertretung heißen: | |
| •
Machtgeber =
Vertretener, | |
| •
Machthaber
= Stellvertreter und | |
| • Dritter = RechtsgeschäftspartnerIn des Stellvertreters. | |
Die Rechtsfolge moderner – direkter – Stellvertretung
besteht – wie angedeutet – darin, dass die Rechtswirkungen des zwischen
Machthaber / Stellvertreter und Drittem abgeschlossenen Rechtsgeschäfts unmittelbar
beim Vertretenen eintreten. Vgl | |
| |
㤠1017 ABGB | |
Insofern der Gewalthaber nach dem Inhalte der
Vollmacht den Gewaltgeber vorstellt, kann er ihm Rechte erwerben
und Verbindlichkeiten auflegen. Hat er also innerhalb der Grenzen
der offenen Vollmacht mit einem Dritten einen Vertrag geschlossen;
so kommen die dadurch gegründeten Rechte und Verbindlichkeiten dem
Gewaltgeber und dem Dritten; nicht aber dem Gewalthaber zu.” | |
| |
Dies zeigt, dass bereits das ABGB die echte Stellvertretung
kannte und nur durch die unglückliche Verbindung von Vollmacht und
Auftrag zum „Bevollmächtigungsvertrag” letzte Klarheit nicht erreichte. | |
Es braucht also bei der modernen, direkten Stellvertretung
nicht den umständlichen Vorgang der Übertragung der Rechtsfolgen
vom Machthaber auf den Machtgeber / Vertretenen. | |
Keine Stellvertretung
gibt es im deliktischen Bereich. – Für deliktisches
Verhalten hat vielmehr jeder selbst einzustehen. Das Strafrecht
kennt aber die Mittäterschaft; § 12 StGB. – Vgl
auch die §§ 1301 und 1302 ABGB. | |
5. Gegenseitige
Rechte und Pflichten | |
§ 1009 ABGB handelt von den „Rechten und Pflichten
des Gewalthabers „ (= Stellvertreter). – Niemand
muss eine Stellvertretung übernehmen! Wer sie aber übernimmt, hat
diese – nach der schönen Formulierung des § 1009 ABGB: | |
| • „emsig und
redlich zu besorgen „! Und der Vertreter hat ferner | |
| • „allen [!] aus dem Geschäfte
entspringenden Nutzen dem Machtgeber zu
überlassen „. | |
Auf der anderen Seite kann der Stellvertreter „alle Mittel
anwenden, die mit der Natur des Geschäftes notwendig verbunden,
oder der erklärten Absicht des Machtgebers gemäß sind”. – Das hat
Folgen für den Machtgeber; vgl die §§ 1014 ff ABGB.
| Rechte und Pflichten
des Gewaltgebers |
Die §§ 1014
ffABGB regeln die Rechte und Pflichten des Gewaltgebers.
– Er hat dem Machthaber insbesondere: | |
| •
allen im Rahmen der Stellvertretung
notwendigen oder nützlichen Aufwand zu ersetzen;
„selbst bei fehlgeschlagenem Erfolge” (§ 1014 ABGB) und | |
| •
auf
Verlangen „zur Bestreitung der baren Auslagen ... einen angemessenen Vorschuss zu
leisten”; und | |
| • „er muss ferner allen durch sein Verschulden entstandenen,
oder mit der Erfüllung des Auftrages verbundenen Schaden vergüten”;
dazu → KAPITEL 12: Schadenersatzpflicht
des Auftraggebers. | |
| |
Zu unterscheiden ist die Stellvertretung von einigen ähnlichen
Rechtsinstituten, insbesondere: | |
Ein Bote überbringt
nicht wie der Stellvertreter eine eigene Willenserklärung, sondern
eine fremde; ein Bote braucht daher auch nicht geschäftsfähig zu
sein, während ein Stellvertreter wenigstens beschränkt (!) geschäftsfähig
sein muss; § 1018 ABGB. – Der Bote ist bloß Werkzeug; daher können
auch Brieftaube oder Hund Bote sein. Natürlich auch Kinder! – Die
Abgrenzung zum Boten ist aber nicht immer leicht. Die Rspr stellt
iSd Vertrauenstheorie auf das objektive äußere Verhalten ab. Frage:
Wie musste / konnte der Dritte das Handeln verstehen? Als das eines
Boten oder eines Stellvertreters? | Botenstellung |
Zu unterscheiden ist
der Erklärungsbote (aktiv), vom Empfangsboten (passiv);
zB Angestellte überbringt Offerte ihrer Chefin, Sekretär des Adressaten
nimmt sie entgegen. – Zur Handlungs- und Empfangsvollmacht → Handlungs-
oder
Empfangsvollmacht. | |
Rechtsgeschäftliche
Vermittlung obliegt heute sog Maklern: Hier wird
nicht das Rechtsgeschäft selbst vom Vermittler /Makler abgeschlossen,
sondern es werden von ihm nur vorbereitende Arbeiten zum Abschluss
desselben durch die Parteien geleistet; zB Versicherungs-, Börsen-
oder Immobilienmakler. | Vermittlung |
| |
Treuhänder handeln
nicht – wie der direkte Stellvertreter – in fremdem Namen, sondern
im eigenen Namen, wenngleich aufgrund vertraglicher Verpflichtung
zur Wahrung der Interessen des Treugebers; mehr → KAPITEL 15: Die Treuhand. | Treuhand |
Die Treuhand ist gesetzlich nicht geschlossen
geregelt, vielmehr ein vornehmlich von Rspr und Schrifttum entwikkeltes
Rechtsinstitut. Daneben finden sich einzelne gesetzliche Erwähnungen/Regelungen.
– Die Personen der Treuhand sind der Treugeber und
der Treuhänder. Aus dem geschlossenen Treuhandvertrag entsteht
das Treuhandverhältnis. Der Treuhänder übt eigenes
Recht im eigenen Namen, wenngleich im Interesse des Treugebers aus.
Daher die Merkformel: „Der Treuhänder kann mehr als er darf.”
Damit wird der Rechtsüberschuss des Treuhänders im unbeschränkten
Außenverhältnis angesprochen und darauf angespielt, dass der Treuhänder
im Innenverhältnis idR sehr wohl Beschränkungen unterliegt. | |
| |

|
Rechtsanwalt
wird von Käufer und Verkäufer zur Abwicklung eines Liegenschaftskaufs beauftragt;
vgl etwa EvBl 1999/196:
Pflichten des Treuhänders; oder – Steuerberater übergibt seine Kanzlei
für die Zeit seiner politischen Tätigkeit an einen
Treuhänder. | |
|
 | |
Abzugrenzen von der Stellvertretung (=
Handeln in fremdem Namen) ist ferner das (unerlaubte) Handeln
unter fremdem Namen. – Natürlich kann der unter fremdem
Namen Auftretende – also der zB mit falschem Namen Auftretende –
den namentlich Betroffenen nicht verpflichten. Es fehlt an allen
Voraussetzungen ( → Voraussetzungen
moderner Stellvertretung) einer gültigen rechtsgeschäftlichen Stellvertretung! | Handeln
unter
fremdem Namen |
Besondere Vorkehrungen werden im Bereich
von Internet und e-commerce getroffen,
um ein Handeln unter fremdem Namen auszuschalten → KAPITEL 2: Internet und Recht. | |
7. Voraussetzungen
moderner Stellvertretung | |
Es wurde schon erwähnt, dass man
grundsätzlich nur sich selbst berechtigen und verpflichten kann; Grundsatz
der Selbstverpflichtung. Wenn das Gesetz davon eine Ausnahme
macht, knüpft es diese an Bedingungen. – Was sind nun – zusammengefasst
– die Voraussetzungen moderner direkter Stellvertretung? | Grundsatz
der
Selbstverpflichtung |
| •
Der Stellvertreter
braucht Vertretungsmacht und | |
| • er muss als Machthaber im Namen des
Vertretenen, also des Machtgebers handeln; und zudem muss
dieses Handeln in (nicht unter!) fremdem Namen | |
| •
offengelegt werden;
dh es muss dem Dritten erkennbar werden! Man nennt das Offenlegungsgrundsatz.
§ 1017 ABGB spricht von „offener Vollmacht” im Gegensatz zur „geheimen”
oder verdeckten bei der indirekten Stellvertretung. | Offenlegung |
Nur unter Einhaltung aller dieser Voraussetzungen
treffen die Rechtsfolgen des abgeschlossenen Geschäfts den Machtgeber
/ Vertretenen unmittelbar und nicht nur den handelnden Stellvertreter (selbst). | |
| |
8. Entstehungsquellen
der Vertretungsmacht | |
Dass
jemand als Stellvertreter handeln darf, kann verschiedene Gründe
haben. Rechtliche Vertretungsmacht fließt aus verschiedenen Quellen: | |
| •
Rechtsgeschäftliche oder gewillkürte
Stellvertretung: Die einseitige Willenserklärung / das einseitige
Rechtsgeschäft, womit rechtsgeschäftliche Vertretungsmacht übertragen
/ erteilt wird, heißt Vollmacht
→ Die
Vollmacht Der
Vollmacht kommt von allen Begründungsarten der Stellvertretung die größte praktische
Bedeutung zu. | rechtsgeschäftliche Stellvertretung |
| •
Statut / Satzung / Gesellschaftsvertrag; organschaftliche oder statutarische
Vertretung bei juristischen Personen: zB Geschäftsführer
einer GmbH oder Vereinsvorstand. – Die Bestellung zum Organ begründet
kraft Statut / Satzung / Gesellschaftsvertrag Vertretungsmacht. | statutarische
Stellvertretung |
| •
Gesetzliche Stellvertretung:
zB §§ 151 Abs 1, 154, 865 ABGB; vgl die Ausführungen zur Geschäftsfähigkeit
Minderjähriger! → KAPITEL 4: Wer
ist gesetzlicher
Vertreter?. – Vater, Mutter als gesetzliche Vertreter
ihrer minderjährigen Kinder; vgl § 1034 Satz 2 ABGB. | gesetzliche
Stellvertretung |
| •
Richterliche Erteilung von Vertretungsmacht:
zB Vormund, Kurator, Sachwalter, Masseverwalter im Konkurs; vgl
§ 1034 Satz 1 ABGB. | richterliche
Stellvertretung |
Das ABGB spricht in der Überschrift vor
§ 1034 ungenau von „Gerichtliche[r] und gesetzliche[r] Bevollmächtigung”.
Aber die richterliche Erteilung von Vertretungsmacht beruht ebenfalls
auf dem Gesetz. | |
9. Vertreter
ohne Vertretungsmacht | |
Rechtsquellen: – §§ 1009 und 1016 ABGB; –
HGB | |
Das
römische Recht sprach von falsus procurator; heute kurz auch: Falsus | Falsus |
Der
Vertreter ohne Vertretungsmacht handelt zwar in fremdem Namen, aber
er erfüllt nicht die gesetzlichen Voraussetzungen gültiger Stellvertretung;
dh er besitzt keine ordentliche Vertretungsmacht.
– Dafür gibt es wiederum mehrere Möglichkeiten: | Keine ordentliche Vertretungsmacht |
| • § 1016 ABGB nennt
bloß den Fall, dass ein Vertreter seine Vertretungsmacht überschreitet. | |
| • Es kann aber auch sein, dass die Vertretungsmacht
(ursprünglich) zwar bestanden hat, mittlerweile aber erloschen ist,
und | |
| • schließlich kann Vertretungsmacht überhaupt
fehlen, gar nicht erteilt worden sein. | |

|
OGH 20. 1. 2000, 2 Ob 5/00z, SZ 73/11:
Mehrheitseigentümer einer Liegenschaft überträgt mit schriftlicher
Vollmacht die Hausverwaltung an einen Dritten.
Darin wird dieser zur in Empfangnahme von Geldern jedoch nicht zur
Darlehensaufnahme bevollmächtigt. Trotzdem nimmt der Verwalter einen
Kredit unter Berufung auf seine Vollmacht auf. Das Geld verwendet
er zur Tilgung offener Verbindlichkeiten des Mehrheitseigentümers.
– OGH: Wer einem falsus procurator auf Grund eines
unwirksamen Geschäftes geleistet hat, wobei der Scheinvertreter
grundsätzlich zwar nicht zum Abschluss des Grundgeschäfts, aber zur
Empfangnahme von Leistungen ermächtigt war, hat einen Kondiktionsanspruch
gegen den Vertretenen, wenn der Vertreter das Empfangene tatsächlich
an den Vertretenen weitergeleitet hat; hier: durch Zahlung offener
Verbindlichkeiten des Vertretenen an sich selbst.(?) | |
|
Ein Vertreter
ohne Vertretungsmacht kann den Vertretenen nicht verpflichten. Es
besteht allerdings die Möglichkeit (§ 1016 ABGB), dass der fälschlich
Vertretene das Geschäft nachträglich genehmigt (ratihabiert
/ Ratihabition), was iSd § 863 ABGB auch schlüssig erfolgen
kann; zB indem sich der Vertretene „den aus dem Geschäfte entstandenen
Vorteil ... zuwendet.”; § 1016 ABGB Schluss. | |
Rechtsfolge bei Nichtgenehmigung:
Falls aber der Vertretene nicht an Genehmigung denkt, kann der Dritte den Falsus
„zur Verantwortung” ziehen. – Was meint das Gesetz damit?
Die Lösung bietet § 1009 ABGB letzter Satz (Faistenberger): Danach
haftet der Vertreter ohne Vertretungsmacht (dem Dritten) für den Erfüllungs- und
nicht nur für den Vertrauensschaden. Der Falsus muss
daher den von ihm für den Vertretenen geschlossenen Vertrag selber
zuhalten. Allerdings nur, wenn der Dritte es will; dh, wenn der
Dritte auf Vertragserfüllung besteht. Es liegt also nicht am Falsus
den Vertrag mit dem Dritten aufrechtzuerhalten! – Die Haftung des
Falsus ist eine normale Verschuldenshaftung (für omnis culpa), greift
also ab leichter Fahrlässigkeit. | Haftung
des Falsus |
| Sonderregelungen: ABGB, HVertrG, HGB |
| •
Eine Sonderregelung
enthält § 1026 ABGB für den Fall, dass dem Dritten, die Aufhebung
der Vollmacht „ohne sein Verschulden unbekannt war”.
Der vom Falsus in einem solchen Fall mit dem Dritten geschlossene
Vertrag bleibt (für den Vertretenen!) verbindlich und dieser (!)
muss sich an den Falsus halten, der (dem Dritten) die Aufhebung
der Vollmacht verschwiegen hat. | |
| •
Eine weitere Sonderregelung enthält §
2 Abs 2 HVertrG, wenn ein bloßer Vermittlungsvertreter mit
einem Dritten ein Geschäft im Namen des Unternehmers abgeschlossen
hat. Das Gesetz erklärt dieses Geschäft für gültig–
Fiktion der Genehmigung durch den Unternehmer, wenn der Unternehmer
nicht unverzüglich dem Dritten gegenüber das Geschäft
ablehnt. | |
| • Das HGB (Art 8 Nr 11 EVHGB)
trifft eine vom ABGB abweichende Lösung, was sachgerecht erscheint.
– Sie folgt dem dtBGB und lautet: | |
(1) „Wer als Vertreter ein Handelsgeschäft
geschlossen hat, ist, sofern er nicht seine Vertretungsmacht nachweist, dem
anderen Teil nach dessen Wahl zur Erfüllung oder zum Schadenersatz
verpflichtet, wenn der Vertretene die Genehmigung des Vertrags verweigert.” | |
Kannte der Falsus den Mangel nicht, haftet er nach Abs 2
unserer Bestimmung nur für den Vertrauensschaden. Nach Abs 3 haftet
der Vertreter auch nicht, „wenn der andere Teil den Mangel der Vertretungsmacht
kannte oder kennen musste.” | |
| |
1. Erteilung
der Vollmacht | |
Wir wissen bereits, dass
Stellvertretung rechtlich nur wirksam ist, wenn Vertretungsmacht
korrekt erteilt wurde → Voraussetzungen
moderner Stellvertretung Die
Vollmacht ist nun jenes rechtliche Instrument, mittels dessen Vertretungsmacht
(rechtsgeschäftlich) erteilt wird. Man spricht deshalb auch von
gewillkürter Stellvertretung; vgl die Marginalrubrik zu § 49 IPRG. | |
Vollmacht
wird durch einseitige Willenserklärung erteilt.
Sie ist kein Vertrag (!), vielmehr einseitige/s
Willenserklärung/Rechtsgeschäft. – Ihre Erteilung durch den Machtgeber
kann aber in eine vertragliche Beziehung eingebettet sein, dh im
Rahmen eines (schon) bestehenden oder doch gleichzeitig abgeschlossenen
Vertrags erteilt werden; dazu gleich unten. – Als einseitige und
empfangsbedürftige Willenserklärung wird die (erteilte) Vollmacht
mit Zugang wirksam. Eine Annahme ist daher nicht
nötig; JB 212 (1914). | |
Vollmacht
wird idR zu rechtsgeschäftlichem Handeln des Bevollmächtigten erteilt,
aber sie kann auch bloss zur Vornahme von Rechtshandlungen (dazu → KAPITEL 5: Die
Rechtshandlungen)
dienen. Das spielt bei sog Patientenverfügungen ( → KAPITEL 17: Exkurs:
Die Patientenverfügung)
eine Rolle, die nach us-amerikanischem Vorbild mittlerweile auch
in Europa mit einer „ Vorsorgevollmacht “ verbunden
werden. Die so bevollmächtigte Person handelt dann allenfalls anstelle der
betroffenen Person, wenn diese nicht mehr in der Lage ist, selbst
über die Vornahme oder Nichtvornahme bestimmter medizinischer Behandlungen
zu entscheiden. – Das lehrt uns, dass das Rechtsinstitut der Stellvertretung nicht
nur im rechtsgeschäftlichen Bereich, sondern auch in dem der Rechtshandlungen
Anwendung findet. | Vorsorgevollmacht |
Die
Vollmachterteilung kann: | Wer ist Adressat der Vollmachtserteilung? |
| •
dem Bevollmächtigten
selbst zugehen, man spricht dann von interner Vollmachtserteilung; oder
auch | |
| •
an den betroffenen Dritten oder an die Öffentlichkeit
gerichtet sein (externe Bevollmächtigung): OGH
16.1.1986, 6 Ob 511/86. | |
Die erteilte Vollmacht allein, verpflichtet den
Bevollmächtigten noch zu nichts, räumt ihm vielmehr
nur die rechtliche Befugnis ein, für einen anderen handeln zu können
(nicht zu müssen!) | Handlungs-
oder
Empfangsvollmacht |
Die
Vollmacht kann zu aktivem Handeln ( Handlungs- oder
Erklärungsvollmacht) oder zu passiver/m Entgegennahme/Empfang ( Empfangsvollmacht)
erteilt werden; vgl § 54 HGB ( → Handelsrechtliche
Vollmachten: Handlungsvollmacht
des Handelsrechts) und die Empfangsvollmacht des Art 8 Nr 9 EVHGB
für den Überbringer einer Quittung: | |
„Der Überbringer einer Quittung gilt als
ermächtigt, die Leistung zu empfangen, sofern nicht die dem Leistenden bekannten
Umstände der Annahme einer solchen Ermächtigung entgegenstehen.” | |
Zu unterscheiden sind: | |
| • das Grundverhältnis (zwischen
Machtgeber und Machthaber, es wird auch Innenverhältnis genannt)
und andrerseits | |
| • das Ausführungsgeschäft des
bevollmächtigten (Stell)Vertreters mit dem Dritten: Außenverhältnis. | |
| |
Vollmachtserteilungen
sind häufig eingebettet in vertragliche Beziehungen, die zwischen
Machtgeber und Machthaber (bereits) bestehen oder doch begründet
werden (Grundverhältnis); sei es ein Arbeits- oder Dienstvertrag,
ein Auftrag oder ein Gesellschaftsverhältnis. – Das ABGB selbst
fasst diesen praktisch häufigen Fall – wie eingangs erwähnt – begrifflich
im Terminus des Bevollmächtigungsvertrags zusammen
(Überschrift vor § 1002 ABGB), verbindet also – als wäre dies die einzig
mögliche Form – Vollmacht und Auftrag. Das führt immer wieder zu
Verwirrung. Auftrag und Vollmacht können, müssen aber nicht verbunden
sein; dh: es gibt sowohl vollmachtlose Aufträge, wie auftraglose
Vollmachten. | |
Anders
als die Vollmacht ist der Auftrag ein
Vertrag. – Inhaltlich enthält ein Auftrag die Geschäftsbesorgung
für andere auf Rechnung des Auftraggebers / Geschäftsherrn. Beim
Auftrag geht es – wie bei der Stellvertretung – um die Durchführung
von Rechtsgeschäften oder doch Rechtshandlungen. Das unterscheidet
Auftrag und Stellvertretung vom Arbeitsvertrag und vom Werkvertrag,
bei denen es um das Verrichten faktischer Arbeiten / Dienste geht;
Büroarbeit, Baumeister. | Vollmacht und Auftrag |
Der Unterschied von Auftrag und Stellvertretung liegt
auch darin, dass dem Auftrag immer eine vertragliche Beziehung zwischen
Auftraggeber und Auftragnehmer zugrunde liegt, während Stellvertretung
grundsätzlich auf Vollmacht, also einseitiger rechtsgeschäftlicher
Erklärung beruht (die den Bevollmächtigten noch zu nichts verpflichtet!).
Der Auftrag statuiert demnach eine vertragliche Pflicht des Auftragnehmers,
die ihm übertragenen Geschäfte auf Rechnung des Auftraggebers zu
besorgen. – Ein weiter Unterschied liegt darin, dass der Auftrag
im Innenverhältnis wirkt, die Stellvertretung dagegen
im Außenverhältnis. | |
Beispiele aus
der Praxis: – Dauerauftrag einer Bankkundschaft für die eigene Hausbank;
– Dauervollmacht(ohne Auftrag) an einen Rechtsanwalt;
– Erteilung einer Hausverwaltervollmacht im Rahmen eines zwischen
Mit- / Wohnungseigentümern und einem Hausverwalter abgeschlossenen
Vertrag. | |
Begriffliche Gegenüberstellung
| |
| •
Vollmacht = Begründet ein rechtliches
Handeln-Können und betrifft das Außenverhältnis. Vollmacht entsteht
idR durch rechtsgeschäftliche Begründung von Vertretungsmacht =
Handeln in fremdem Namen und auf fremde Rechnung. | | | •
Ermächtigung = Begründet ein
rechtliches Handeln-Dürfen. Ermächtigte werden durch einseitige
Willenserklärung berechtigt in eigenem Namen, aber auf fremde Rechnung
handeln zu dürfen. Der Ermächtigende erklärt, künftig das Handeln
des Ermächtigten gegen sich gelten zu lassen. Dazu ist keine Zustimmung
des Ermächtigten nötig. Sie betrifft das Innenverhältnis; typisch
indirekte Stellvertretung! | | | •
Auftrag = Begründet ein rechtliches
Handeln-Sollen (iSv Müssen). Er ist ein Vertrag (zweiseitiges RG)
und verpflichtet den Beauftragten zu rechtsgeschäftlichem Handeln
auf Rechnung des Auftraggebers. Er betrifft (wiederum nur) das Innenverhältnis | | | •
Bevollmächtigungsvertrag: Diktion
des ABGB in § 1002 = Verbindung von Auftrag und Vollmacht (in einem
einheitlichen Vertrag) ! | |
| |
| |
| offene
und
geheime Vollmacht |
Generalvollmacht (ABGB
= allgemeine Vollmacht) und Spezialvollmacht (ABGB
= besondere Vollmacht): „ ... je nachdem jemandem die Besorgung
aller, oder nur einiger Geschäfte anvertraut wird”; § 1006 Satz
1 ABGB. | General-
und
Spezialvollmacht |
 | |
Unumschränkte oder beschränkte Vollmacht:
| Unumschränkte oder beschränkte
Vollmacht |
„Vollmachten werden entweder mit unumschränkter oder mit
beschränkter Freiheit zu handeln erteilt. Durch die erstere wird
der Gewalthaber berechtigt, das Geschäft nach seinem besten Wissen
und Gewissen zu leiten: durch die letztere aber werden ihm die Grenzen,
wie weit, und die Art, wie er dasselbe betreiben soll, vorgeschrieben.”
(§ 1007 ABGB) | |
 | |

|
SZ 24/169 (1951): Die Bevollmächtigung
zum Verkauf einer Liegenschaft umfasst noch nicht
die Vollmacht, auf Kosten des Auftraggebers ein Realitätenbüro mit
dem Verkauf und der Ermittlung von Interessenten zu beauftragen. | |
|
Die
Bevollmächtigung kann eine unentgeltliche oder entgeltliche sein;
§ 1004 ABGB. Sie kann nach § 1005 ABGB mündlich oder schriftlich erteilt
werden. | Unentgeltliche
oder entgeltliche, mündliche oder schriftliche Vollmacht |
3. Handelsrechtliche
Vollmachten | |
Gewisse
Vollmachten, etwa die handelsrechtliche Generalvollmacht – die Prokura –
sind ihrer praktischen Bedeutung wegen gesetzlich näher umschrieben.
Die Prokura ermächtigt – gemäß § 49 HGB – „zu allen Arten von gerichtlichen
und außergerichtlichen Geschäften und Rechtshandlungen, die der
Betrieb eines [nicht des Unternehmens in dem sie
erteilt wird! – Unterschied zur Handlungsvollmacht!] Handelsgewerbes mit
sich bringt.” | |
Trotz dieser Generalklausel
bestehen Beschränkungen: | gesetzliche
Beschränkungen der Prokura |
| • „Zur Veräußerung
und Belastung von Grundstücken ist der Prokurist [aber]
nur ermächtigt, wenn ihm diese Befugnis besonders erteilt ist”;
§ 49 Abs 2 HGB. | |
| •
„Eine [rechtsgeschäftliche!] Beschränkung
des Umfanges der Prokura ist Dritten gegenüber unwirksam;
§ 50 Abs 1 HGB. Dies gilt insbesondere von der Beschränkung, dass
die Prokura nur für gewisse Geschäfte oder gewisse Arten von Geschäften
oder nur unter gewissen Umständen oder für eine gewisse Zeit oder
an einzelnen Orten ausgeübt werden soll”; § 50 Abs 2 HGB. | |
| •
Die Erteilung der Prokura ist im Firmenbuch (früher
Handelsregister) einzutragen; § 53 Satz 1 HGB. | |
| •
Die Prokura ist (vom Inhaber) nicht übertragbar und erlischt
nicht durch den Tod des Geschäftsherrn; § 52 Abs 1 HGB. | |
| • „Sie kann jederzeit ohne Rücksicht
auf einen allenfalls weiterbestehenden Dienstvertrag oder Auftrag widerrufen
werden „; § 52 Abs 1 HGB. | |
Sonderformen
der Prokura: | Sonderformen der Prokura |
| •
Gesamtprokura (§
48 Abs 2 HGB), | |
| •
gemischte und die | |
| •
Filialprokura; § 50 Abs 3 HGB. | |
Von der Prokura
ist die Handlungsvollmacht zu unterscheiden. Sie
erstreckt sich „auf alle Geschäfte und Rechtshandlungen, die der
Betrieb eines derartigen (!) Handelsgewerbes oder
die Vornahme derartiger Geschäfte gewöhnlich mit
sich bringt”; § 54 HGB. – Die Handlungsvollmacht ist also deutlich
„enger” angelegt als die Prokura und zudem an der konkreten Unternehmenstätigkeit
orientiert! | |
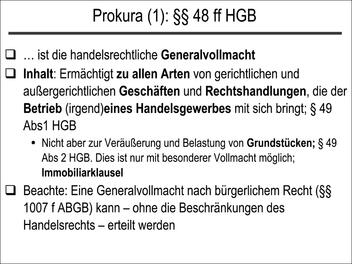 | Abbildung 13.4: Prokura (1) |
|
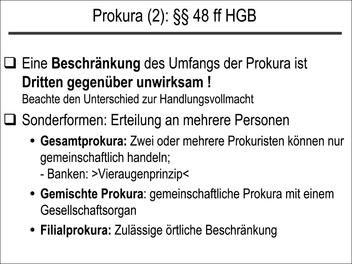 | Abbildung 13.5: Prokura (2) |
|
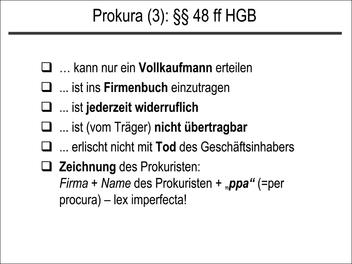 | Abbildung 13.6: Prokura (3) |
|
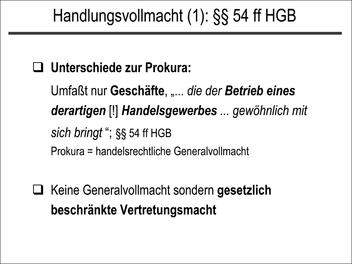 | Abbildung 13.7: Handlungsvollmacht (1) |
|
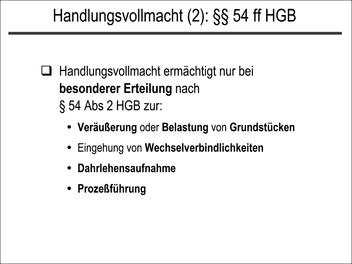 | Abbildung 13.8: Handlungsvollmacht (2) |
|
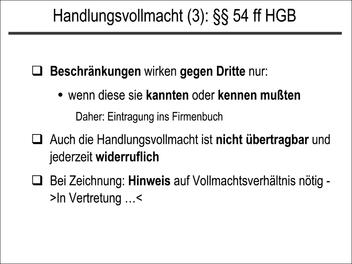 | Abbildung 13.9: Handlungsvollmacht (3) |
|
4. Duldungs- oder
Anscheinsvollmacht | |
Wir haben schon
gehört, dass die Vollmacht nicht nur ausdrücklich, sondern auch
schlüssig oder stillschweigend (iSd § 863 ABGB) erteilt werden kann
und das ABGB selbst die Verwaltungs- und Ladenvollmacht kennt; §§
1029 ff ABGB. – Die Vollmacht ist – wie wir gehört haben – die einseitige,
empfangsbedürftige Willenserklärung des Machtgebers / Vertretenen
gerichtet an: | |
| • den Stellvertreter
/ Machthaber; sog Innenvollmacht; | |
| • oder an Dritte / die Öffentlichkeit; sog Außenvollmacht. | |
Der
Grundgedanke der §§ 1029 – 1031 ABGB – als gesetzlich
geregelten Fällen stillschweigend erteilter Vollmacht, wird über
den dort geregelten Bereich hinaus angewandt; man spricht in solchen
Fällen von Duldungs- oder Anscheinsvollmacht und verlangt dafür
folgende Voraussetzungen: | Verwaltungs-
und
Ladenvollmacht |
| • Vertretener duldet
oder erweckt den Anschein, dass die Vollmacht von ihm ausgeht, also
eine Art äußerer Tatbestand einer Vollmachtserteilung vorliegt
und der Vertretene nicht widerspricht; | |
| • dann wird das Vertreterverhalten dem Vertretenen
zugerechnet. | |
Unbedingte Voraussetzung dafür ist aber, dass die Anscheinswirkung
auf den Vertretenen selbst zurückgeht und nicht nur auf
den Vertreter. Dritte vertrauen demnach auf eine stillschweigende oder
schlüssige Zustimmung des Vertretenen! | |

|
SZ 27/277 (1954): Hofmeister
eines Klosters verkauft Pferdehändler 2
Schlachtpferde, die dieser nicht zahlt, wozu er aber idF verurteilt
wird. Später treffen sich beide im Gasthaus und schließen einen
Vergleich (über die Judikatschuld von 5.500S) und einigen sich auf
4.500 S + 1 Liter Wein. Das Kloster will den Vergleich nicht gelten
lassen, setzt sich aber nicht durch. – OGH nimmt (Anscheins)Vollmacht
des Hofmeisters an. | |
|
|
|
HS 5088 (1965): Bauherr überträgt
befugtem Architekten die Ausführung eines Hausbaus;
er setzt äußeren Tatbestand typischen Charakters und erweckt bei
gutgläubigen Dritten nach der Verkehrssitte den Eindruck, der Architekt
sei ... auch als Machthaber des Bauherrn anzusehen und daher zum
Abschluss einschlägiger Rechtsgeschäfte berechtigt. | |
|
|
|
EvBl 1971/20 (1970): Architekt
führt im Auftrag des Akademischen Senates Planungsarbeiten zum Bau der Mensa
in Innsbruck durch; Ministerium lehnt Zahlung des Honorars
ab; – OGH: Keine Anscheinsvollmacht des Akademischen Senates/ Rektors. | |
|
5. Umfang der Vertretungsmacht
und mündliche Zusagen | |
§
10 KSchG behandelt Spezialfälle, die in der Praxis immer wieder
Probleme schufen: | |
| • § 10 Abs 1: Hat ein
Unternehmer – zB an einen Angestellten – eine Vollmacht erteilt,
ist eine unübliche Beschränkung dieser Vollmacht
dem Verbraucher gegenüber nur wirksam, „wenn sie ihm bewusst war”. | |
| • Abs 2: War einem Verbraucher eine solche Vollmachtsbeschränkung nur
infolge grober Fahrlässigkeit nicht bewusst, kann der Unternehmer
vom Vertrag zurücktreten. | |
| • Abs 3: „Die Rechtswirksamkeit formloser
Erklärungen desUnternehmersoder seinerVertreter kann
zum Nachteil des Verbrauchers vertraglich nicht ausgeschlossen werden.”
– Was heißt das? | |
 | |
6. Höchstpersönlichkeit
der Vollmacht – Substitution | |
Machtgeber
und Machthaber verbindet eine Vertrauensbeziehung.
Der Machthaber / Vertreter kann daher seine Vollmacht grundsätzlich
nicht übertragen; sog Höchstpersönlichkeit der Vollmacht. Die Übertragung
/ Substitution müsste ihm vielmehr: | Substitution? |
| • „ausdrücklich
gestattet, oder | |
| • durch die Umstände unvermeidlich „
geworden sein. | |
Man nennt also die Übertragung der
dem Vertreter vom Machtgeber erteilten Vertretungs(voll)macht durch
den Vertreter selbst: Substitution; § 1010 ABGB.
Der Vertreter haftet dabei für Auswahlverschulden /
culpa in eligendo.
Nicht
zu verwechseln mit der Substitution ist, dass sich auch ein (einfacher)
Vertreter / Machthaber eines Erfüllungsgehilfen bedienen
kann (Rechtsanwalt-Konzipient), der ihn unterstützen soll und für
dessen Verschulden der Vertreter nach allgemeinen Grundsätzen einzustehen
hat; zu § 1313a ABGB → KAPITEL 10: §
1313a ABGB: Erfüllungsgehilfenhaftung.
– Allein der Unterschied liegt in folgendem: Der Substitut handelt
(direkt / unmittelbar) für den Vertretenen / Machtgeber, ein Erfüllungsgehilfe
dagegen nur für den Vertreter / Machthaber. | Substitution <->
Erfüllungsgehilfe |
7. Widerruf
der Vollmacht – Tod | |
Vollmachten können
– wegen der damit verbundenen engen Vertrauensbeziehung und Höchstpersönlichkeit
– jederzeit vom Machtgeber widerrufen werden;
§ 1020 ABGB. – Auch der Machthaber / Vertreter kann sie aufkündigen;
§ 1021 ABGB. Tut er das aber „vor Vollendung” des ihm aufgetragenen
Geschäfts, „so muss er, dafern nicht ein unvorhergesehenes und unvermeidliches Hindernis
eingetreten ist, allen daraus entstandenen Schaden ersetzen”. Dies
soll sicherstellen, dass begonnene Tätigkeiten zu Ende geführt werden
und dem Vertretenen durch Vollmachtsaufkündigung kein Nachteil entsteht. | |
Im Normalfall beendet nach bürgerlichem Recht,
sowohl der Tod des Gewaltgebers, wie der des Gewalthabers das Vertretungsverhältnis;
§ 1022 Satz 1 ABGB. | |
„Läßt sich aber das angefangene Geschäft
ohne offenbaren Nachteil der Erben nicht unterbrechen, oder erstreckt
sich die Vollmacht selbst auf den Sterbefall des Gewaltgebers; so
hat der Gewalthaber das Recht und die Pflicht, das Geschäft zu vollenden.”
(§ 1022 Satz 2 ABGB) | |
Anders im Handelsrecht: Art 8 Nr 10 EVHGB
lässt die in einem Gewerbebetrieb von einem Kaufmann erteilten Vollmachten
durch den Tod des Kaufmanns im Zweifel nicht erlöschen. – Die Regelung
gilt auch für Aufträge. | |
Auch
nach Prozessrecht beendet der Tod des Machtgebers
– zB der KlientIn eines Anwalts – die erteilte Prozessvollmacht
nicht. Der Tod bildet aber einen Widerrufungsgrund; § 35 ZPO. | |
8. Abschluss
sog unternehmensbezogener Geschäfte – Verzicht auf strikte Offenlegung | |
In
manchen Fällen verlangen Gesetz (zB § 19 GmbHG)
und Rspr kein striktes Offenlegen des Vertretungsverhältnisses
durch den Vertreter. Das wird dann zugelassen, wenn sich die Vertretungsabsicht aus
den jeweiligen Umständen (ohnehin nach der Vertrauentheorie) ergibt.
– Das führt aber in der Praxis immer wieder zu Unklarheit und Streit
wie die folgenden Beispiele zeigen. Vgl aber zunächst die Sonderregel
des GmbHG. | |
§ 19 GmbHG: „Die Gesellschaft wird durch
die von den Geschäftsführern in ihrem Namen geschlossenen Rechtsgeschäfte
berechtigt und verpflichtet; es ist gleichgültig, ob das Geschäft
ausdrücklich im Namen der Gesellschaft geschlossen worden ist oder
ob die Umstände ergeben, dass es nach dem Willen der Beteiligten
für die Gesellschaft geschlossen werden sollte.” | |

|
JBl
1976, 40: §§ 1002 ff und 863 ABGB: Ein
Geschäft in fremdem Namen liegt auch vor, wenn die Person des Vertretenen
bei Vertragsschluss (zwar) nicht genannt wird, aber die Stellvertretungsabsicht
aus den Umständen klar hervortritt. Verträge, die ein Hausverwalter,
der sich als solcher deklariert, in dieser Eigenschaft über Hausreparaturarbeiten
schließt, sind daher im Namen des/r Hauseigentümer/s geschlossen,
auch wenn der Hausverwalter das Vertretungsverhältnis nicht ausdrücklich
und die Person des Hauseigentümers, von der sich der Vertragspartner
Kenntnis verschaffen kann, überhaupt nicht offenlegt. – Kläger war
ein Dachdeckerunternehmen., Beklagter der Hausverwalter einer Wohnungseigentumsanlage.
Das Klagebegehren war auf Zahlung der Hausreparaturkosten gerichtet.
Der Verwalter hatte telefonisch die Reparaturarbeiten vergeben und
sich dabei als „Hausverwaltung S” gemeldet. Daraus hätte der Dachdeckermeister
das Vertretungsverhältnis erkennen müssen. Die Klage des Dachdeckerunternehmers
gegen den Hausverwalter wurde daher wegen mangelnder Passivlegitimation
des Hausverwalters abgewiesen. | |
|
|
|
RdW
1985, 337: „Die Beklagte bestellte bei
der Klägerin in mehreren Verträgen die Einrichtung für einen Kosmetiksalon;
dieser gehörte der K-GmbH, deren alleinige Geschäftsführerin die
Beklagte ist. Die Beklagte trat aber bei allen mündlichen Äußerungen
so auf, als ob sie selbst alleinige Inhaberin dieses Unternehmens
sei; sie ließ sämtliche Verträge auf ihren persönlichen Namen ausstellen,
ohne je die Änderung auf die Firmenbezeichnung zu reklamieren. Über
dem Geschäftslokal befand sich neben der großen Aufschrift ‚Depot
m.‘ in kleineren Buchstaben der Zusatz K-GmbH. Die Beklagte verwendete
ein Briefpapier, auf dem als Kopf in blassem Druck die Firmenbezeichnung,
darunter aber in wesentlich stärkerem Druck der Name der Beklagten,
und darunter wieder in blassem und wesentlich kleinerem Druck ‚Generalrepräsentant‘
aufschien .... Der Wille, im Namen eines Dritten zu handeln, muss
im Geschäftsverkehr ausdrücklich erklärt werden oder aus den Umständen
klar erkennbar sein (Griehsler, GesRZ 1973, 40; SZ 51/102). Ob diese
Erkennbarkeit für den Vertragspartner gegeben ist, ist objektiv
zu beurteilen (Strasser in Rummel, ABGB, Rz 50 zu § 1002, EvBl 1981/168). Wer
sich darauf beruft, dass ein Vertretergeschäft vorliegt, muss dies
beweisen (Stanzl in Klang IV/1, 776; Griehsler, GesRZ 1973,
41; Strasser aaO, EvBl 1979/12 ua). Im Zweifel ist jedenfalls
ein Eigengeschäft des Handelnden anzunehmen....“ | |
|
| |
Bei der Beurteilung, ob sich mangels
einer ausdrücklichen Erklärung über das Handeln im fremden Namen
für die Klägerin aus den Umständen eindeutig hätte ergeben müssen,
dass die Erklärungen der Beklagten im Namen der GmbH erfolgten,
sind alle Umstände in ihrer Gesamtheit zu berücksichtigen. Bei einer
solchen alle Umstände berücksichtigenden Beurteilung kann aber trotz
der festgestellten Art der Anbringung der Firmenaufschrift auf dem Geschäftslokal
und auf dem Briefpapier nicht von Umständen gesprochen werden, die
eindeutig auf ein Vertreterhandeln hinweisen. Daran vermag der Umstand,
dass die Beklagte die Geschäftsführerin der K GmbH war, schon deshalb
nichts zu ändern, weil auch dies der Klägerin bei dem festgestellten
Sachverhalt nicht klar sein musste. War aber weder ausdrücklich
noch aus den Umständen klar, dass die Beklagte nicht im eigenen
Namen, sondern als Geschäftsführerin für die GmbH handeln wollte,
so traft die Klägerin auch keine Pflicht, sich über das Vertretungsverhältnis
der GmbH zu unterrichten. Die Vorinstanzen haben das Geschäft zu
Recht als Eigengeschäft der Beklagten beurteilt. Dem steht auch
nicht entgegen, dass es sich um sog unternehmensbezogene Rechtsgeschäfte gehandelt
hat. Das Vorliegen solcher Rechtsgeschäfte allein ist kein ausreichender
Anhaltspunkt dafür, dass die Klägerin damit hätte rechnen müssen,
die Beklagte sei nur Vertreterin (vgl Hügel, JBl 1983, 529 FN 80).
Da die Beklagte unter ihrem bürgerlichen Namen aufgetreten ist und
unter diesem Namen sich so verhalten hat, dass sie für die Inhaberin
des Kosmetiksalons gehalten werden konnte, ‚zielte‘ das Rechtsgeschäft
(vgl Welser, ZAS 1976, 186) auf die Beklagte selbst. Es fehlte ein
ausreichender Hinweis auf einen allenfalls von der Beklagten verschiedenen Unternehmensträger
als Vertreterin. Zumindest in einem solchen Fall kann nicht davon
gesprochen werden, dass sie selbstverständlich im Namen des wirklichen
Geschäftsinhabers gehandelt habe. Der Einwand der mangelnden Passivlegitimation
ist daher nicht berechtigt.”] | |
| |
Insichgeschäfte führen
leicht zu Interessenkollissionen, daher erscheint Vorsicht geboten.
– Der Begriff des Insichgeschäfts dient als Oberbegriff
für: | |
| • das Selbstkontrahieren und | |
| • die Doppel- oder Mehrfachvertretung. | |
Von Selbstkontrahieren wird
gesprochen wenn eine Person (als Vertreter eines anderen) den Vertrag
für diesen mit sich selbst schließt. – Ein Fall der Doppel-
oder Mehrfachvertretung liegt vor, wenn der Vertreter,
der für beide oder mehrere Parteien vertretungsberechtigt ist, einen
Vertrag zwischen (nicht mit!) diesen Parteien schließt. | Selbstkontrahieren
und Doppelvertretung |
Das
ABGB regelt das Insichgeschäft nicht umfassend, andere Gesetze dagegen
– zB das HGB – kennen Bestimmungen; so gestattet § 400 HGB unter
gewissen Voraussetzungen das Selbstkontrahieren des Einkaufs-
oder Verkaufskommissionärs. | |
Das bedeutet zB: Der Verkaufskommissionär
kann das zu verkaufende Gut / Ware des Kommittenten selbst kaufen, wenn
die Ware einen Börsen- oder Marktpreis hat, was regelmäßig der Fall
ist. – Dies deshalb, weil dadurch die Interessen des Kommitenten
nicht verletzt werden, woraus der allgemeine Gedanke abgeleitet
werden kann, dass dann, wenn die Interessen des „Betroffenen” (hier
des Kommitenten) gewahrt bleiben, ein Selbstkontrahieren toleriert
wird. | |
Dies
deshalb, weil dabei die erhöhte Gefahr von Interessenkollisionen
besteht. Man kann üblicherweise nicht „zwei Herren gleichzeitig
dienen”! | Insichgeschäfte: grundsätzlich unzulässig |
So
bestimmen für den Bereich der gesetzlichen Stellvertretung die §§
271 f ABGB, dass im Kollisionsfall (zwischen den Interessen eines
Minderjährigen und seines gesetzlichen Vertreters) vom Gericht ein Kollisionskurator zu bestellen
ist. – Zu Vertragsschlüssen zwischen Eltern / Vormündern und den
von ihnen gesetzlich vertretenen Kindern / Mündeln etc → KAPITEL 4: Die
Handlungsfähigkeit . | Kollisionskurator |
Insichgeschäfte werden
aber als zulässig erachtet, wenn: | Ausnahmen |
| • der oder die vom
Geschäft betroffenen Machtgeber / Vertretenen zustimmen oder genehmigen, also
damit einverstanden sind; oder | |
| • wenn durch das Geschäft die Interessen des
Vertretenen / Machtgebers nicht gefährdet, sondern ausschließlich
gefördert werden. | |
 | |

|
AnwBl 1977, 25: Doppelvertretung –
Der Rechtsanwalt, der Wohnungseigentumsverträge verfasst und von
den WE-Werbern bevollmächtigt wurde alles zu veranlassen, was zur
Begründung von Wohnungseigentum nötig und nützlich ist, begeht eine
Doppelvertretung, wenn er die Baufirma in Prozessen gegen diese
Wohnungseigentümer vertritt. Bei der Doppelvertretung vertritt
ein Dritter – zB ein Rechtsanwalt – beide Vertragsparteien, ist
aber selbst nicht Vertragspartei. – Anders das Selbstkontrahieren:
Hier ist der Vertreter selbst Vertragspartei und vertritt darüber
hinaus noch den anderen Vertragsteil. | |
|
|
|
EvBl 2000/63: Unzulässige
Doppelvertretung – § 18 Abs 5 und 6 GmbHG, wonach selbst
die Gültigkeit eines vom Alleingesellschafter mit der von ihm vertretenen
Gesellschaft abgeschlossenen außergewöhnlichen Insichgeschäfts nicht
anzuzweifeln ist, wenn hierüber unverzügliche eine Urkunde errichtet
wurde, gilt nicht für den Fall der Doppelvertretung. An der grundsätzlichen
Unzulässigkeit von Insichgeschäften hat sich durch die mit dem EU-GesRÄG
geschaffene neue Rechtslage nichts geändert. | |
|
|
|
OGH 12. 4. 2000, 4 Ob 71/00w, EvBl 2000/176:
Geschäftsführer der A-GmbH gründet mit Partnern die B-GmbH in der
Absicht, Geschäfte mit der A-GmbH zu tätigen. – OGH: Erteilt der
Geschäftsführer einer GmbH (hier: A-GmbH) ohne Wissen und Zustimmung
der übrigen Geschäftsführer einer andern Gesellschaft (hier: B-GmbH),
an deren geschäftlichem Erfolg er persönlich interessiert ist, einen
„Auftrag” (hier: Kaufvertrag), der mit den Interessen der von ihm
vertretenen Gesellschaft in Widerspruch geraten könnte, sind die
von der Lehre und Rspr zur Gültigkeit von Insichgeschäften entwickelten
Grundsätze analog anzuwenden. (Zu beachten ist,
dass bei aufrechtem Gesellschaftsverhältnis ein Konkurrenzverbot
besteht.) | |
|
| |
 Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis |
 B. Die Zeit im
Privatrecht B. Die Zeit im
Privatrecht |
| |

