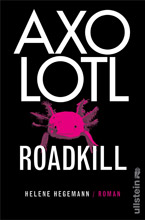
Der Fall Hegemann. Analyse einer Debatte
In Zeiten, in denen Intertextualität als wichtiges Qualitätsmerkmal literarischer Texte gilt, braucht es schon ein einigermaßen dreistes Vorgehen, um eine Welle der Empörung auszulösen, wie es der Debütroman Axolotl Roadkill von Helene Hegemann getan hat. Was muss aber passieren, damit der Roman einer erst Siebzehnjährigen die Geister so entzündet ...... und die ungekennzeichnete Übernahme aus anderen Texten nicht einfach als Unreifheit abgetan wird, sondern zum Skandal, ja zum Fall Hegemann hochstilisiert wird? Ein Vergleich der äußeren Ereignisse und der Reaktionen der Kritik soll helfen, auf diese Frage eine Antwort zu finden.
Der Hype
Am 18.1.2010 erscheint der Roman beim Berliner Ullstein Verlag. Es kommt nicht oft vor, dass sich das Feuilleton beinahe uneingeschränkt zu Begeisterungsstürmen hinreißen lässt, schon gar nicht bei einer so jungen, noch nicht etablierten Autorin. Axolotl Roadkill aber wird erstaunlich geschlossen als literarische Sensation gefeiert: „Das Buch ist phänomenal“, urteilt Georg Diez in der Süddeutschen Zeitung und im Tages-Anzeiger und ortet einen „schwarz funkelnden Roman, der von bestechendem Rhythmus ist und fast ohne einen falschen Ton“. Hegemann habe gar „den Roman ihrer Generation geschrieben“ (Diez 23.1.2010). Ähnliches liest man in der FAZ. Eine „Sensation“, „eine erzählerische Kraft, die ungeheuerlich ist“, lautet das Urteil hier und gleich wie Diez glaubt auch die FAZ, den „großen Coming-of-age-Roman der Nullerjahre“ (Delius 22.1.2010) gefunden zu haben. Von SZ, FAZ bis hin zum Spiegel, im gesamten deutschsprachigen Feuilleton werden wahre Hymnen auf das literarische Wunderkind gesungen, wobei vor allem die Härte, Vulgarität und Authentizität als Qualitätskriterien beschworen werden.
Der prototypische Roman einer Generation soll das Werk also sein, was einigermaßen verwundert und wissenschaftlichen Kriterien nicht standhält, denn was die Autorin hier liefert ist weder formal, noch auf Ebene des Sujets revolutionär, sondern steht deutlich in der Tradition der Popliteratur, mit seiner drastischen und überpointierten Sprache, die von den Eskapaden einer gelangweilten, weil finanziell privilegierten Jugend und ihrem Marken-Fetischismus handelt, der eine innere Leere nicht zu füllen vermag, genauso wenig wie Drogenkonsum und Sex. Die Drastik der Sprache wurde lediglich auf ein neues Niveau gehoben, aber nicht neu erfunden. Das Feuilleton aber ist sich einig: Hier wurde „große, unvergessliche Literatur“ gemacht, von einem „ungeheuren literarischen Talent“ (Biller 24.1.2010).
Sollte es noch vor den Plagiatvorwürfen einen Verriss gegeben haben, so konnte trotz großer Bemühungen keiner gefunden werden. Eine der wenigen zurückhaltenderen Besprechungen liefert das Neue Deutschland. Eine Woche nach den ersten Kritiken betätigt es sich auch schon als Kommentator der Begeisterungswelle rund um das Buch:
Wir gestehen, dass ein derartiger Hype uns reflexartig mit Skepsis erfüllt und mit neidvoller Abscheu vor gewieften PR-Strategen. Aber mit Neugierde auch. Immerhin ist die Rede hier ja nicht von einer digitalen Schiefertafel der Firma Apple, sondern von Literatur. Nach dem Ende der hastigen Lektüre hält sich unsere Bewunderung für die klug verdorbene Sprachwucht der Autorin die Waage mit unserer Verwunderung über den „Wunderkind“-Enthusiasmus einiger Rezensenten. (Hatzius 28.1.2010)
Abgeschrieben?
Auf den Hype folgt die Ernüchterung: Am 5.2.2010 stellt Deef Pirmasens in seinem Blog Gefühlskonserve Textstellen aus Hegemanns Roman dem schon ein Jahr vorher veröffentlichten, aber unbeachtet gebliebenen Roman Strobo von Airen gegenüber und zeigt so nicht nur Ähnlichkeiten auf, sondern entlarvt ganze Textpassagen als mehr oder weniger abgeschrieben. Das sieht zum Beispiel so aus:
„AxolotlRoadkill, Seite 23: "Ich habe Fieber, Koordinantionsschwierigkeiten, ein Promille im überhitzten Blut…"
Im Buch STROBO […], welches der Berliner Blogger Airen letztes Jahr veröffentlichte, heißt es auf Seite 106: "Ich habe ein Grad Fieber sowie ein knappes Promill Alkohol im überhitzten Blut."“
Am 7.2. veröffentlicht Pirmasens weitere Textstellen, diesmal im Vergleich mit dem Blog desselben Autors:
„Axolotl Roadkill, Seite 11: 'Meine Existenz setzt sich momentan nur noch aus Schwindelanfällen und der Tatsache zusammen, dass sie von einer hyperrealen, aber durch Rohypnol etwas schlecht aufgelösten Vaselintitten-Installation halb zerfleischt wurde.'
Vergleich mit Airens Blogtext Einerseits vom 28. Mai 2009: '…für Erwachsene, mit farbigem Schattenspiel auf hyperrealen aber durch Rohypnol etwas schlecht aufgelösten Vaselintitten, …'“
Schon wenige Tage danach werden Pirmasens' Anschuldigungen vom Feuilleton aufgenommen, Schlagzeilen wie diese machen die Runde: „Plagiatsvorwurf. Ein Blogger ‘entlarvt‘ das Wunderkind“ (Ebel 9.2.2010). Den Vorfall als Lappalie abzutun kann sich das Feuilleton nicht leisten, hat es sich doch vorher weit aus dem Fenster gelehnt. Wertungen wie: „ein Deutsch […] das es noch nie gab“, „so verführerisch und individuell, dass ab morgen bestimmt hundert andere deutsche Schriftsteller – manche sogar gegen ihren Willen – den Hegemann-Sound nachmachen und dabei natürlich absolut scheitern werden“ (Biller 24.1.2010), erscheinen in Retrospektive, mit dem Wissen, dass der Hegemann-Sound so nicht von Hegemann ist, völlig überzogen.
Am 7.2. reagiert Ullstein mit einer Presseerklärung, in der die Autorin sich zu ihrer Arbeitsweise bekennt und in der ungekennzeichneten Übernahme von Fremdtext nichts Falsches erkennen kann. Der Verlag selbst sieht das etwas anders und weist darauf hin, dass Hegemann vor Drucklegung nach der Verwendung von Zitaten gefragt worden sei. Selbstverständlich werde man nun nachträglich alle notwendigen Rechte einholen.
Mit dem Bekanntwerden der Vorwürfe stellt sich für die Literaturkritik folgende Frage: Welche Auswirkungen hat die neue Information für die Beurteilung der Qualität des Textes? Im Grunde haben sich die KritikerInnen, die den Roman positiv bewertet haben, nichts vorzuwerfen – wenn ihr Urteil auf Grundsätzen basiert, die für jede Buchbesprechung gelten sollten, nämlich der Wertung aufgrund ästhetischer und inhaltlicher Kriterien. Dass sie den ‚Schwindel’ nicht bemerkt haben, kann man ihnen mit Sicherheit nicht anlasten. Strobo ist, ohne größere Beachtung hervorzurufen, beim Berliner Kleinverlag SuKuLTur erschienen und auch sonst gab es keine zwingenden Hinweise, die zu Misstrauen hätten führen müssen, auch wenn Textstellen wie diese in Retrospektive ein Schmunzeln hervorrufen:
„Es ist also nicht von dir?“
„Nein. Von so ’nem Blogger.“ (Hegemann 2010, S.15)
Sollte der Text also nach professionellen Grundsätzen beurteilt worden sein, so gibt es keinen Grund zu einer Neubewertung. Doch in der Hegemann-Rezeption liegt der Fall etwas anders: Text und Image der Autorin waren und wurden von Anfang an so eng miteinander verschränkt, dass sie nun kaum getrennt voneinander wahrgenommen und beurteilt werden konnten. Diese Verschmelzung wurde vom Verlag bewusst inszeniert und als Marketinginstrument eingesetzt. Jetzt plötzlich wird man die Geister, die man rief, nicht mehr los – und das Ansehen des Textes sinkt mit dem der Autorin. Auf die Verkaufszahlen hat das immerhin den gegenteiligen Effekt, was Ullstein natürlich auch weiß. Die Kritik muss sich fragen lassen, ob sie nicht doch einem Hype aufgesessen ist bzw. diesen erst ermöglicht hat. Seitenlange Porträts, Interviews, der Hinweis auf den berühmten Vater und den biographischen Background und die bei Jungautorinnen scheinbar unvermeidlichen, in schwarz-weiß gehaltenen Fräuleinwunder-Fotos zeugen von einer Inszenierung, die den Text in den Hintergrund rücken lässt. Wenn der Roman tatsächlich so gut ist, dann sollte nochmals über Barthes Tod des Autors nachgedacht werden, denn dann kann der Text vom Autor/den Autoren abstrahiert werden und es bliebe möglicherweise unabhängig von der Urheberdebatte, die auf einer anderen Ebene zu führen ist, ein großes Stück Literatur. Da die potenziellen LeserInnen jedoch so eindringlich auf die Sensationsautorin eingeschworen wurden, ist es fraglich, ob der Text überhaupt noch lesbar ist, ohne das Image der Autorin Hegemann im Hinterkopf zu haben.
Das Problem, dem sich einige LiteraturkritikerInnen jetzt stellen müssen, ist die Verzahnung ihres Werturteils mit Faktoren, die weit außerhalb des Textes liegen, sprich die Messung der Qualität an Reife und Authentizität der Autorin. Nicht zufällig entsteht gleich nach den Plagiatsvorwürfen die Diskussion, ob Hegemann tatsächlich im Berliner Club Berghain ein- und ausgeht oder ob ihre Erfahrungen „aus zweiter Hand stammen“ (Michalzik 9.2.2010), sogar der Türsteher wird da befragt (vgl. Marquardt 25.2.2010), als hätte das irgendetwas mit der Qualität des Textes zu tun. Authentizität wird so in die Nähe von Autobiographie gerückt, eine absurde Argumentation. Umso mehr erhärtet sich der Verdacht, dass die literarische Sensation aus der Gleichsetzung von Hauptfigur Mifti mit der Autorin erwachsen ist und im Lichte der neuen Erkenntnisse sehr schnell wieder entzaubert wird. Im einsetzenden Meta-Diskurs, einer analytischen Kritik der Kritik, wird der Hype schließlich als solcher erkannt, so zum Beispiel in der Welt, die erklärt, „Wie die Literaturkritiker überfahren werden“:
„Tatsächlich klangen viele der aufgeregten Kritiken und Porträts, die halfen „Axolotl Roadkill“ auf die Bestsellerliste zu hieven, sehr danach, als würden die Rezensenten das Buch nicht als Fiktion, sondern als Lebensbeichte einer wohlstandsverwahrlosten, süchtigen, von Vater und Mutter verlassenen 17 Jahre alten Rebellin auffassen, die aus Protest gegen eine kaltherzige Erwachsenenwelt Selbstzerstörung betreibt.“ (Wittstock 17.2.2010)
An Selbsteinsicht mangelt es jedenfalls nicht. Die Frankfurter Rundschau gibt zu, dass der Fall für die Kritik „etwas Peinliches“ darstellt und man „das Gefühl, jemandem auf den Leim gegangen zu sein“ (Michalzik 9.2.2010), nicht verleugnen kann. Ursula März reagiert ebenfalls selbstreflexiv: „Und schließlich habe ich meine eigene Urteilskraft in Frage gestellt: Hätte ich nicht kritischer sein müssen?“ Die meisten hingegen halten an ihrem ästhetischen Urteil fest und akzeptieren Hegemanns Vorgehensweise.“ (März 12.2.2010)
Intertextualität oder Plagiat?
Interessant sind die Diskurse, die in der und rund um die Debatte geführt werden – und jene, die bis jetzt ausgeblieben sind. Die logische Konsequenz, eine Rezensionsflut zu Strobo, findet sonderbarerweise nicht statt, der Prätext interessiert nur auf Urheberrechtsebene. Auch Mechanismen des Kulturbetriebs werden kaum hinterfragt, etwa weshalb die 17jährige Hegemann bei einem bekannten Publikumsverlag erscheint, Airens Roman hingegen völlig unbekannt bleibt. Zumindest ein qualitativer Vergleich wäre angebracht und sinnvoll, doch einzig Andreas Kilb von der FAZ scheint sich dieser nahe liegenden Frage angenommen zu haben, auch wenn sein Urteil etwas kurz ausfällt. Strobo sei „eine gleichmäßig dahinfließende Litanei, deren Grellheiten auf die Dauer etwas Lähmendes haben“ (Kilb 9.2.2010).
Stattdessen entzündete sich eine Grundsatzdiskussion um Intertextualität und das Urheberrecht, eine Debatte, die in Zeiten von Google Books und einer mit „Copy & Paste“ aufgewachsen, jungen AutorInnengeneration überfällig war. Es entstehen zwei Fronten: die Verteidiger von Hegemanns Arbeitsweise und jene, die sie angreifen. Der Verlag versucht eine elegante Wendung und stellt neuen Auflagen folgende Erklärung voran: „Dieser Roman folgt in Passagen dem ästhetischen Prinzip der Intertextualität und kann daher weitere Zitate enthalten.“ Plötzlich geht es also um Intertextualität, ein Verfahren, das immer schon angewendet wurde, von Julia Kristeva einen Namen bekam und in der Postmoderne zum wichtigen Qualitätsmerkmal avancierte. Dass ein Verlag sich bemüßigt fühlt, dieses literarische Verfahren zu benennen, ist allerdings entlarvend und lässt nichts Gutes vermuten. Theison hält in der NZZ fest: „Der Literaturwissenschaft dürfte es etwas mulmig geworden sein ob dieser Botschaft“ (Theison 25.2.2010). Dem ist tatsächlich so. Selbstverständlich steht der Text im Kontext der Intertextualität – aus dem einfachen Grund, dass es kein außerhalb der Intertextualität gibt. In seiner am weitesten gefassten Dimension bedeutet der Begriff ja nichts anderes, als dass kein Text aus dem Nichts kommt, sondern sich in ein Geflecht von Vorgängern und Nachfolgern, bewussten und unbewussten Referenztexten einfügt, vorerst ohne dabei etwas über intentionale Textverweise auszusagen. Das nämlich fällt in den Bereich aktiver Techniken der Intertextualität, zu denen Montage und Zitat gehören. In diesem Kontext spielt es eben doch eine Rolle, ob von kanonisierten AutorInnen abgeschrieben wurde oder von unbekannten, und wichtig ist ausnahmsweise nicht das „hierarchische Denken (nach oben wird zitiert, nach unten abgeschrieben)“ (Dell 11.2.2010), das Matthias Dell in der Debatte erkennt, was wiederum nicht heißt, es seien prinzipiell keine intertextuellen Bezüge zu unbekannten AutorInnen zulässig. Die Grundsatzdiskussion um Intertextualität, in die sich immer mehr Parteien in Folge verstrickten, war zu abstrakt. Oberflächliche Verweise auf andere Schriftsteller wie Thomas Mann, Elfriede Jelinek oder gar Döblin, die ebenfalls Fremdtexte in ihre Texte eingebaut haben, greifen zu weit und sind sowieso unumstritten.
Intertextualität oder Plagiat ist nun die Frage, die das Feuilleton beschäftigt. Theison fällt in der NZZ ein harsches Urteil: „Hier wurde ohne irgendwelche poetologischen Hintergedanken ein wenig Fremdtext kopiert. Kein Intertext, keine Materialästhetik – Plagiat. Was denn sonst“ (Theison 25.2.2010). Jürgen Graf hingegen verteidigt Hegemanns Übernahmen in die Zeit als legitim:
„Helene Hegemann macht also an keiner Stelle ihres Romans einen Hehl daraus, dass ihr Text auf Fremdtexte zurückgreift. Sie zeigt offen, dass sie im Sinne einer Montageästhetik aus fremden Texten kopiert, nur gibt sie nicht an, an welchen Stellen und aus welchen Texten dies geschieht. Doch dies hat noch kaum ein Montageautor jemals getan, insbesondere nicht die Vielgerühmten unter ihnen. Bei den Großen der Literatur gilt das verschleierte Zitat als Kunst, warum also ist es ausgerechnet bei Helene Hegemann ein Plagiat?“ (Graf, 17.2.2010)
Beides klingt überzeugend. Für ein wirklich fundiertes Urteil müsste jedoch jede einzelne Passage gesondert untersucht werden. Übernahmen von originellen Wortbildungen wie „Technoplastizität“ oder „Vaselintitten“ suggerieren nur die eigene Originalität, verweisen aber nicht über den Text hinaus. Bleiben diese Verweise unmarkiert, so hat der Leser keinerlei Mehrwert davon, da weder ein innovativer Umgang mit dem übernommenen Material noch eine tatsächliche Transformation stattgefunden hat, weshalb der Begriff Intertextualität nicht zutreffend ist und der üble Nachgeschmack bleibt, dass sich hier jemand mit fremden Federn schmücken wollte. Andere Textstellen, zum Beispiel einmontierte Songtexte, verdienen dieses Prädikat sehr wohl. Insgesamt gesehen ist die Verknüpfung von Hegemanns Arbeitsweise mit dem Begriff eher schädlich, denn Intertextualität, die diese Bezeichnung verdient und tatsächlich aus etwas schon Bestehendem Neues erschafft, braucht keine Fußnoten und auch kein Quellenverzeichnis. Das sieht auch das Urheberrecht so vor; wer Neues schafft, braucht keine Einwilligung. Die Verteidigungstiraden für das relativ plumpe, in jedem Fall aber unnötige Kopieren von Fremdtext lesen sich, die Furche formuliert es treffend, wie „eine Intellektualisierung des Abschreibens“ (Lexe 25.2.2010).
Um auf Nummer sicher zu gehen, fragte Die Welt gleich bei Julia Kristeva höchstpersönlich nach, wie denn der Begriff nun zu verstehen sei. Unter dem etwas irreführenden Titel „Seitenweise Text abschreiben – das ist keine Intertextualität“ (Kristeva 18.3.2010) erklärt die Philosophin den Begriff und wie er von bloßem mechanischem Diebstahl abzugrenzen ist. Wo Hegemann einzuordnen ist, vermag Kristeva nicht zu beurteilen, da sie den Text nicht kennt.
Entgleisungen
Wie stark der Roman und seine Bewertung mit dem Image der Autorin verknüpft werden, zeigt sich nicht zuletzt an den Spitzen, denen Hegemanns Person in der Debatte ausgesetzt wird. Da heißt es: „Stattdessen bemüht sie das Vokabular der Postmoderne, als hätte sie ihre ganzen 17 Jahre im Foucault-Seminar verbracht. […] Ist der Teenager zu jung, um das zu verstehen? Sie beherrscht das Schuldabweisungsvokabular wie zwei hochbezahlte Altadvokaten“ (Joffe 18.2.2010). Selbst Kritik am Feuilleton klingt wie Häme gegen die Autorin: „Wenn das so weitergeht, wird man demnächst eine Siebenjährige entdecken und ihr Gestammel über die ersten Doktorspiele zum Bestseller hochjubeln. Nur ein Großer wie Marcel Reich-Ranicki kann uns davor noch bewahren. (Krause-Burger 25.2.2010)
Und schließlich wird der Fall Hegemann zum Kampf von ‚weiblicher’ Jugend und ‚männlichem’ Establishment hochstilisiert. „Das Gör“ bekomme „für sein anstößiges, die Regeln missachtendes Machwerk auch noch mehr Geld und mehr Aufmerksamkeit als all die wertvollen regelkonformen Produkte, die die alten Männer propagieren!“ Das sei auch der Grund, weshalb „die Feuilletonbürokraten gerade Empörung aus jeder Pore“ (Heine 12.2.2010) dampfen würden. Ganz ähnlich sieht es Irisch Radisch in der Zeit: „Chaos und die Bedenkenlosigkeit einer noch nicht hierarchisierten, noch nicht durch Männerkartelle kontrollierten Medienkultur“ sei in den „Machtbereich der alten literarischen Leitkultur“ eingedrungen und das habe den „patriarchalischen Radau“ (Radisch 18.2.2010) zu verantworten. Ob dem so ist, bleibt Spekulation. Auffällig ist in jedem Fall, dass erst nach den Plagiatsvorwürfen Verrisse auftauchen, jetzt dafür reichlich böse:
„Im Gegensatz zu einigen meiner Kritikerkollegen (darunter sehr respektierte und verehrte Kollegen) halte ich „Axolotl Roadkill“ für derart missraten und wirr, das Deutsch Helene Hegemanns für so unbeholfen und dümmlich, dass ich das Buch (zähneknirschend) ein zweites Mal las, weil ich fürchtete, irgendwas übersehen zu haben, was die sehr respektierten und verehrten Kollegen entdeckt hatten. Aber ich fand nichts. Das Buch ist und bleibt für mich eine Wüste der Einfallslosigkeit und der schlechten Sprache.“ (Wittstock 17.3.2010)
Die Frage, die sich den LeserInnen stellt, ist nicht, wie Wittstock vermutet, weshalb er über ein Buch schreibt, das ihm nicht gefällt, sondern: Weshalb erst jetzt? Plötzlich ist der Roman „keine Literatur, sondern Pornographie“ und es ist offensichtlich „dass die Autorin weder über die Erfahrung noch über die Sprache verfügt, um überhaupt einen Roman schreiben zu können“ (Steinfeld 11.2.2010). Wenn das so offensichtlich ist, weshalb kommen diese Verrisse erst nach den Plagiatsvorwürfen? Weshalb wird Hegemann vom „Wunderkind der Boheme“ (Rapp 18.1.2010) zum „naseweise[n] Teenager“, der „Schriftstellerin sein will“ (Steinfeld 11.2.2010) und daher abschreiben muss? Matthias Heine vermutet böse: „Die Pfaffen, die über den Zugang zur Kultur wachen, sind froh, endlich etwas anderes gegen Helene Hegemann in der Hand zu haben, als nur ihre eigenen Vorurteile“ (Heine 12.2.2010).
Es sind nicht zuletzt diese verspäteten Verrisse, die zeigen, dass in dieser Debatte der Leser vollständig aus den Augen verloren wurde. Stattdessen schreibt das Feuilleton über, gegen und für sich selbst und inszeniert sich in einer dem Anlass völlig unangemessenen Aufgeregtheit, die erstaunt. Ginge es tatsächlich um das potenzielle Publikum von Axolotl Roadkill, wäre es dann nicht mutiger gewesen, sich gleich gegen den kollektiven Hype zu stellen und eine etwas ausgewogenere Bewertungskultur zu forcieren?
Eine vollständige Entgleisung und Entprofessionalisierung der Debatte zeigt sich in wilden Spekulationen, ob in Wahrheit Vater Carl Hegemann für den Roman verantwortlich sei (vgl. Kaube 10.2.2010), und in psychologischen Amateur-Diagnosen, die „Kaputtheit der Sprache“ sei „ein Zeichen dafür, dass die Autorin, die ihren schwierigen biografischen Hintergrund mitsamt schockartigen Milieuwechsel offenkundig nicht verkraftet hat, in der Berliner Intello-Bohème allerhand Lektüre-, Lebens- und Theoriebrocken unzerkaut geschluckt und schlecht verdaut hat.“ (Ebel 18.3.2010)
Deutlicher kann die Literaturkritik ihre Grenzen wohl nicht überschreiten.
Establishment gegen Hierarchien ablehnende junge Kunst? Etablierte Schriftsteller wie Günter Grass und Christa Wolf gegen den Roman der Nuller-Generation? Es scheint fast, als wäre der Fall Hegemann ein Generationenkonflikt. Dabei wird übersehen, dass die ganze Debatte von den Kultureliten selbst geführt wird, von etablierten JournalistInnen, die im Namen einer Jugend sprechen, die niemand nach ihrer Meinung fragt – außer dem Tagesspiegel, der die Diskussion des Deutsch-Leistungskurses eines Berliner Gymnasiums festhält. Hier kommt der Roman gar nicht gut an, vor allem die angeblich authentische Sprache der Generation: „Und dann diese komische Jugendsprache. Ich hab jedenfalls nie einen gehört, der ernsthaft so sprechen würde. Außer vielleicht als Verarschung.“ Die Diskussion des Feuilletons ringt den 18jährigen nur ein Kichern ab: „Die halten das für ein Buch über die Jugendlichen von heute“ – „Rufschädigend ist das!“ „Ja, so stellen die sich die Jugendlichen vor“ (Ensikat 20.3.2010). Die von den SchülerInnen vorgenommene Analyse des Buches und auch der Debatte ist nicht nur erstaunlich scharfsichtig, sondern zudem eine erfrischende Abwechslung in der spiralenförmigen Bewegung einer Literaturkritik, die sich um sich selbst dreht. Es ist auch der Versuch, jene in den Diskurs einzubinden, um die es eigentlich gehen sollte.
Was bleibt
Die Debatte ist noch gar nicht ganz abgeklungen, da wird die Aufregung neuerlich entfacht durch die Nominierung Hegemanns für den Leipziger Buchpreis und die darauf folgende Leipziger Erklärung zum Schutz geistigen Eigentumsdes Verbands deutscher Schriftsteller, unterschrieben von prominenten Namen wie Grass und Wolf. Einen Mehrwert gewinnt die Debatte dabei nicht, dieselben Frontlinien bleiben bestehen und man kann zwei nahezu ideologisch anmutende Positionen zur Literatur und dem Literaturbetrieb erkennen, deren Vertreter das Buch als willkommenen Anlass nehmen, um ihren Standpunkt wortgewaltig in Erinnerung zu rufen. Die Leipziger Erklärung wurde vom Feuilleton so unterschiedlich aufgenommen wie der Roman, auf den sie, ohne ihn direkt zu nennen, abzielt. Auf dem Rücken von Axolotl Roadkill wird ein Diskurs geführt, der eine große Verunsicherung des etablierten Literaturbetriebes gegenüber der rasanten Veränderung des Marktes offen legt. Es zeigt sich auch eine Angst vor der nachrückenden AutorInnengeneration, der man Folgendes unterstellt: „Kopieren ohne Einwilligung und Nennung des geistigen Schöpfers wird in der jüngeren Generation, auch auf Grund von Unkenntnis über den Wert kreativer Leistungen, gelegentlich als Kavaliersdelikt angesehen.“ (Verband Deutscher Schriftsteller März 2010) Der gesamte Literaturbetrieb, damit auch alle KritikerInnen, werden aufgefordert, „geistigen Diebstahl eindeutig zu verurteilen.“ Wie die Literaturkritik in Zukunft auf diese Aufforderung reagiert, wird sich zeigen. Intertextualität oder Plagiat wird aller Voraussicht nach nicht die entscheidende Frage sein, die vom „Fall“ Hegemann übrig bleibt. Wegweisender ist vielmehr die Frage, welche Haltung der etablierte Literaturbetrieb zu neuen Produktions- und Vertriebsbedingungen einnimmt und in Zukunft einnehmen wird.
Veronika Schuchter, 07.05.2010
Zitierte Texte und Kritiken
Biller, Maxim: Glauben, lieben hassen. In: Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 24.1.2010, S.19.
Delius, Mara: Mir zerfallen die Worte im Mund wie schlechte Pillen. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 22.1.2010, S.32.
Diez, Georg: Zum Glück. In: Süddeutsche Zeitung, 23.1.2010, S.3.
Diez, Georg: Die Stimme der Gegenwart. In: Tages-Anzeiger (Magazin), 23.1.2010, S. 34-41.
Dell, Matthias: Medientagebuch. Auf den Hype folgt der Plagiatsvorwurf: Helene Hegemann. In: Der Freitag, 11.2.2010, S.14.
Ebel, Martin: Plagiatsvorwurf. Ein Blogger "entlarvt" das Wunderkind. In: Tages-Anzeiger, 9.2.2010, S. 31.
Ebel, Martin: Schriftsteller schießen mit Wortkanonen auf einen Spatz. In: Tages-Anzeiger, 18.3.2010, S.9.
Ensikat, David: Rufschädigend ist das! Berliner Schüler diskutieren Helene Hegemanns „Axolotl Roadkill“. In: Der Tagesspiegel, 20.3.2010.
Graf, Jürgen: Literatur an den Grenzen des Copyrights. In: Die Zeit online, URL: http://www.zeit.de/2010/08/Copyrights?page=all.
Hatzius, Martin: Reifen – ein Desaster. In: Neues Deutschland, 28.1.2010, S. 15.
Hegemann, Helene: Axolotl Roadkill. Berlin: Ullstein 2010.
Heine, Matthias: Die heilige Helene der Textblößen: Warum alte Männer sie hassen. In: Die Welt, 12.2.2010, S.26.
Joffe, Josef: die Kunst des Täuschens. Über das Plagiat. In: Die Zeit, 18.2.2010, S.46.
Kaube, Jürgen: Germany's Next Autoren-Topmodel. Hat Helene Hegemann selbst geschrieben oder nur selbst abgeschrieben? In: FAZ, 10.2.2010, S.27.
Kilb, Andreas: Entriegelung der Sinne. In: FAZ, 9.2.2010, S.29.
Krause-Burger, Sibylle: Die Legende von der frommen Helene. In: Tagesspiegel online, URL: http://www.tagesspiegel.de/meinung/kommentare/die-legende-von-der-frommen-helene/1687266.html.
Kristeva, Julia: „Seitenweise Text abschreiben – das ist keine Intertextualität“. In: Die Welt, 18.3.2010, S.23.
Lexe, Heidi: Das Phänomen Hegemann. In: Die Furche, 25.2.2010, S.9.
Marquardt, Sven: Lässt er Helene Hegemann rein? In: Zeit (Magazin), 25.2.2010, S.54.
März, Ursula: "Auweia!". URL: http://www.sueddeutsche.de/kultur/735/502964/text/14.
Michalzik, Peter: Mieter im eigenen Kopf. Was, wenn „Axolotl Roadkill“ abgeschrieben ist? In: Frankfurter Rundschau, 9. Februar 2010, S. 31.
Pirmasens, Deef: Axolotl Roadkill. Alles nur geklaut? In: die gefühlskonserve, URL: http://www.gefuehlskonserve.de/axolotl-roadkill-alles-nur-geklaut-05022010.html.
Radisch, Iris: Die alten Männer und das junge Mädchen. In: Die Zeit, 18.2.2010, S.45.
Rapp, Tobias: Das Wunderkind der Boheme. In: Der Spiegel, 18.1.2010, S.124-125.
Steinfeld, Thomas: Ich bin in Berlin. Es geht um meine Wahnvorstellungen. In: Süddeutsche Zeitung, 11.2.2010, S.15.
Theisohn, Philip: Nennt das Kind beim Namen. In: Neue Zürcher Zeitung, 25.2.2010, S.19.
Verband Deutscher Schriftsteller: Leipziger Erklärung zum Schutz geistigen Eigentums. URL: https://vs.verdi.de/urheberrecht/aktuelles/leipziger-erklaerung.
Wittstock, Uwe: Wie die Literaturkritiker überfahren werden. In: Die Welt, 17.2.2010, S.23.
Wittstock, Uwe: Der Axolotl-Komplex. In: Die Welt: 17.3.2010, S.8.