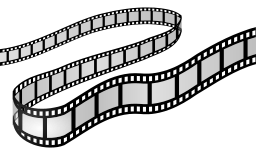
Wort gegen Bild
Kritik als Ausgrenzung und Vereinnahmung am Beispiel der Kino-Debatte. Von Martina Zerovnik„Lesewut“, „Schaulust“, „Digitale Demenz“ – Etwa alle hundert Jahre beklagt die literarische Öffentlichkeit den Untergang der Kultur. Die drei Schlagworte bezeichnen Debatten, die um gesellschaftliche und kulturelle Veränderungen und deren Auswirkungen auf das Leseverhalten und die Kunst- und Kulturrezeption der jeweiligen Zeit kreisen. Dass es sich bei diesen in den Augen mancher Kritiker nicht um positive, sondern um besorgniserregende, 'abweichende' und damit zu reglementierende Entwicklungen handelt, verdeutlicht die Wortwahl, welche die Gier nach Romanen (Lesesucht in den letzten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts), nach bewegten Bildern (Kino-Debatte in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts) oder nach dem Computer(-Spiel) als Symptome einer Krankheit der Zeit zum Ausdruck bringt. Interessant ist, dass die vorgebrachten Argumente einander ähneln und in unterschiedlichen Zeiten und Kontexten zu vergleichbaren Haltungen führen – das zeigt eine genauere Betrachtung der Kino-Debatte.
„Das trockene Buch ist vom Publikum ad acta gelegt“, konstatierte ein anonymer Autor im Jahr 1910. Diese Bemerkung findet sich in einem Artikel der Zeitschrift Lichtbild-Bühne, einer der ersten deutschen Filmillustrierten. Der unter dem Titel Neuland für Kinematographentheater publizierte Beitrag ist einer von vielen, die in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts das frühe Medium Film und dessen Auswirkungen auf die zeitgenössische Kultur, insbesondere den Literaturbetrieb – auf allen Ebenen von Produktion, Vertrieb und Rezeption – zum Thema hatten.[1] Die Filmindustrie war damals 15 Jahre jung und steckte nicht nur bereits in einer ersten Krise, ihre spezifischen Produktions- und Rezeptionsbedingungen brachten auch die offiziellen Vertreter und Hüter der Kultur in Gestalt von Verlegern, Journalisten und Pädagogen dazu, eine Krise der traditionellen Künste, allen voran von Theater und Literatur, auszurufen.
Was war passiert?
Nachdem die erste öffentliche Filmvorführung 1895 stattgefunden und sich der Film zu einer wirtschaftlichen Ressource entwickelt hatte, ließ der Reiz der Sensation mit den Jahren nach und die Zuschauerzahlen sanken. Die Filmemacher änderten daraufhin ihr Grundkonzept, nicht nur, um wieder etwas Neues – statt Kurzfilmen ein Kinoprogramm mit erzählenden Lang- und Spielfilmen – bieten zu können, sondern auch um ein neues Publikum anzusprechen. An Stelle der technischen Attraktion, bewegte Bilder, die vorwiegend Slapstick, filmische Tricks und 'dokumentarische' Alltagsszenen sowie Material aus aller Welt zum Inhalt hatten, auszustellen und auf die Schau- und Sensationsgier des Publikums zu zielen, verfolgten die Filmemacher nun eine Technik des Erzählens, die Dramaturgie, Repertoire und Stoffe in formaler und inhaltlicher Anlehnung an Theater und Literatur entwickelte. Die Geschichte in Bildern, die sich das Publikum erzählen ließ, und das Erzählen selbst rückten in den Vordergrund. Damit sollte neben den Massen an „kleinen Leuten“ auch ein kulturell (vor-)gebildetes, bürgerliches Publikum gewonnen werden, nicht zuletzt, indem man literarische Werke verfilmte sowie Autorinnen und Autoren für das Verfassen von Manuskripten engagierte.[2] Eine Konkurrenz zwischen Film und Literatur wurde heraufbeschworen und die Kino-Debatte, die darum kreiste, was Film sei und in welcher Beziehung er zu den Künsten stehe, setzte ein.
Die Haltungen gegenüber dem neuen Medium wurden von unterschiedlichen Motivationen getragen, waren mitunter sehr widersprüchlich und nicht selten wurde dasselbe Argument einmal für eine positive, ein andermal für eine negative Bewertung vorgebracht. Das „Kinematographentheater“ war Teil der technischen, politischen und gesellschaftlichen Umwälzungen der Moderne, von denen auch Kunst und Kultur betroffen waren. So konnte der Film für die einen der Todesstoß, für die anderen die Rettung der ohnehin gerade in der (Sprach-)Krise steckenden zeitgenössischen Literatur sein. Er beherrschte den öffentlichen Diskurs als, je nach Blickwinkel, höchster oder niedrigster Ausdruck der modernen Lebenswelt, wurde gefeiert (Lebendigkeit) oder verworfen (Schund), von den einen reformiert (Kinoreformbewegung), den anderen imitiert (Kino-Ästhetik). Der Film wurde zu einem Faktor, mit dem sich die zeitgenössische Kunst- und Kulturproduktion und darunter in besonderer Weise die Literatur auseinanderzusetzen hatte, denn: „Wir wollen nicht mehr nüchterne Buchstaben zu Worten zusammensetzen, die beim Buchstabieren und Sinn-Erfassen den Geist anstrengen, sondern leicht und flüchtig die bildliche Lektüre genießen. Bilder sind es, die der moderne Mensch sucht“, wie der besagte anonyme Autor der Lichtbild-Bühne schreibt (Kaes, S. 41).
Hohe Literatur: Der Film als Zerstreuung und Negation von Kultur
Was dem Film in dem Beitrag als Ausdruck eines zeitgemäßen Erzählens in Bildern zugute gerechnet wird, traf andernorts auf Ablehnung. Kulturpessimisten und kulturelitäre Kritiker hielten dem Film vor, dass er nicht mehr als Unterhaltung und Zerstreuung sei und auch die literarischen Vorlagen aus der Hochkultur auf eben diese triviale Ebene reduzieren würde. In dieser Denkrichtung stand der Film für einen Zeitgeist, der sich von „Ramsch und Kulturausverkauf“ nährte und beispielsweise Harry Haller, den Protagonisten in Hermann Hesses Der Steppenwolf (1927) eine Darbietung im Kino als „Schweinerei“ bezeichnen lässt. Es handelt sich um einen Aspekt, der auch in anderen literarischen Werken der 1920er Jahre zu finden ist und der sich auf die Gegenüberstellung der Möglichkeiten von Wort und Bild als künstlerische Ausdrucksmittel zuspitzte.
Ab 1909 (nach Kaes ist das der Zeitpunkt des Eindringens des Films in den Bereich der Buchkultur) debattierte man allerdings noch, ob der Film überhaupt dem Bereich der Kultur zuzurechnen und ob er denn Kunst sei. Der Literaturbetrieb sah sich mit dem Umstand konfrontiert, dass die Filmindustrie nicht nur literarische Stoffe, Motive und Erzählweisen für sich nutzte sowie Schriftsteller engagierte – aus ihrer Mitarbeit gingen die so genannten Autoren-Films (zur Bindung des bürgerlichen Publikums) hervor. Die Produzenten verfilmten auch bestehende literarische Werke, ob es nun Werke lebender Autoren oder Klassiker der Literaturgeschichte waren, worauf der Literaturbetrieb nicht ohne Vorbehalt reagierte. Besonders deutlich formuliert es der ehemals dem Expressionismus verhaftete Dramatiker Paul Kornfeld im Jahr 1920, als er die Filmemacher der „Leichenschändung“ bezichtigte, wenn diese sich an die Verfilmung von Werken verstorbener Autoren machten. (Kaes, S. 132)
Was sich in dieser Haltung ausdrückt, ist die „Angst ums Eigentum“, um mit Adorno zu sprechen, die Kunstrezeption aus einem „falschen Verhältnis zur Kunst“ ableitet.[3] Auch wenn Adornos Kritik an der zeitgenössischen Kulturindustrie (die den Konsum über das Verstehen von Kunst stelle) eigentlich als Argument für die Kulturpessimisten vorgebracht werden kann, dient sie auch dazu, einen anderen Aspekt sichtbar zu machen: Den 'Kulturbewahrern' ging es nicht vorrangig um den Genuss von Kultur, sondern um deren Besitz, der sich in Prestige, Mit-dabei-Sein oder, um für die Literatur zu sprechen, im Gelesen-haben-Müssen ausdrückt. Die Rezeption von Literatur und Kultur ist in diesem Zusammenhang Identitätsmerkmal, über das sich eine bestimmte Gruppe von Menschen definiert und von anderen abgrenzt. Literatur wird somit nicht als Allgemeingut betrachtet, sondern als Eigentum einer Kulturelite, die sich als Bewahrer und Verfechter des „guten Geschmacks“ versteht und darüber verfügen will, in welcher Art und Weise Literatur rezipiert und vermittelt werden darf. Ihre Wertung legt fest, was gute und was schlechte, was hohe und was niedere Literatur, was überhaupt Kunst und Kultur ist.
Die Kritik zu Literaturverfilmungen fiel in der Zeit der Kino-Debatte dementsprechend selten wohlwollend, zumeist vernichtend aus. Literaturverfilmungen wurden als Beweis dafür angeführt, dass Film die traditionellen Kunstgattungen missbrauche, weil das Ergebnis immer (erneut mit Kornfeld) „gemein, schmierig, unappetitlich, heuchlerisch, verlogen und barbarisch“ sei. Das Urteil von Kritikern wie Kornfeld kam von außerhalb, weil der Film – mitunter als „Kinematographen-Unfug“ bezeichnet – nicht als Teil der Kultur und schon gar nicht der Kunst verstanden werden wollte. Das heißt, das Ergebnis der Literaturverfilmung wurde nicht danach beurteilt, wie gelungen oder misslungen die filmische Erzählung war und die spezifischen Mittel des Films eingesetzt wurden, sondern wie gerecht der Film der literarischen Vorlage wurde oder wie genau er sich an sie hielt, worüber wiederum nicht die Rezipienten, von denen ein Großteil das Buch nicht gelesen hatte bzw. erst hinterher las, sondern die Literaturkritik urteilte.
Im Gegensatz dazu finden sich aber auch Positionen, die Literatur und Film als jeweils eigenständig betrachteten. Auch wurden mit der Zeit vor allem im Verlagswesen Synergien (Verhandlung von Filmrechten) und positive Auswirkungen auf den Absatz eines verfilmten Buches erkannt (Marketing). Auf andere Weise interessant ist in diesem Zusammenhang das Kinobuch, eine unter der Leitung von Kurt Pinthus 1913/14 herausgegebene Sammlung mit zur Verfilmung bestimmten Stücken expressionistischer Autorinnen und Autoren (Else Lasker-Schüler, Max Brod, Albert Ehrenstein, Julie Jolowicz u.a.), die nicht Synergien suchten, sondern Partei für die Eigenständigkeit des Kinos ergriffen. Im Vorwort wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es darum gehe, dem Medium „aus der Verlegenheit“ zu helfen, es aus dessen Umklammerung durch Theater und Literatur zu lösen, wieder seinem eigentlichen Wesen und Ausdruck zuzuführen und damit seinen „Irrweg und Niedergang“ aufzuhalten. Es gab also auch die umgekehrte Bewegung, die in dieser Radikalität allerdings zu den Ausnahmen zählte.
Was aber besonders deutlich wird: In der kulturpessimistischen Debatte zeigt sich eine hierarchische Betrachtung von Kultur, welche die Literatur auf ein höheres Niveau als den Film stellte. Die Filmindustrie konnte in dieser (ab)wertenden Perspektive vor allem aus zwei Gründen kein Kulturgut oder Kunstwerk hervorbringen. Erstens fehlte dem filmischen Ergebnis, das als technisches Erzeugnis unendlich vervielfältigt werden kann und aufgrund seiner auf Massenkonsum ausgelegten Produktionsweise auch muss, das „Hier und Jetzt“, welches für die Echtheit und Aura des Kunstwerks verantwortlich ist (vgl. Walter Benjamin: Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit). Zweitens verschloss ihm die Rezeptionsform der Zerstreuung und Unterhaltung den Eintritt in die Sphäre der Kunst. Die Rezeption von Kunst und Kultur wurde nicht allein mit Genuss, sondern immer auch mit einer intellektuellen Leistung, also einem gewissen Maß an Mühe in Verbindung gebracht (was ebenso für die Seite der Produktion gilt), um wieder mit Adorno zu sprechen: Kultur ist Arbeit am Verstehen. Bewegte Bilder hingegen wurden, in der Meinung der Filmgegner, ohne Leistung rezipiert, ganz anders als ein Buch, das in Entstehung und Lektüre ein besonderes Werk sei, wie es Erich Oesterheld 1913 in der Erklärung Wie die deutschen Dramatiker Barbaren wurden beschrieb: „Die Filmwirkung ist die bewußte und notwendige Ausschaltung von Gedanken und Wort, gibt nur Raum und Vorgang, gibt nur Bild im Bilde, ist also eine schematische Veräußerlichung jener Kunstform, an der Genie und Geist von Jahrhunderten gearbeitet haben.“ (Kaes, S. 99) Verkürzt ausgedrückt: Filmrezeption ist geistlos.
Die Argumentation folgt folgender Vorstellung: Literatur als Kunst erhebe den Menschen in moralischem Sinne zu Höherem, indem dieser im Zuge der Lektüre am Verstehen von sich selbst, der Gesellschaft und der Welt arbeite. Im Gegensatz dazu war der Film Nährboden der menschlichen Trieb- und Boshaftigkeit, sowohl auf der produktiven, als auch der rezeptiven Seite, wofür maßgeblich die Schaulust zur Verantwortung gezogen wurde. Der Film hatte in diesem kulturelitären Gedankengang mit Kunst ebenso wenig zu tun wie beispielsweise Trivialliteratur, wobei diese nach Meinung der Kritiker immerhin noch einen aktiven Rezeptionsprozess erforderte. Der Neurologe Robert Gaupp untersuchte 1911/12 – in einer Zeit, als der Kinematograph schon seinen Weg vom Jahrmarkt in eigens errichtete Lichtspielhäuser gefunden hatte – Die Gefahren des Kinos, indem er die Lektüre eines Buches mit der Wahrnehmung eines Films verglich, und rückte das Kinodrama in die Nähe des Detektiv- und Schundromans. Er stellt fest: Während die Leser bei der Lektüre solcher Romane innehalten, mitdenken, sich vom Inhalt distanzieren und diesen intellektuell beurteilen können – also die Trivialität erkennen und verwerfen können (dass Menschen an der Lektüre Gefallen und Genuss finden könnten, kam Gaupp gar nicht in den Sinn) –, verhindere die bildliche und emotionale Aufdringlichkeit der Filmvorführung diese Auseinandersetzung (Schweinitz, S. 64-69). Das Wort ermöglicht Distanz, das Bild fordert Nähe.
Das Publikum: Kultur als Bevormundung
Als aufdringlich beurteilen die pessimistischen Protagonisten der Kino-Debatte nicht nur die Effekte, sondern auch die Inhalte der Filme, die einem vermeintlichen Geschmack der „kleinen Leute“ entsprechen und das Emotionale, Triebhafte und Voyeuristische betonen sollten. Einige 'Kulturbewahrer' wiesen auf moralisch verwerfliche Darstellungen hin und vertraten die Meinung, es brauche das Eingreifen der Zensur, wie der Journalist und Dramatiker Alfons Paquet, der auf eine 1912 von der Frankfurter Zeitung durchgeführte Umfrage Vom Werte und Umwerte des Kinos mit der Forderung nach einer „Kontrolle des Geschmacks“ als alleinige Möglichkeit zur Hebung des Niveaus der Filme und seine damit einhergehende „Erlösung aus der Barbarei“ antwortete. Dass dies zunächst weniger auf eine Rettung des Films in die Kunst, als vielmehr auf eine Abgrenzung und Abwertung des Publikums zielte, wird deutlich, wenn er die Zensur in die Hand von einschlägigen Spezialisten legen wollte: „Und zwar sollte man sie zu allererst dem Arzt, dem Psychiater übertragen!“ (Kaes, S. 66)
Diese Richtung der Kulturreform wurde von dem Bestreben getragen, den Film einer klassischen Vorstellung von Kunst anzugleichen, worin sich wiederum ein eng gesteckter (aber schon damals nicht unbedingt zeitgemäßer) Kunst- und Kulturbegriff manifestiert. Die Tatsache, dass der Film große Erfolge verzeichnete, wurde ihm nicht zugutegehalten, sondern vor allem dem Publikum in negativer Weise angerechnet. Es entsteht mitunter der Eindruck, dass Reformer wie Gaupp das (junge) Medium und das (unmündige) Publikum gewissermaßen vor sich selbst schützen wollten: „Der dunkle Raum, das eintönig summende Geräusch, die Aufdringlichkeit der Bilder schläfern die Kritik ein, und so wird der Inhalt des Dramas zur verhängnisvollen Suggestion für die willenlos hingegebene Psyche des einfachen Menschen.“ (Schweinitz, S. 67) Hier ist er also, der „einfache Mensch“, der aufgrund fehlender Bildung den Einflüssen des „schlechten Geschmacks“ schutzlos ausgeliefert ist.
Diese Zuschreibung sprach dem Filmpublikum das ab, was Egon Friedell 1912 in einer Rede zu einer Kinopremiere auch für die Bewertung von Film einforderte (bemerkenswert: Film = Kunstwerk!): „Der wahre Dichter jedes Kunstwerks kann immer nur das Publikum selber sein.“ (Kaes, S. 46) Aus der bisher dargelegten Perspektive ist das Publikum des Films aber eine willen- und geistlose Masse, der einerseits nachgesagt wurde, sie dürste nach Sensation und Bilderfluten, der aber andererseits kein Geschmack erlaubt wurde. Das Publikum wurde als ungebildet oder moralisch verdorben der Urteilskraft enthoben, weil es keinen Zugang zu den Beurteilungskriterien der Kulturelite hatte, ihm wurden aber auch keine anderen Mittel zugestanden. Eine elitäre Minderheit entschied über eine Mehrheit, die allerdings nicht so homogen war, wie es die Kulturpessimisten gerne darstellten.
Es ist nicht falsch, dass es eine Masse an sozial schwächeren Schichten in die Kinos zog, dennoch war es nicht ausschließlich der Fall, denn alle Schichten der Gesellschaft gingen ins Kino. Das Filmpublikum war ein „klassenloses Publikum“, wie es Carlo Mierendorff 1920 formulierte (Kaes, S. 141). Spätestens, als der Film in den 1910er Jahren Häuser, Theater und Paläste erhielt, warb man gezielt um Zuschauer bürgerlicher Prägung und das Kino verlor seinen Status als Ort der schnellen und billigen Unterhaltung, den es in Varietés, Schaubuden und Kintöppen verkörperte (und den bspw. die bereits erwähnten Autorinnen und Autoren des Kinobuchs so liebten). Die Ausrichtung auf eine Zielgruppe war nicht nur an Architektur und Programm ersichtlich, der Unterschied zwischen dem Lichtspielpalast im Stadtzentrum und dem Vorstadtkino drückte sich auch im Kartenpreis aus. Die Charakterisierung des Kinos als Theater der kleinen Leute (Alfred Döblin; Kaes, S. 38) diente jedoch auch dazu, das kollektive, auf Schaulust und Zerstreuung zielende Filmerlebnis von der Erfahrung eines „gebildeten Menschen“ abzugrenzen – egal, in welcher Art von Kino es stattfand. So bemerkte Alfred Döblin 1909 (der auf der anderen Seite einen „Kinostil“ in die Literatur einbrachte): „Der Höhergebildete aber verläßt das Lokal, vor allem froh, daß das Kinema – schweigt.“ (Kaes, S. 38)
Die Gleichsetzung von Schaulust und Mangel an Bildung wird dem Phänomen und der Faszination Kino allerdings nicht gerecht, wie sich auch die Befürchtung des Schriftstellers Michael Georg Conrad – „Die stumme Kino-Schaulust bei erzählenden Vorgängen hat etwas Verblödendes. Ein richtiger Kino-Gaffer ist für das Buch verloren.“ (Kaes, S. 91) – als unbegründet herausstellen muss. Sie wird nicht zuletzt von der großen Zahl an Schriftstellerinnen und Schriftstellern entkräftet, die sich für das neue Medium begeisterten und es mitunter auch in ihren Werken (durchaus kritisch) würdigten. Zu ihnen zählen so unterschiedliche AutorInnen wie Hugo von Hofmannsthal, Arthur Schnitzler, Gerhart Hauptmann, Hanns Heinz Ewers, Claire und Yvan Goll oder Arnold Höllriegel.
Auch das bereits erwähnte Kinobuch zeugt von einer Begeisterung für das Medium. Ganz im Gegensatz zu kulturpessimistischen Positionen bezeichnete Kurt Pinthus das Filmpublikum als „Romanlesepublikum“, wobei die Romane für den Film nicht aus der Dichtung entlehnt werden, sondern aus den eigenen filmischen Ausdrucksmitteln entstehen sollten: […] die [Mimik] des Kinos muß ohne Wort bestehen und verständlich werden. Muß deshalb derber, einprägsamer, gewaltsamer sein.“[4]
Gerade Mimik und Gestik waren es allerdings, die in den Augen der Kritiker das Triebhafte und Ausschweifende repräsentierten. Die derbe Mimik der Darsteller spiegelte sich auf der Seite der Rezipienten in Form der Schaulust als emotionale Überwältigung, der sich die Zuschauer hingaben. Kontemplative Versenkung und Ergriffenheit der Kunstrezeption standen gegen triebhafte, automatische Reaktion auf Sinnesreize. In Thomas Manns Zauberberg beschreibt Hans Castorp den Besuch eines Bioskop-Theaters folgendermaßen: „Frau Stöhr […] erschien ganz Hingabe; ihr rotes, ungebildetes Gesicht war im Genusse verzerrt.“ Schon der nächste Satz relativiert jedoch diese Aussage: „Übrigens verhielt es sich ähnlich mit allen Gesichtern, in die man blickte.“ Die Wahrscheinlichkeit, dass sich unter all den Gesichtern auch das eines gebildeten Menschen befindet, erscheint hoch. Und wie verhielt es sich mit dem bürgerlichen Schriftsteller Thomas Mann? Er bezeichnete das Kino 1928 als seine „heitere Passion“ (Kaes, S. 164).
Blick in die Gegenwart
Der Film wurde von Seiten des kulturpessimistischen Protests innerhalb der Kino-Debatte selten eigenständig betrachtet. Er wurde in Abgrenzung oder Anlehnung an Literatur (und andere Künste) definiert, was wiederum Rückschlüsse darauf zulässt, welchen Stellenwert und welche Funktion die Literatur in dieser Zeit einnahm. An den zwei ausgeführten Aspekten wird deutlich, dass diese Art der Kritik an einem traditionellen Kunst- und Kulturbegriff festhielt, der in der Diskussion um „Literatur auf der Höhe ihrer Zeit“ oder „modernes Schreiben“ nicht nur gegen den Film, sondern in ähnlicher Weise auch gegen Erneuerungstendenzen in der Literatur oder avantgardistische Bestrebungen ins Feld geführt wurde. Es zeigt sich, wie im Kunst- und Kulturdiskurs Mechanismen der Ausgrenzung und Vereinnahmung zum Tragen kommen: einerseits dem neuen Medium gegenüber, also dem Phänomen Film (Film als Nicht- oder Un-Kultur), und andererseits gegenüber dem neuen Publikum, der Masse (schaulustig und ungebildet).
Diese Haltungen lassen sich in ähnlicher Weise auch in der aktuellen Debatte um Literatur im Zeitalter der digitalen Medien ausmachen. Konzentration, Mühe und intellektuelle Leistung werden als Maßstab angeführt, um beispielsweise die Produktion und Rezeption eines Blogs und eines Buches zu unterscheiden. Massenrezeption stehen Teile des Literaturbetriebs, besonders im deutschsprachigen Raum, nach wie vor skeptisch oder ablehnend gegenüber (Stichwort: Bestseller). Auch der Filmbetrieb ist von solchen Vorstellungen nicht ausgenommen, wo, meist durchaus wertend und abgrenzend, zwischen Blockbuster und Arthouse, d.i. in den meisten Fällen zwischen Unterhaltung und Kunst unterschieden wird.
Der Buchhandel hat spätestens in den 1920er Jahren erkannt, dass eine Literaturverfilmung dem Buch nichts wegnimmt, sondern zumeist den Absatz des Buches steigert. Die Masse ist ein eigener, damals war es ein neuer Faktor, der andere Formen, Regeln und Beurteilungskriterien verlangt. Es war ja nicht so, dass es eine Masse an lesenden Menschen gab, die mit dem Auftauchen des Films zu lesen aufhörten und sich von diesem Zeitpunkt an nur noch Filme anschauten.
Noch eine andere Überlegung findet sich in der Kino-Debatte: Ist es im Allgemeinen nicht eher so, dass sich die Medien gegenseitig Publikum zuspielen, als dass sie es einander wegnehmen? Je mehr und je breiter Kultur konsumiert wird, desto aufgeschlossener wird das Publikum auch für andere (künstlerische) Ausdrucksformen?
Das Zeitalter der digitalen Reproduzierbarkeit stellt die Produktion und Rezeption von Kunst und Kultur im Zusammenhang mit Vervielfältigung, Verbreitung und Verwertung digitaler Daten vor eine neue Herausforderung und vor einen Kunst- und Kulturbegriff, der eine noch nie dagewesene Vielfalt an Ausdrucksmöglichkeiten einschließt. Es herrscht der Eindruck, dass heute mehr Menschen an Kunst und Kultur teilhaben als je zuvor. Dass es nicht ein Verhältnis der Konkurrenz sein muss und Motive von Ausgrenzung und Vereinnahmung nicht zielführend sind, sondern sich ein produktives Wechselspiel zwischen den unterschiedlichen Medien entwickeln kann, zeigt die Beziehung der Literatur zum Film.
Das Buch liegt noch nicht bei den Akten. Es gibt es nach wie vor und es wird es noch lange (immer?) geben, auch wenn es seine Form verändert. Die Kino-Debatte ist ein Beispiel dafür, dass das Buch – und dieses ungewisse Etwas „Kunst und Kultur“ – trotz vieler Unkenrufe, nicht auszurotten ist und dass das eigentlich auch nie jemand wollte.
Martina Zervovnik, 23.09.2013
[1] vgl. Anthologien wie Anton Kaes (Hrsg.): Kino-Debatte, Texte zum Verhältnis von Literatur und Film, 1909-1929. München: dtv 1978 oder Jörg Schweinitz (Hrsg.): Prolog vor dem Film, Nachdenken über ein neues Medium, 1909-1914. Leipzig: Reclam 1992. Im Text zitiert als „Kaes“ und „Schweinitz“.
[2] vgl. Helmut Korte u. Werner Faulstich: Der Film zwischen 1895 und 1924: ein Überblick, In: Fischer Filmgeschichte, Band 1: Von den Anfängen bis zum etablierten Medium, 1895-1924, Hrsg. Werner Faulstich u. Helmut Korte, Frankfurt/Main 1994, S. 13–17.
[3] vgl. Theodor W. Adorno: Ästhetische Theorie, Frankfurt/Main: Suhrkamp 2003, S. 26-29.
[4] Kurt Pinthus: Das Kinobuch, Zürich: Arche 1963, S. 21 (Dokumentarische Neu-Ausgabe des 'Kinobuchs' von 1913/14).