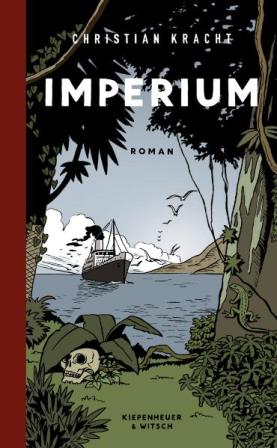
Die Methode Diez
oder: Was die Kracht-Debatte brachte. Von Brigitte Schwens-Harrant.
In Literaturdebatten in den Feuilletons geht es selten nur um Literatur, um den Text alleine. Der deutsch-deutsche Literaturstreit um Christa Wolfs Was bleibt etwa bestand aus ideologischen Grenzmarkierungen, in der Debatte um Günter Grass’ Beim Häuten der Zwiebel ging es weniger um den literarischen Text, denn um die Glaubwürdigkeit eines Autors. Die kritischen Auseinandersetzungen mit Peter Handkes Texten, um ein weiteres aktuelles Beispiel zu nennen, waren oft eher politisch motiviert denn ästhetisch. Das jüngste Aufregergedicht von Günter Grass wiederum zeigt, dass manche Autoren selbst ihre Literatur verzwecken. Das Gedicht im Dienst der Provokation: In diesem Fall blieb dann auch für alle sichtbar die Ästhetik auf der Strecke. Aber nicht die interessiert die Medien.
„,Der Text, der Text allein‘, sagt man uns, aber den Text allein gibt es nicht“, wusste schon Roland Barthes.1 Man kann nicht über den Gegenstand Text an sich sprechen oder schreiben, sondern nur über die eigene Lektüre, denn nur über diese ist der Text greifbar. Insofern haben Literaturkritiker nicht nur mit dem Text zu tun, sondern auch mit sich selbst. Dann steht ein Text nie im luftleeren Raum, sondern in einer wie auch immer (ästhetisch, politisch, ideologisch, religiös …) gestalteten und den Text und die Lektüre prägenden Welt. Es geht daher nicht bloß um ästhetische, sondern auch um inhaltliche (etwa moralische), relationale und wirkungsbezogene Werte. Das alles müssen Literaturkritiker und Literaturkritikerinnen beim Verfassen ihrer Kritiken berücksichtigen. Dass die Werte zudem nicht unbedingt per se gelten (für den einen ist die Ganzheit wichtig, für die andere das Fragmentarische, für den einen ist ein Werk gut, wenn es realistisch ist, für die andere, wenn es jeden Realismus ablehnt), macht die Sache noch komplexer. Darum wäre es wichtig, sich der eigenen Werte bewusst zu sein und sie immer wieder selbst kritisch zu reflektieren. Und darum ergeben unterschiedliche Literaturkritiken im besten Fall ein so buntes Feld.2
Die in diesem Frühjahr einige Wochen lang in den Feuilletons geführte „Debatte“ um Christian Krachts Roman Imperium aber fällt durch den sie auslösenden Beitrag aus dem üblichen Niveau der Debattenkultur heraus. Georg Diez hatte am 13. Februar 2012 im Spiegel eine Rezension von Christian Krachts Roman Imperium vorgelegt und den Autor darin als „Türsteher der rechten Gedanken“ bezeichnet. In seinem vierseitigen Beitrag sind Diez Fehler unterlaufen, die einem Literaturkritiker nicht passieren dürfen. Was der Artikel vor allem verrät, ist Diez’ Absicht: Er hat sich offensichtlich vorgenommen, dem Autor rechtes Gedankengut vorzuwerfen, und nahm Krachts neuesten Roman als Anlass, darüber zu schreiben. Nur bietet dieser Roman diesen Anlass überhaupt nicht.
Christian Kracht erzählt in seinem Roman Imperium vom Sonderling und Auswanderer August Engelhardt (1919 gestorben; bei Kracht darf er auch den Zweiten Weltkrieg überleben und von den Amerikanern das neue Imperium in Empfang nehmen: einen Hotdog). Der Nudist Engelhardt lebte auf der Insel Kabakon (Deutsch-Neuguinea) ausschließlich von Kokosnüssen. Ob dieses Werk, für das Kracht auf viele Stile und andere Werke zugreift, nun besonders originell ist oder sich nicht doch eher (etwa aufgrund der lächerlich gezeichneten historischen Figuren, die in indirekter Rede sprechen) wie ein Imitation der von Kehlmann vermessenen Welt liest, ob der manierierte Thomasmannstil mit der Zeit nervt oder nicht – das sei hier einmal dahingestellt. Die Machart des Textes und die Wirkungen zu beschreiben, müsste jedenfalls Teil einer seriösen Literaturkritik sein – und die meisten Literaturkritiker haben sich diesen Fragen in ihren Rezensionen auch gestellt.
Fehler Nummer eins der „Methode Diez“ war: Diez hat den Text nicht gelesen, jedenfalls nicht aufmerksam. Hätte er ihn gelesen, nämlich ohne die Brille „jetzt finde ich rechtes Gedankengut“, hätte er bemerken müssen, dass Krachts Roman durchgehend und hochgradig ironisch ist. Aber auch das Grauen andeutet, von dem der Erzähler weiß, dass es kommen wird:
„einer von Millionen an der Westfront explodierenden, glühenden Granatsplitter bohrt sich wie ein weißer Wurm in die Wade des jungen Gefreiten der 6. Königlich Bayerischen Reserve-Division, lediglich ein paar Zoll höher, zur Hauptschlagader hin, und es wäre wohl gar nicht dazu gekommen, daß nur wenige Jahrzehnte später meine Großeltern auf der Hamburger Moorweide schnellen Schrittes weitergehen, so, als hätten sie überhaupt nicht gesehen, wie dort mit Koffern beladene Männer, Frauen und Kinder am Dammtorbahnhof in Züge verfrachtet und ostwärts verschickt werden, hinaus an die Ränder des Imperiums, als seien sie jetzt schon Schatten, jetzt schon aschener Rauch.“ (Kracht: Imperium, S. 231)
Zum Diezschen Vorwurf der „rassistischen Weltsicht“, die den (immerhin Kolonialismus erzählenden) Roman durchdringe, sei hier nur erwähnt: Vor den zunehmenden antisemitischen Äußerungen des Engelhardt nimmt der Eingeborene Makeli schließlich Reißaus: „Er hat genug von den Weißen und ihrem Irrsinn und dieser Insel.“ (Ebd., S. 225)
Kracht aus diesem Roman einen rechten Strick zu drehen, ist daher absurd - und die Argumentation gelingt Diez denn auch nicht. So wendet er sich Krachts 2011 unter dem Titel Five Years veröffentlichten Emailverkehr mit David Woodard zu, aus dem er einzelne Stellen zitiert, um die ideologische Bedenklichkeit des Autors anzuprangern.
Freilich könnte man das tun: Aussagen eines Autors danach untersuchen, welchen Ideologien er huldigt. Dann aber gilt es achtzugeben auf die Textsorte: Interviews oder politische Stellungnahmen im Feuilleton wären (bedingt) aussagekräftig. Bei literarischen Texten, also Fiktion bzw. Figurensprache – als literarisches Spiel kann man auch den Emailverkehr lesen, von dem man ohnehin nicht sicher sein kann, ob er „echt“ ist –, stellt sich die Sachlage aber etwas komplizierter dar. Das wäre freilich die wichtigere Frage gewesen: Wie kann man die politische Haltung eines Autors festmachen, der sich wie Christian Kracht dem Festlegen ständig entzieht? Was bedeutet es politisch, wenn alles Spiel ist – oder „hohl“, wie die Herausgeber in ihrem ebenso editorisch akribischen wie unpolitischen Vorwort den Briefwechsel bezeichnen, in dem sich Kracht und Woodard von Nueva Germania fasziniert zeigen?
Diese Fragen tippte Diez erst in seiner Reaktion an, die er seiner Rezension am 27. Februar folgen ließ. Diez schwächte darin seine unhaltbaren Thesen ab und stellte Kracht wieder in den demokratischen Diskurs, aus dem er ihn zwei Wochen zuvor geworfen hatte. Da hat sich einer vergaloppiert.
Der Spiegel-Beitrag von Georg Diez rief denn auch Schriftsteller von Jelinek bis Kehlmann auf den Plan, die gegen diese Form der Romankritik protestierten. Ihnen ging es um nichts Geringeres als um die Freiheit der Kunst. Die freilich ihre Grenzen hat: Aber Imperium gibt keinen Anlass, diese einzufordern.
Es geht um Provokation, um Aufmerksamkeit. Dafür wählte Diez Schlagworte, die in Zeiten, in denen Deutschland seine blinden Flecken am rechten Auge aufzuarbeiten hat, besondere Signalwirkung haben. Eine Woche später, ebenso im Spiegel, eine seitenfüllende Stellungnahme des Verlegers. Eine Ungeheuerlichkeit. Man stelle sich vor, das würde üblich: Nach jeder Literaturkritik gäbe es eine „Richtigstellung“ durch den Verlag.
Dem demokratischen Diskurs, den Diez sich vorgeblich zum Anliegen machen wollte, werden derartige aufmerksamskeitserheischende Etikettierungen wohl kaum dienlich sein. Da bräuchte es schon ein komplexeres Hinsehen und Wahrnehmen. Obwohl ihm die Sache Popularität einbrachte, hat der Literaturkritiker Georg Diez seinem Ruf damit nichts Gutes getan. Die „Methode Diez“ wird zwar in die Literaturkritikgeschichte eingehen, aber nicht weil sie so außerordentlich gut war, sondern so außerordentlich daneben. Dienlich war die Sache vor allem der Medienpräsenz des Kracht‘schen Buches, das so viel Aufmerksamkeit gar nicht verdient hat. Und wieder einmal siegt am Ende die PR.
Brigitte Schwens-Harrant, 25.06.2012
[1] Roland Barthes: Das Lesen schreiben. In: [Ders.]: Das Rauschen der Sprache. (Kritische Essays IV). Aus dem Französischen von Dieter Hornig. Frankfurt/Main: Suhrkamp 2006, S. 29-32, hier S. 31.
[2] Vgl. Brigitte Schwens-Harrant: Literaturkritik. Eine Suche. Innsbruck: StudienVerlag 2008, S. 129-139.